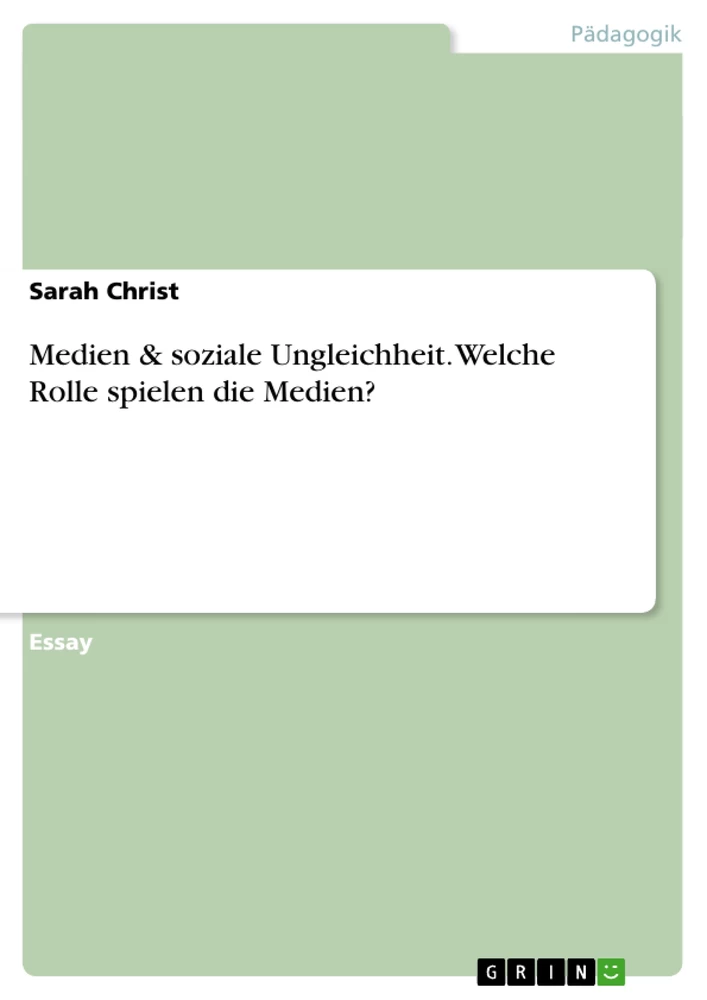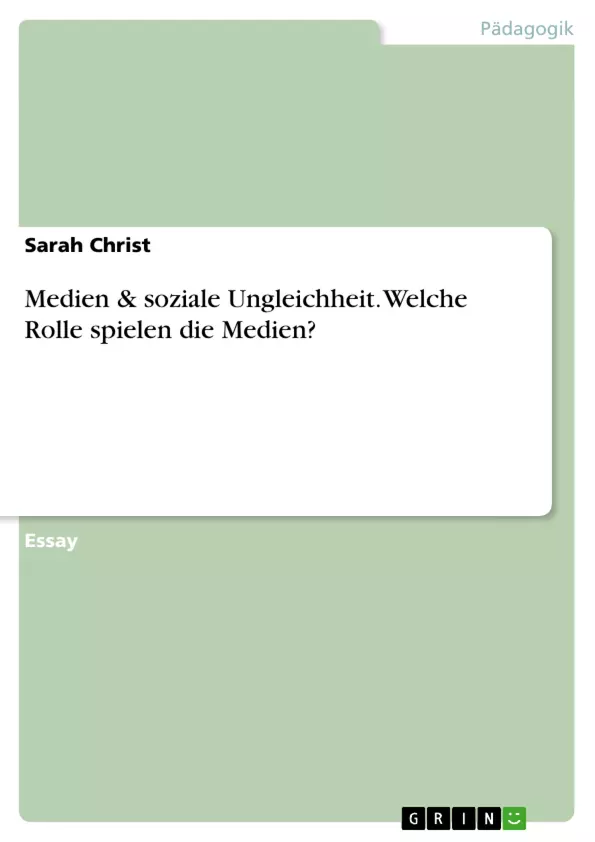Medien und soziale Ungleichheit – welcher Zusammenhang herrscht zwischen diesen Phänomenen? Korrelieren die beiden Größen statistisch miteinander? Lösen Medien beziehungsweise die mediale Nutzung soziale Ungleichheit aus? Oder haben die strukturellen Kategorien der sozialen Ungleichheit eine Wirkung auf den Gebrauch von Medien?
Über diese Fragen möchte ich gerne in meinem Essay „Medien & soziale Ungleichheit“ diskutieren. Dabei nehme ich zuerst Bezug auf die ungleichen Entwicklungs- und Lebenschancen der heranwachsenden Generation. Danach erläutere ich das konstruktivistische Lernkonzept und die dazugehörigen mediendidaktischen Entwicklungen. Im Anschluss möchte ich das Medienhandeln der Jugendgeneration näher beleuchten und hier die Potenziale zur Verstärkung oder zum Aufbrechen von Benachteiligung herausarbeiten. Hierbei werde ich versuchen zu erklären, wie der mediengestützte konstruktivistisch ausgerichtete Unterricht helfen könnte sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken.
Medien und soziale Ungleichheit – welcher Zusammenhang herrscht zwischen diesen Phänomenen? Korrelieren die beiden Größen statistisch miteinander? Lösen Medien beziehungsweise die mediale Nutzung soziale Ungleichheit aus? Oder haben die strukturellen Kategorien der sozialen Ungleichheit eine Wirkung auf den Gebrauch von Medien?
Über diese Fragen möchte ich gerne in meinem Essay „Medien & soziale Ungleichheit“ diskutieren. Dabei nehme ich zuerst Bezug auf die ungleichen Entwicklungs- und Lebenschancen der heranwachsenden Generation. Danach erläutere ich das konstruktivistische Lernkonzept und die dazugehörigen mediendidaktischen Entwicklungen. Im Anschluss möchte ich das Medienhandeln der Jugendgeneration näher beleuchten und hier die Potenziale zur Verstärkung oder zum Aufbrechen von Benachteiligung herausarbeiten. Hierbei werde ich versuchen zu erklären, wie der mediengestützte konstruktivistisch ausgerichtete Unterricht helfen könnte sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken.
Wie schon seit längerem bekannt ist, herrschen starke Zusammenhänge zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft. In hohem Maße korreliert die soziale Platzierung mit dem sozialen Status der Herkunftsfamilien. Die herkunftsbedingte Chancenungleichheit verbindet sich mit den Faktoren Geschlecht und Migrationshintergrund/Ethnizität. Zudem schafft das Bildungssystem zu geringe Möglichkeiten der Korrektur.
Dies wurde in den 1960er Jahren deutlich. Die Chance eines Kindes aus einem Arbeiterhaushalt ein Gymnasium zu besuchen war um ein Vielfaches geringer als die eines Kindes aus einer Akademikerfamilie. Auch waren die Bildungschancen von Mädchen deutlich niedriger als die von Jungen. Kinder aus ländlichen Bereichen durchliefen seltener das höhere Bildungssystem, als Kinder die in Städten aufwuchsen. Das wiederum bestätigt auch das Sprichwort: „Die katholische Arbeitstochter vom Lande“.
Durch die Reform und den Ausbau des Bildungssystems wurden nun Verbesserungen von Bildungschancen für Mädchen und Kinder aus benachteiligten Milieus oder Schichten erzielt.
Die Anzahl der Gymnasiasten und Studierenden hat sich insgesamt erhöht, auch die Anzahl der Abiturienten aus Arbeiter- oder zumindest Nicht-Akademikerhaushalten ist gestiegen. Jedoch konnte kein konsequenter Abbau von schichtspezifischen Unterschieden erreicht werden.
Dennoch wandelten sich die Faktoren der Ungleichheit, die benachteiligend wirken. Allerdings bleibt das Geschlecht in der Schule nicht ohne Auswirkungen, hinsichtlich berufsrelevanter, fachspezifischer, geschlechtstypischer Interessenentwicklung. Mädchen und Frauen streben zwar höhere Bildungsabschlüsse an, jedoch können sie im Übergang zum Arbeitsmarkt ihre Berufserfolge schlechter umsetzen. Frauen erreichen im Hinblick auf Status, Einkommen und sozialer Absicherung durchschnittlich ungünstigere Positionen als Männer. Die höchsten Statuspositionen erreichen Männer ohne Migrationshintergrund aus privilegierten sozialen Milieus. „Migrantensöhne aus bildungsschwachen Familien“ haben die geringsten Chancen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in veränderter Weise sich Klassen- oder Milieuspezifische Benachteiligungen erhalten haben. Zusätzlich greifen weiterhin Mechanismen, die zur Reproduktion von sozialer Ungleichheit beitragen.
Einen großen Einfluss auf die Sozialisation eines Heranwachsenden haben die Schule und die Familie. Sie wirken als sozialer Filter, die zu Ausschluss oder Abdrängung von Kindern aus bildungsfernen Familien führen. Allerdings hat die Schule im Vergleich zur Herkunft zu geringe korrigierende Wirkung. Dies bedeutet, dass im Durchlaufen des Bildungssystems zu wenige Herkunftsbedingungen ausgeglichen werden. Sie münden eher in ungleiche Lernvoraussetzungen und in ungleiche Bildungserfolge. Dabei stellt sich die Frage, welche Herausforderungen sich stellen bei Versuchen des Aufstiegs aus sozial benachteiligten, diskriminierten oder sogenannten bildungsfernen Herkunftsfamilien oder –milieus. Kinder aus bildungsfernen Milieus müssen nicht nur vielfach bessere Leistungen aufweisen, um dieselbe Beurteilung und Anerkennung zu bekommen. Darüber hinaus müssen sie über teils größere, teils andere psychosoziale Kompetenzen verfügen, als etwa Kinder aus akademischen Milieus.
Doch welches Lernkonzept bietet sich an, sozialer Ungleichheit entgegenzuwirken?
Hier möchte ich näher auf das konstruktivistische Lernen eingehen, da ich davon ausgehe, dass dieses Konzept sich als geeignet erweist, vor allem in Verbindung mit neuen Medien. Das konstruktivistische Lernen ist ein aktiver Prozess, bei dem die Lernenden ihr Wissen anknüpfend an frühere Erfahrungen und ihr bisheriges Wissen subjektiv konstruieren. Dabei wird jeweils ein eigenes subjektives Wissensnetz entwickelt. Hier erhält die Lehrperson zunehmend die Rolle eines Coachs und Organisators von Lernprozessen. Der Lernende soll sich aktiv in einer Auseinandersetzung mit seiner Umwelt befinden. Somit ist Lernen kein passives Aufnehmen und Abspeichern von Informationen und Wahrnehmungen mehr. Im Mittelpunkt des Interesses stehen weniger das Lehren und die Didaktik als vielmehr das Lernen selbst, sowie die Idee der Anregung und Förderung der Lernenden. Der Blickwinkel rückt eher auf den Lernenden und seine individuelle Wissenskonstruktion wie auch die Verbindung von Wissenserwerb und –anwendung. Damit verbunden sind entdeckende und lernzentrierte Arbeitsformen. Die Annahme besteht darin, dass der Lernende nur dann über Wissen verfügt, wenn er dieses über eigene Operationen selbst hergestellt hat. Nun ist die Lehre die Gestaltung von anregenden und reichhaltigen Lernumgebungen, die möglichst authentische Lernszenarien und unterschiedliche Zugänge zum Wissensgebiet herstellen. Dabei gewinnt die (mediale) Gestaltung der Lernumgebung eine besondere Rolle im Lehr- und Lernprozess. Hierzu fanden neue mediendidaktische Entwicklungen Einzug in den Unterricht. Im Zuge dieser Didaktik sollen Fragen nach dem angemessenen Umgang mit neuen Medien beantwortet werden. Eine wichtige Rolle spielen auch die Medienkritik sowie Kenntnisse hinsichtlich der Auswahl und Nutzung beim Lernen mit neuen Medien. Zusätzlich setzt sich die Auffassung durch, dass Lernende zu problemorientiertem, entdeckendem und selbstgesteuertem Lernen befähigt werden müssen. Medien gelten als Anlass für den Lerner, durch Interpretation von Informationen auf dem Hintergrund konstruktivistischen Lernens im gegebenen Lernkontext eigenes Wissen aufzubauen.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen soziale Herkunft und Bildungserfolg zusammen?
Es besteht eine starke Korrelation: Kinder aus Akademikerfamilien haben statistisch gesehen deutlich höhere Chancen auf einen Gymnasialbesuch als Kinder aus Arbeiterhaushalten.
Welche Rolle spielen Medien bei der sozialen Ungleichheit?
Medien können Benachteiligungen entweder verstärken oder durch gezielten Einsatz in der Bildung dabei helfen, Barrieren aufzubrechen.
Was ist konstruktivistisches Lernen?
Es ist ein aktiver Prozess, bei dem Lernende ihr Wissen basierend auf individuellen Erfahrungen selbst konstruieren, anstatt Informationen nur passiv aufzunehmen.
Wie kann mediengestützter Unterricht Ungleichheit entgegenwirken?
Durch anregende Lernumgebungen und unterschiedliche Zugänge zum Wissen können individuelle Lernvoraussetzungen besser ausgeglichen werden.
Wer sind heute die am stärksten benachteiligten Gruppen im Bildungssystem?
Statistiken zeigen, dass insbesondere "Migrantensöhne aus bildungsschwachen Familien" oft die geringsten Aufstiegschancen haben.
- Citation du texte
- Sarah Christ (Auteur), 2013, Medien & soziale Ungleichheit. Welche Rolle spielen die Medien?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262408