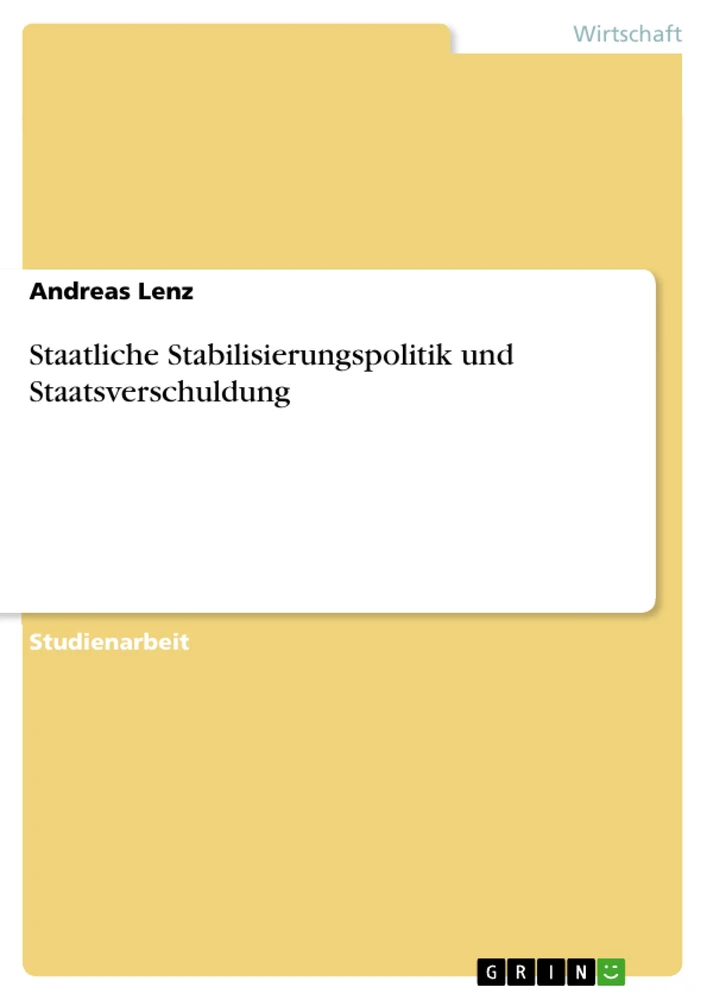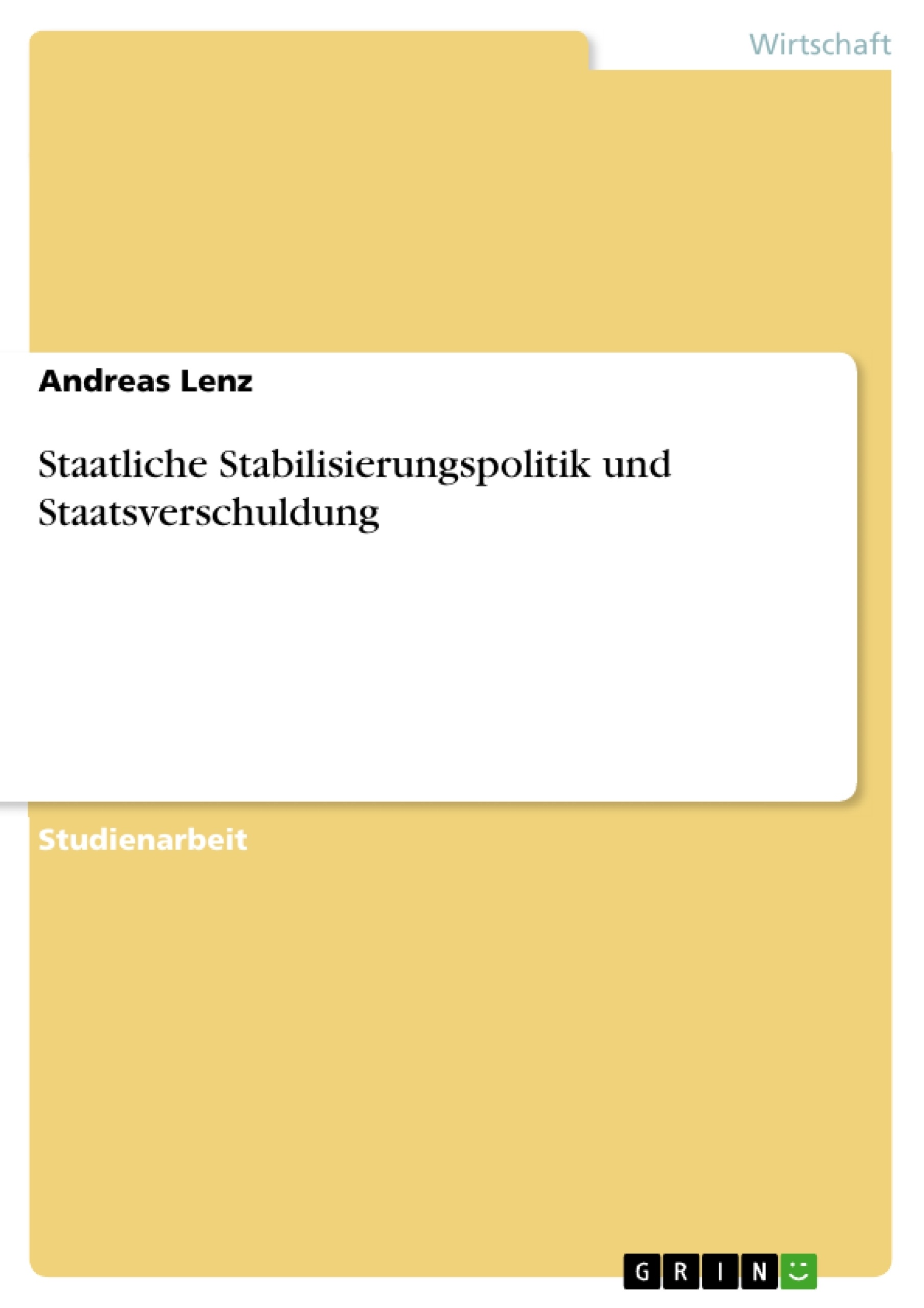Unter staatlicher Stabilisierungspolitik werden alle staatlichen Maßnahmen verstanden, die darauf ausgerichtet sind, das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht eines Landes zu erreichen und zu stabilisieren. Die Stabilisierungspolitik befasst sich mit den Möglichkeiten, wie Wirtschaftspolitiker auf Wirtschaftsschwankungen reagieren sollten. Auf der Suche nach verlässlichen Stabilisierungsinstrumenten wird versucht herauszufinden, ob die Geld- und Fiskalpolitik eine aktive oder eine passive Makropolitik im Hinblick auf die Wirtschaftsstabilisierung betreiben soll. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob eine Verpflichtung der Wirtschaftspolitiker durch Regelbindungen vorteilhafter ist im Gegensatz zu individuellen Entscheidungen von Fall zu Fall. Im Folgenden werden die verschiedenen Stabilisierungsinstrumente dargestellt und anschließend bewertet. Dabei wird untersucht, ob ein Stabilisierungsinstrument für allgemeingültig erklärt werden kann.
Eine Staatsverschuldung liegt vor, wenn die Staatsausgaben größer als die Staatseinnahmen sind und diese durch sukzessive Kreditaufnahmen vom privaten Sektor finanziert werden. Fraglich ist dabei, welche Ursachen für eine Staatsverschuldung in Betracht kommen und wie die Zukunftserwartungen für künftige Generationen dadurch aussehen. Ungewiss ist auch die Validität der Messergebnisse und welchen Einfluss die Fiskalpolitik auf das Staatsdefizit und den gegenwärtigen Konsum hat. Im Folgenden erhalten wir einige Informationen, um diese Fragen beantworten zu können.
Betrachtet sei zunächst die gegenwärtige Höhe der Staatsverschuldung in der Bundesrepublik Deutschland. Hier lag die Staatsverschuldung im zweiten Halbjahr 2012 bei über 2,15 Bio. Euro.
Inhaltsverzeichnis
- Staatliche Stabilisierungspolitik
- Einleitung
- Stabilisierungspolitische Instrumente
- Aktive Makropolitik
- Passive Makropolitik
- Regelbindung
- Einzelfallentscheidung
- Ergebnis zur staatlichen Stabilisierungspolitik
- Staatsverschuldung
- Einleitung
- Mögliche Gründe für Staatsverschuldungen
- Messprobleme
- Inflation
- Vermögensbestände
- Unberücksichtigte Verbindlichkeiten
- Konjunkturzyklus
- Zukunftserwartung
- Traditionelle Sicht der Staatsverschuldung
- Ricardianische Sicht der Staatsverschuldung
- Ergebnis zur Staatsverschuldung
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der staatlichen Stabilisierungspolitik und der Staatsverschuldung. Sie untersucht die verschiedenen Instrumente der Stabilisierungspolitik und analysiert die möglichen Gründe für Staatsverschuldungen. Des Weiteren werden verschiedene Sichtweisen auf die Staatsverschuldung, wie die traditionelle und die ricardianische Sicht, beleuchtet.
- Instrumente der staatlichen Stabilisierungspolitik
- Gründe für Staatsverschuldungen
- Messprobleme der Staatsverschuldung
- Traditionelle und ricardianische Sicht auf die Staatsverschuldung
- Zusammenhänge zwischen Stabilisierungspolitik und Staatsverschuldung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Staatliche Stabilisierungspolitik
Das erste Kapitel befasst sich mit der staatlichen Stabilisierungspolitik und ihren Instrumenten. Hierbei werden die aktive und passive Makropolitik, Regelbindung und Einzelfallentscheidungen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und Anwendbarkeit betrachtet.
2. Staatsverschuldung
Das zweite Kapitel widmet sich der Staatsverschuldung. Es beleuchtet die möglichen Gründe für Staatsverschuldungen, analysiert Messprobleme und beleuchtet verschiedene Sichtweisen auf die Staatsverschuldung, insbesondere die traditionelle und die ricardianische Sicht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Wirtschaftspolitik, darunter staatliche Stabilisierungspolitik, Staatsverschuldung, aktive und passive Makropolitik, Regelbindung, Einzelfallentscheidungen, Messprobleme, traditionelle und ricardianische Sichtweisen auf die Staatsverschuldung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter staatlicher Stabilisierungspolitik?
Es sind alle Maßnahmen des Staates, die darauf abzielen, das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht zu erreichen und auf Wirtschaftsschwankungen zu reagieren.
Wann spricht man von Staatsverschuldung?
Staatsverschuldung liegt vor, wenn die Staatsausgaben die Einnahmen übersteigen und die Differenz durch Kredite vom privaten Sektor finanziert wird.
Was ist der Unterschied zwischen aktiver und passiver Makropolitik?
Aktive Politik greift gezielt in das Wirtschaftsgeschehen ein, während passive Politik auf automatische Stabilisatoren und feste Regeln setzt.
Was besagt die ricardianische Sicht der Staatsverschuldung?
Diese Sichtweise geht davon aus, dass Konsumenten heute mehr sparen, wenn der Staat Schulden macht, weil sie künftige Steuererhöhungen zur Tilgung erwarten.
Welche Messprobleme gibt es bei der Staatsverschuldung?
Probleme entstehen durch Inflation, unberücksichtigte Verbindlichkeiten (z.B. Pensionen) und die Auswirkungen des Konjunkturzyklus auf das Defizit.
- Arbeit zitieren
- Andreas Lenz (Autor:in), 2013, Staatliche Stabilisierungspolitik und Staatsverschuldung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262535