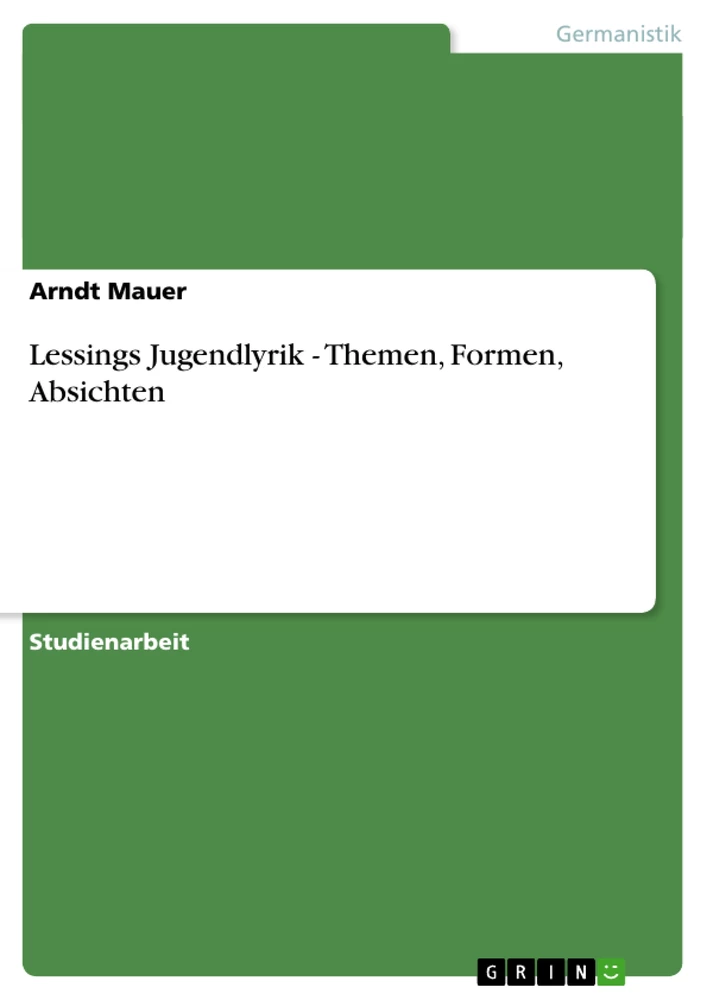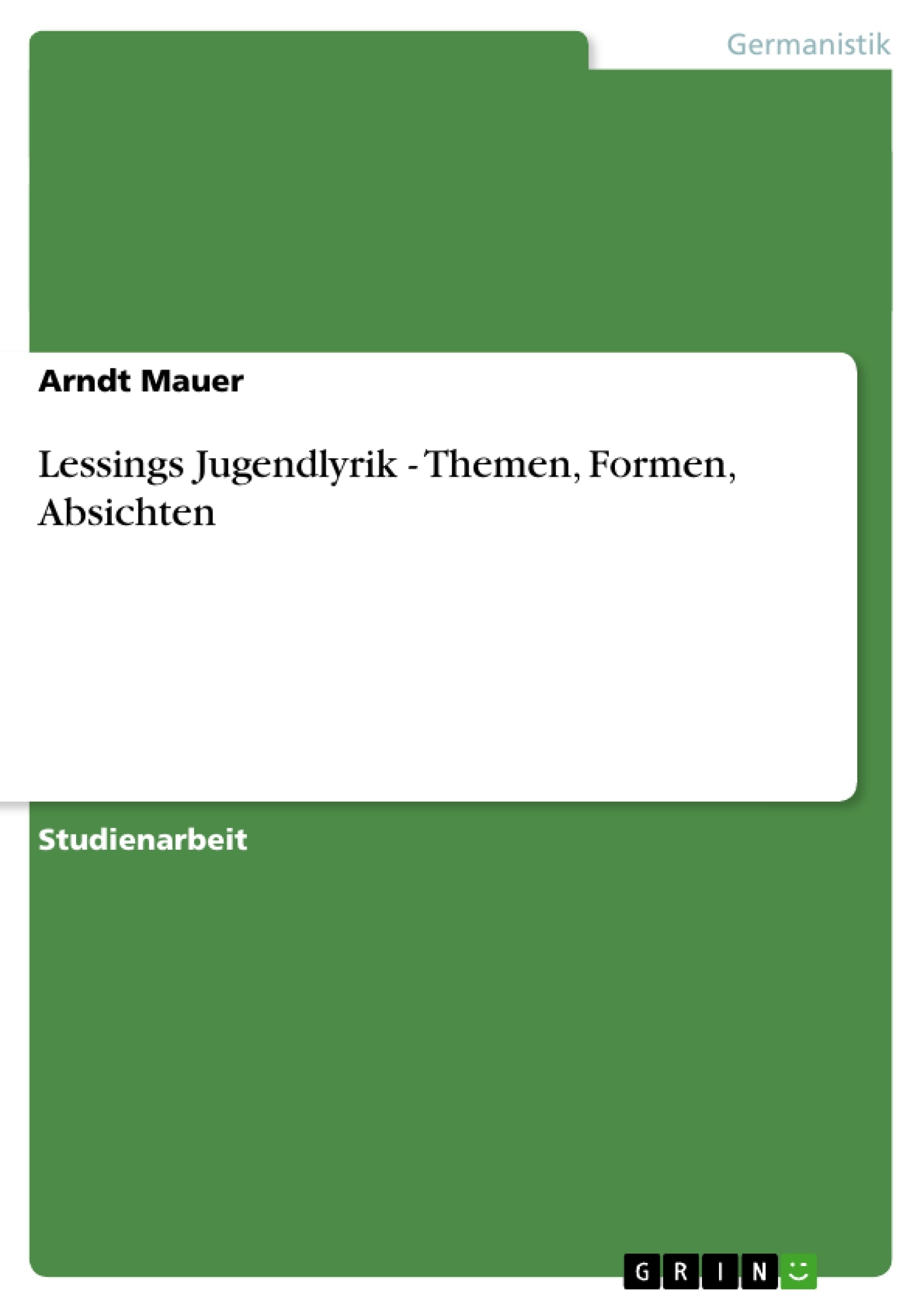Gotthold Ephraim Lessing gilt als einer der größten deutschen Autoren. Bei diesem Urteil spielen fast ausschließlich seine aufklärerischen Dramen, etwa "Nathan der Weise", eine Rolle. Sie werden in Schule und Studium diskutiert und sind Inhalt zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen. Dass Lessing auch Lyriker war, ist hingegen weniger bekannt, geschweige denn dass diese Werke aktuelle Relevanz hätten. Es darf daher die Frage gestellt werden, wie lohnenswert eine ausführlichere Auseinandersetzung mit den poetischen Arbeiten Lessings ist. Doch schon ein etwas genauerer Blick weckt die Neugierde, wenn man etwa entdeckt, dass sein Schaffen mehrere hundert Gedichte umfasst, und man auf die Urteile seiner Zeitgenossen stößt. Dieses Interesse soll mit dieser Arbeit verstärkt werden. Dementsprechend werden die lyrischen Gattungen, in denen Lessing schrieb, dargestellt, zusammen mit den Inhalten und Formen seiner Gedichte. Es soll aber auch versucht werden, die Motive und Absichten, die sich in diesen Werken verbergen, zu rekonstruieren und gegebenenfalls Verbindungen zu der Umwelt, in der Lessing sich bewegte, zu knüpfen. Dann kann letztendlich vielleicht auch deutlich werden, welchen Stellenwert die Lyrik in seinem Gesamtwerk einnimmt, wobei seine eigene Beurteilung, sowie die der Zeitgenossen, einbezogen werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Lessing war ein Lyriker?
- Rahmenbedingungen
- Anakreontische Lieder
- Epigramme
- Oden
- Lehrgedichte
- Schlussworte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das lyrische Schaffen Gotthold Ephraim Lessings, besonders in seiner Jugendzeit. Sie beleuchtet die verschiedenen lyrischen Gattungen, in denen er schrieb, analysiert Inhalte und Formen seiner Gedichte und versucht, die dahinterliegenden Motive und Absichten zu rekonstruieren. Dabei werden Verbindungen zu Lessings Umfeld hergestellt und die Bedeutung seiner Lyrik für sein Gesamtwerk betrachtet.
- Die Entwicklung von Lessings lyrischem Schaffen im Kontext seiner Jugendzeit
- Die Analyse von Lessings Gedichten im Hinblick auf ihre Inhalte, Formen und Gattungen
- Die Rekonstruktion der Motive und Absichten, die Lessings lyrisches Schaffen prägten
- Die Einordnung von Lessings Lyrik in das Gesamtwerk und in seinen Lebenskontext
- Die Bedeutung von Lessings Lyrik in Bezug auf seine eigene Einschätzung und die Rezeption seiner Zeitgenossen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung - Lessing war ein Lyriker?: Diese Einleitung stellt die Frage nach der Bedeutung von Lessings lyrischem Schaffen und der Relevanz einer detaillierteren Auseinandersetzung mit seinen Gedichten. Sie betont die Fülle seines lyrischen Werkes und das Interesse an der Rekonstruktion seiner Motive und Absichten.
- Rahmenbedingungen: Dieser Abschnitt beschreibt Lessings Lebensumstände und -phase in seiner Jugendzeit, in der seine lyrische Produktion entstand. Er beleuchtet seinen Werdegang als Schüler und Student und seine Hinwendung zum Theater und der geselligen Welt, sowie die Bedeutung von Familienbriefen und frühen Veröffentlichungen.
- Anakreontische Lieder: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der anakreontischen Lyrik Lessings. Es definiert den Begriff der Anakreontik und beleuchtet die Rolle des Weines und der Liebe in dieser Gattung, die auf den griechischen Lyriker Anakreon zurückgeht. Der Abschnitt beschreibt den Kontext der anakreontischen Lyrik im Deutschland der 1740er Jahre, ihren Bezug zum Freundschaftskult und ihre Eignung für gesellige Runden. Er stellt Lessing in den Kontext anderer zeitgenössischer Dichter, die sich ebenfalls der anakreontischen Lyrik widmeten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die lyrische Produktion von Gotthold Ephraim Lessing, insbesondere auf seine frühen Werke. Schlüsselbegriffe sind Anakreontik, Freundschaft, Wein und Liebe, sowie die Analyse von Form, Inhalt und Funktion seiner Gedichte. Darüber hinaus wird der Kontext von Lessings Leben und seiner Zeit beleuchtet, um die Bedeutung seiner Lyrik im Gesamtwerk zu verstehen.
- Citar trabajo
- Arndt Mauer (Autor), 2002, Lessings Jugendlyrik - Themen, Formen, Absichten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26255