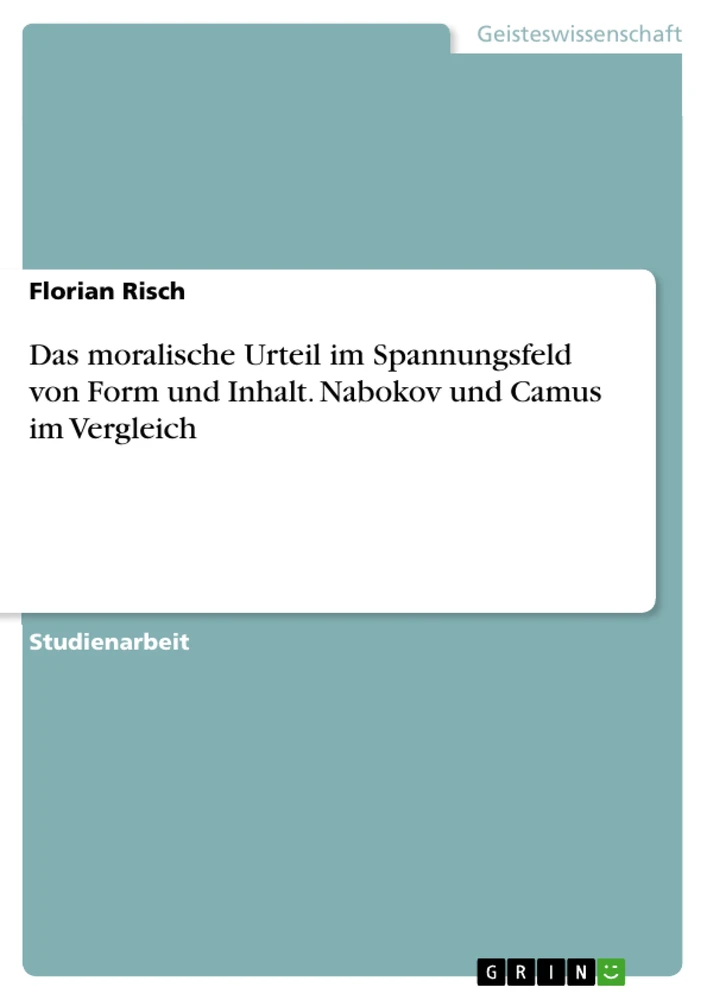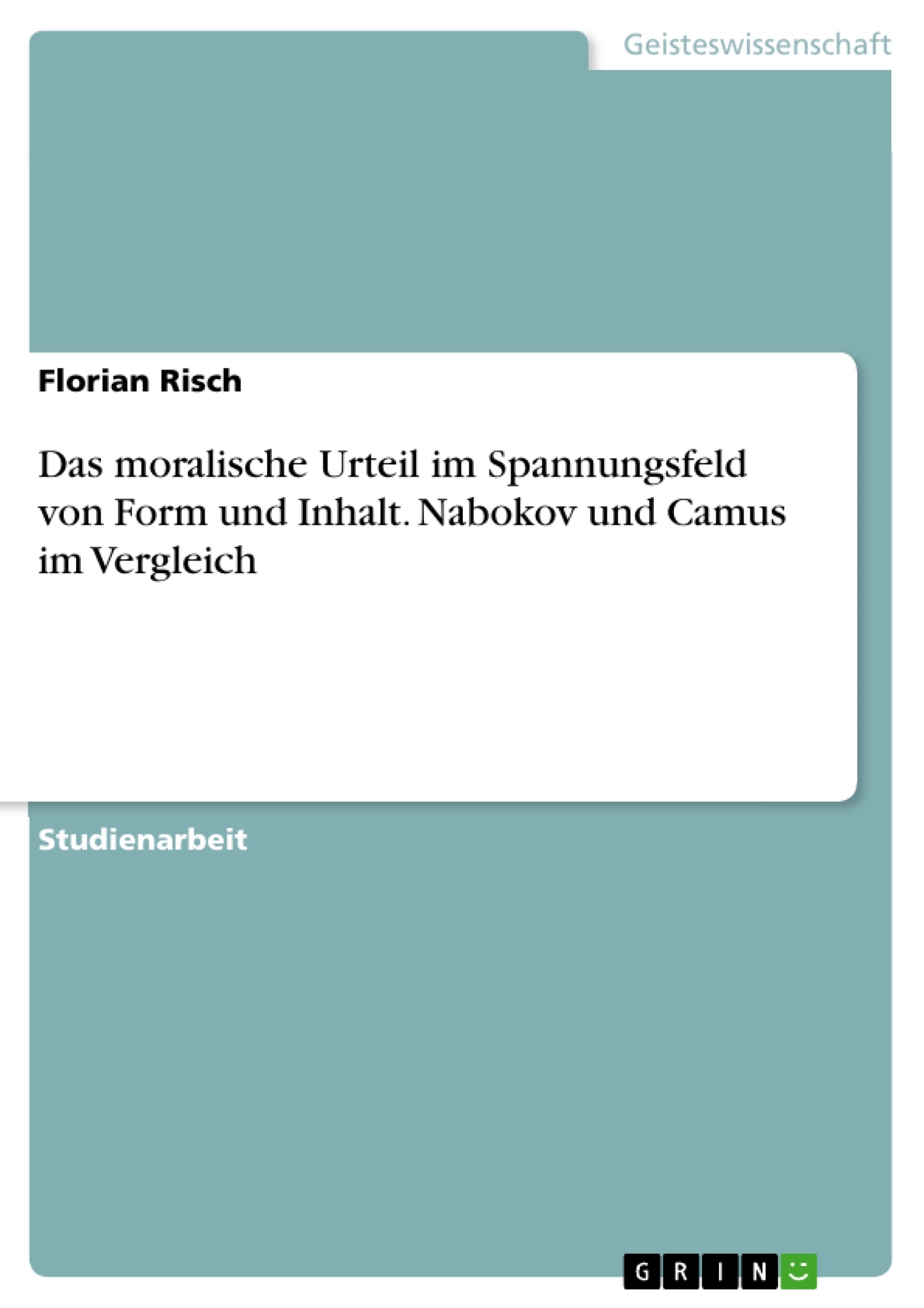Diese Ausarbeitung vergleicht die Romane Lolita von Vladimir Nabokov aus dem Jahre 1955 und Albert Camus‘ Der Fremde von 1942. Ziel soll es sein, die Frage zu beantworten ob und inwieweit die narratologische Form und Ausgestaltung Einfluss auf das persönliche moralische Urteil nehmen kann. Dazu unternehme ich zunächst ein philosophisch-historischen Rückblick auf die Theorie der moralischen Gefühle von Adam Smith und beziehe mich dabei aber auch auf David Hume. Darauf wird ein Absatz folgen, der sich mit dem Roman als moralisches Leitbild beschäftigt und die Bedingungen für das ethisch-hinterfragende Lesen feststellt. Zuletzt soll natürlich erläutert werden, wie die Eingangsfrage überhaupt beantwortet werden kann, bzw. ob dies überhaupt in ihrer Vollständigkeit möglich ist. Ich habe diese beiden Bücher gewählt, weil sie in ihren Leitmotiven Ähnlichkeiten aufweisen aber gleichzeitig so in ihrer Form variieren, dass sie sich für einen solchen Vergleich anbieten.
Inhaltsverzeichnis
- Die Ethik der moralischen Gefühle als Grundlage
- Die Kunstform des Romans und der Perspektivwechsel
- Vergleich der Werke in Bezug auf Form, Inhalt und moralischem Urteil
- Inhalt der Bücher
- Das moralische Urteil
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung vergleicht die Romane Lolita von Vladimir Nabokov und Albert Camus' Der Fremde. Das Ziel der Ausarbeitung ist es, die Frage zu beantworten, ob und inwieweit die narratologische Form und Ausgestaltung Einfluss auf das persönliche moralische Urteil nehmen kann.
- Die Theorie der moralischen Gefühle von Adam Smith und David Hume
- Der Roman als moralisches Leitbild
- Die Bedeutung des Perspektivwechsels in der Literatur
- Der Vergleich der Romane Lolita und Der Fremde in Bezug auf Form und Inhalt
- Die Rolle des moralischen Urteils in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel beleuchtet die Grundlagen der moralischen Gefühle, die für den Vergleich der beiden Romane entscheidend sind. Es behandelt die Theorien von David Hume und Adam Smith zum Thema Nützlichkeit, Wohlwollen und Sympathie.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel untersucht die Kunstform des Romans und ihre Rolle beim Perspektivwechsel. Es thematisiert die ästhetische Einstellung und die Voraussetzungen für ein moralisches Urteil in Bezug auf literarische Werke.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Romane in Bezug auf Form, Inhalt und moralischem Urteil. Es untersucht, wie die narratologische Gestaltung der Werke Einfluss auf das moralische Urteil des Lesers haben kann.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Ausarbeitung sind: Moralische Gefühle, Sympathie, Perspektivwechsel, Roman, Literatur, Moralisches Urteil, Lolita, Der Fremde, Nabokov, Camus.
Häufig gestellte Fragen zu Nabokov und Camus
Wie beeinflusst die Erzählform das moralische Urteil?
Durch die Wahl des Ich-Erzählers oder spezifische Perspektivwechsel können Autoren den Leser dazu bringen, Sympathie für moralisch fragwürdige Figuren (wie Humbert Humbert in 'Lolita') zu empfinden.
Was besagt Adam Smiths Theorie der moralischen Gefühle?
Smith argumentiert, dass Moral auf Sympathie und dem Vermögen beruht, sich in die Lage anderer hineinzuversetzen. Dies bildet die Grundlage für das ethische Lesen von Romanen.
Worum geht es in Camus' 'Der Fremde'?
Der Roman beschreibt die emotionale Distanz und Gleichgültigkeit des Protagonisten Meursault gegenüber der Welt und seinen eigenen Taten, was die Frage nach dem Absurden aufwirft.
Welche Rolle spielt die 'Ästhetik' beim moralischen Lesen?
Die ästhetische Gestaltung eines Werkes kann das moralische Urteil suspendieren oder herausfordern, indem sie den Fokus von der Tat auf die Wahrnehmung und Sprache verlagert.
Warum wurden 'Lolita' und 'Der Fremde' für diesen Vergleich gewählt?
Beide Werke arbeiten mit unzuverlässigen oder distanzierten Erzählern und zwingen den Leser, seine eigenen moralischen Maßstäbe während der Lektüre ständig zu hinterfragen.
- Arbeit zitieren
- Florian Risch (Autor:in), 2011, Das moralische Urteil im Spannungsfeld von Form und Inhalt. Nabokov und Camus im Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262555