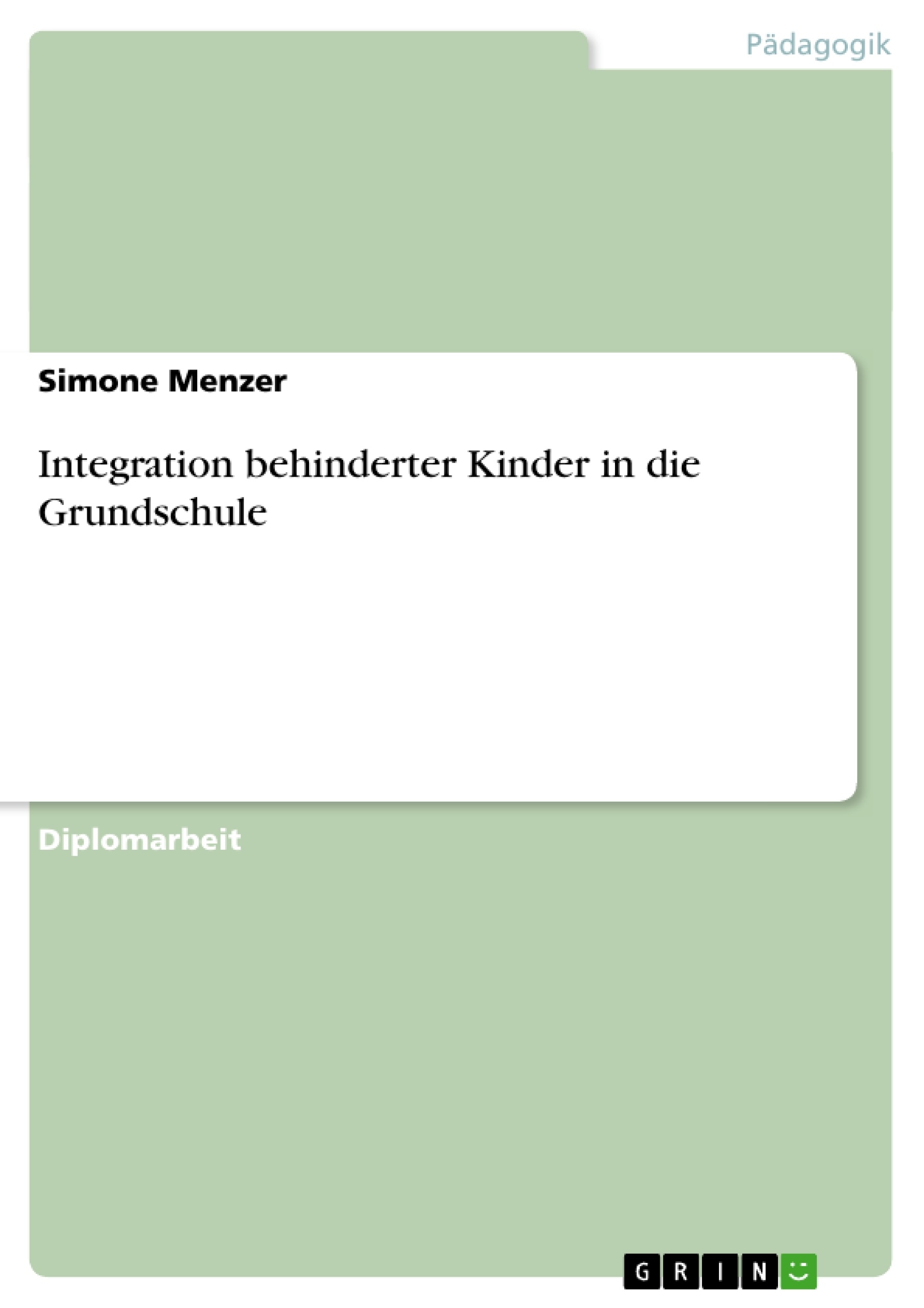Seit über dreißig Jahren wird die in Deutschland größtenteils noch vorherrschende Sonderbeschulung durch die Integrationsbewegung in Frage gestellt. Eberwein formulierte (schon) 1990 die Aufforderung an die Sonderpädagogik, die eigens initialisierte Isolation aufzugeben und sich „aufgrund des Erkenntnisstandes der Verpflichtung zu stellen, eine historische Fehlentscheidung- und Entwicklung zu korrigieren, die darin bestand, eine sonderpädagogische Anthropologie begründet zu haben.“ (Eberwein 1990, S. 344 f.).
Auch Preuss-Lausitz schreibt, dass das System der separaten sonderpädagogischen Förderung als „ein nach 1945 irritierend lang festgehaltener „deutscher Sonderweg“ angesehen werden (..) [kann]“ (Preuss-Lausitz 1999, S.45). Sonderpädagogik gilt laut Preuss-Lausitz in Europa und weit darüber hinaus heute als sozial unerwünscht, überholt, ineffektiv und zu teuer gemessen an der Wirkung (Preuss-Lausitz 1999, S. 45).
Das deutsche Schulsystem hat viele Entwicklungen hinter sich. Von der Schule nur für reiche und nichtbehinderte Kinder über die Schule, die in unterschiedliche Gesellschaftsschichten geteilt wurde über die jahrgangsübergreifenden Schulen, die vor allem in ländlichen Gegenden lang verbreitet waren, bis zu der heute noch verbreiteten Unterrichtsform, bei der möglichst leistungs- und altershomogene Klassen gebildet werden, damit eine (fragliche) maximale Förderung vollzogen werden kann.
Alle Menschen sind verschieden – also sind auch alle SchülerInnen verschieden. Daher fordern seit den siebziger Jahren die Eltern von behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie viele PädagogInnen eine Schule für alle Kinder: integrativer Unterricht an Regelschulen statt separierenden Spezialschulen.
In Deutschland herrscht gegenwärtig das viergliedrige Schulsystem vor: Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Sonderschule, wobei es vermehrt Schulversuche gibt, behinderte und nichtbehinderte Kinder in der (Grund-)schule gemeinsam zu unterrichten, die jedoch in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ausgeprägt sind.
In der vorliegenden Diplomarbeit geht es um die Frage, ob und unter welchen Umständen die integrative Beschulung von Kindern in der Grundschule der Sonderbeschulung vorzuziehen ist. Dabei wird kurz auf den geschichtlichen Hintergrund der Sonderpädagogik eingegangen, anschließend werden die Rahmenbedingungen untersucht und abschließend werden die Erfahrungen der direkt Beteiligten (Eltern, Lehrer und Kinder) untersucht und vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Untersuchungsdesign
- Geschichtliche und ideengeschichtliche Entwicklung der Hilfspädagogik
- Von der Aussonderung behinderter Kinder zu den ersten Erziehungs- und Bildungsversuchen
- Von den Erziehungsversuchen zu den ersten Hilfsschulen
- Sonderpädagogik in der nationalsozialistischen Zeit
- Die Entwicklung der Sonderpädagogik nach dem 2. Weltkrieg 1945
- Die Integrationsbewegung
- Zusammenfassung und Diskussion der geschichtlichen und ideengeschichtlichen Entwicklung der Hilfspädagogik
- Integration in der Praxis - die Rahmenbedingungen schulischer Integration
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Strukturelle und konzeptionelle Anforderungen
- Innere Differenzierung
- Projektarbeit
- Wochen- und Tagesplanarbeit
- Freie Arbeit
- Räumliche Anforderungen
- Exkurs: Kostenvergleich: Integration versus Sonderbeschulung
- Personelle Anforderungen
- Ansprüche an die Regellehrerinnen
- Anforderungen an die Sonderpädagoginnen
- Diskussion personeller Anforderungen
- Die Beteiligten der integrativen Beschulung
- Die Eltern in der Integration
- Gründe für Integrationsklassen
- Gründe gegen eine integrative Beschulung
- Einschätzung der Wirkung einer gemeinsamen Beschulung auf ihre Kinder
- Erfahrung
- Zusammenfassung und Diskussion der Elternmeinung und
- Lehrerinnen und Lehrer in Integrationsklassen
- Motivation der Lehrer für einen Einstieg in den integrativen Unterricht
- Bewertung des integrativen Unterrichtes aus der Sicht der Grundschul- und SonderschullehrerInnen
- Hamburger Untersuchung von Hinz und Wocken 1994/95
- Untersuchung von Heyer, Preuss-Lausitz und Schöler 1995 in Brandenburg
- Untersuchung von Dumke/Krieger/Schäfer 1985/86 in Bonn
- Untersuchung von Deppe-Wolfinger/Prengel/Reiser 1985/86 in der BRD
- Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- Kinder in der Integration
- Integration aus der Sicht der Kinder
- Untersuchung von Heyer, Preuss-Lausitz und Schöler 1996 in Brandenburg
- Befragung von Dumke und Schäfer im Schuljahr 1985/86 in Bonn
- Forschungsergebnisse zum gemeinsamen Unterricht
- Soziale Integration der behinderten Kinder in die Grundschulklasse
- Schulleistungen der behinderten und nichtbehinderten SchülerInnen in integrativen und nichtintegrativen Klassen
- SchülerInnenverhalten in Integrationsklassen
- Diskussion der Ergebnisse
- Die historische Entwicklung der Hilfspädagogik und die Entstehung der Integrationsbewegung
- Die notwendigen Rahmenbedingungen für eine gelungene Integration von Kindern mit Behinderungen in der Grundschule
- Die Perspektiven und Erfahrungen der verschiedenen Akteure (Eltern, LehrerInnen, Kinder)
- Die Auswirkungen der Integration auf das soziale Miteinander und die Schulleistung der Kinder
- Die Bewertung der Ergebnisse und die Herausforderungen für eine zukunftsfähige inklusive Bildung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Integration von Kindern mit Behinderungen in der Grundschule gelingen kann. Sie analysiert die geschichtliche Entwicklung der Hilfspädagogik, die rechtlichen und strukturellen Rahmenbedingungen für integrative Beschulung sowie die Meinungen und Erfahrungen von Eltern, Lehrkräften und Kindern mit und ohne Behinderungen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar und erläutert das Untersuchungsdesign. Kapitel 2 behandelt die historische Entwicklung der Hilfspädagogik von der Aussonderung behinderter Kinder bis zur Integrationsbewegung. Kapitel 3 analysiert die Rahmenbedingungen schulischer Integration, inklusive rechtlicher, struktureller, räumlicher und personeller Anforderungen. Kapitel 4 befasst sich mit den Perspektiven der Beteiligten an der integrativen Beschulung: Eltern, LehrerInnen und Kinder. Die Ergebnisse der Forschung zum gemeinsamen Unterricht und die Meinungen der verschiedenen Akteure werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Begriffe der Hilfspädagogik, Integration, Inklusion, Sonderpädagogik, inklusive Bildung, Schulsystem, Eltern, LehrerInnen, Kinder, gemeinsame Beschulung, soziale Integration, Schulleistung, SchülerInnenverhalten.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Sonderbeschulung?
Integration bedeutet das gemeinsame Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern in Regelschulen, während Sonderbeschulung die Trennung in Spezialschulen vorsieht.
Welche strukturellen Anforderungen gibt es für Integrationsklassen?
Erforderlich sind innere Differenzierung, Projektarbeit, Wochenplanarbeit sowie freie Arbeitsformen, um den unterschiedlichen Leistungsniveaus gerecht zu werden.
Wie bewerten Eltern die integrative Beschulung?
Die Arbeit untersucht Gründe dafür und dagegen, wobei die soziale Integration und die Wirkung auf die kindliche Entwicklung zentrale Entscheidungskriterien sind.
Gibt es Leistungsunterschiede in Integrationsklassen?
Die Diplomarbeit analysiert Forschungsergebnisse zur Schulleistung sowohl von behinderten als auch von nichtbehinderten Kindern in gemeinsamen Klassen.
Ist Integration teurer als Sonderschulen?
Die Arbeit enthält einen Exkurs zum Kostenvergleich zwischen Integration und separater Sonderbeschulung.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Simone Menzer (Autor:in), 2004, Integration behinderter Kinder in die Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26257