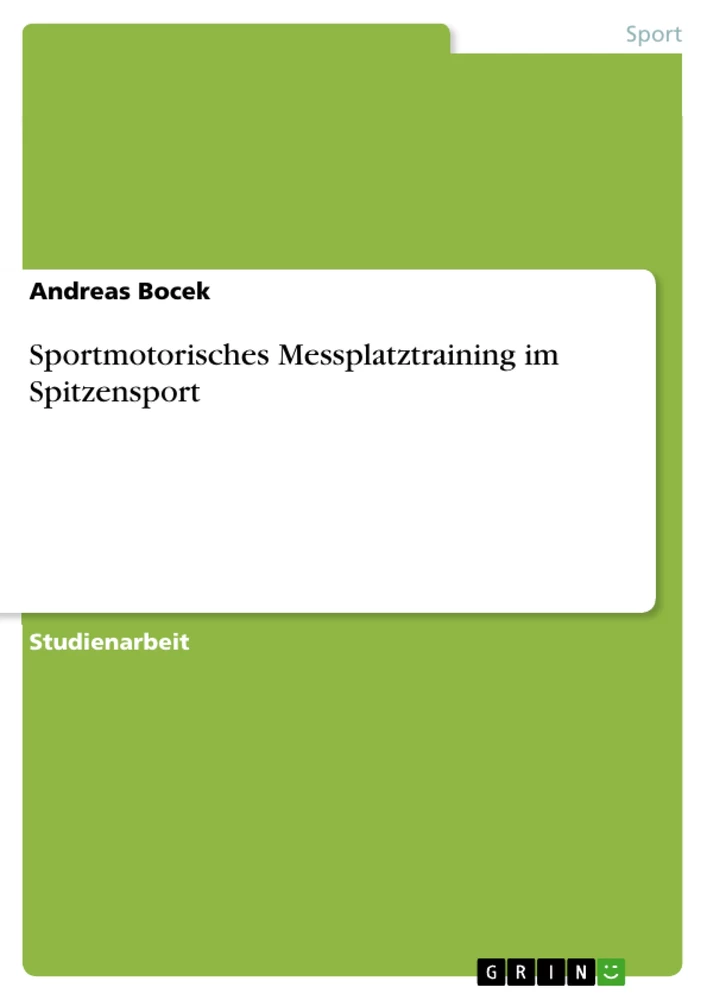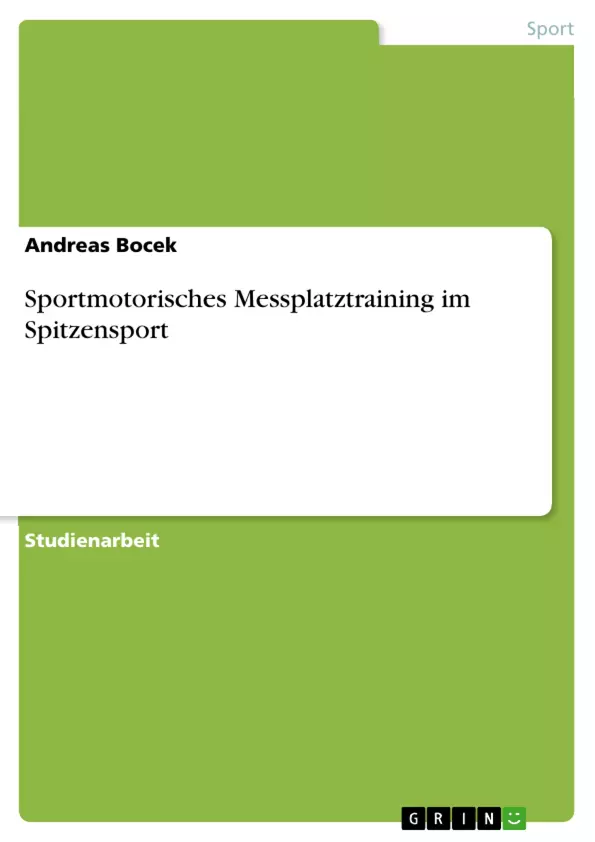Der vorliegende Bericht orientiert sich in erster Linie an der Veröffentlichung des Werkes „Evaluation sportmotorischen Messplatztrainings im Spitzensport“ von Professor Reinhard Daugs aus dem Jahr 2000. Aufgrund der Vielfältigkeit der Problematik dieses Themengebietes war hierbei eine explizite Konzentration auf das Techniktraining vorgegeben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der o. g. Publikation gab es gerade im Leistungsfaktor Technik (und der damit verbundenen Einheit von Kraft- und Bewegungsstruktur) noch erheblich mehr Ressourcen zur Steigerung der sportlichen Leistung im Spitzensport als in den wohl weitgehend ausgeschöpften, rein konditionell- energetischen Leistungsfaktoren. Folgende Aussage von Heilfort hat sich dementsprechend in den vorrangegangenen Jahren mehr als bestätigt:
„Zukünftige Weltspitzenleistungen werden also nur auf der Grundlage einer immer besseren Beherrschung der Komplexität aller erforderlichen Leistungsfaktoren, verbunden mit einer Erhöhung der Wertigkeit des Faktors Sporttechnik erreichbar sein, da die Sporttechnik entscheidend den Nutzungsgrad des verfügbaren konditionell- energetischen Potentials beeinflusst.“ (Heilfort, 1986, S. 5)
Begründet wurde diese Aussage damit, dass immer mehr und immer schwierigere sportart- und disziplinspezifische Elemente, wie zum Beispiel im Kunstturnen, im Eiskunstlauf, im Wasserspringen oder in der Rhythmischen Sportgymnastik den Athleten permanent zu immer schwierigeren sportmotorischen Neulern- und Optimierungsprozessen zwingen. Dies setzt demzufolge höchste Lernfähigkeit bei den Athleten und höchste Lehrfähigkeit bei den Trainern voraus.
Zusätzlich zeichnete sich in den letzten Jahren durch eine rasante Entwicklung und die häufig plötzlich eintretende Veränderung von Sportgeräten (z. B. Carving- Ski im alpinen Skilauf, Big Blades im Rudern, Schwerpunktveränderung der Speere, „Spoiler“- Rennanzüge im Eisschnelllauf, Glasfaserstäbe im Hochsprung) und sportlichen Techniken (z.B. Mehrfachrotationen im Eiskunstlauf, Kunstturnen und Wasserspringen, Undulationstechnik im Schwimmen) eine weitere Zunahme der Bedeutung sportmotorischer Lernprozesse ab, die den Athleten zu schwierigen und oft sehr kurzfristigen Umlernprozessen zwingen.
Es ist also nicht verwunderlich, dass man dabei an Grenzen der Lern- und Lehrfähigkeit stößt. Daher suchen vor allem betroffene Trainer verstärkt nach wissenschaftlich- technologischer Unterstützung bei der Lösung dieser Problematik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Strategien und Trainingsformen im sportmotorischen Messplatztraining
- Wissenschaftlich- technologische Ansätze und abgeleitete Handlungsempfehlungen
- Zentrale Ansätze zum sportmotorischen Messplatztraining
- Der klassische Ansatz zur Schnellinformation von Farfel
- Der Ansatz zur Technikansteuerung von Ballreich
- Der Ansatz zum Messplatztraining am IAT von Stark, Heilfort und Krug
- Der Ansatz zum sportmotorischen Lernen und Techniktraining von Daugs
- Handlungsempfehlungen zur wirksamen Gestaltung sportmotorischen Messplatztrainings
- Handlungsempfehlungen zum sportmotorischen Videotraining
- Handlungsempfehlungen zur Schnellinformation
- Einschätzung des Messplatztrainings- Systems im Allgemeinen
- Gegenwärtige Forschungsdefizite
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende schriftliche Ausarbeitung befasst sich mit dem sportmotorischen Messplatztraining im Spitzensport, insbesondere im Hinblick auf die Optimierung von sportlichen Techniken. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse und Evaluation verschiedener wissenschaftlich-technologischer Ansätze und Handlungsempfehlungen für die Gestaltung eines effektiven Messplatztrainings. Die Arbeit basiert auf der Publikation "Evaluation sportmotorischen Messplatztrainings im Spitzensport" von Professor Reinhard Daugs aus dem Jahr 2000.
- Analyse und Bewertung verschiedener wissenschaftlich-technologischer Ansätze zum sportmotorischen Messplatztraining
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die Gestaltung eines effektiven Messplatztrainings
- Bewertung des Messplatztrainings-Systems im Allgemeinen
- Identifizierung aktueller Forschungsdefizite im Bereich des sportmotorischen Messplatztrainings
- Zusammenfassung und Schlussfolgerungen zum Einsatz des Messplatztrainings im Spitzensport
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext des sportmotorischen Messplatztrainings im Spitzensport dar und beleuchtet die zunehmende Bedeutung des Leistungsfaktors Sporttechnik in modernen Sportarten. Sie führt die Arbeit von Professor Reinhard Daugs ein, die als Grundlage für die vorliegende Ausarbeitung dient.
Kapitel 2 beschreibt die verschiedenen Strategien und Trainingsformen, die im sportmotorischen Messplatztraining zum Einsatz kommen. Dabei werden die wichtigsten Einflussgrößen auf das sportmotorische Lernen und Techniktraining im Allgemeinen sowie auf das Messplatztraining im Speziellen erläutert.
Kapitel 3 präsentiert die zentralen wissenschaftlich-technologischen Ansätze zum sportmotorischen Messplatztraining. Es werden die Ansätze von Farfel, Ballreich, Stark, Heilfort und Daugs vorgestellt und detailliert analysiert. Die einzelnen Ansätze werden hinsichtlich ihrer theoretischen Grundlagen, empirischen Befunde und Handlungsempfehlungen beleuchtet.
Kapitel 4 bietet eine umfassende Einschätzung des Messplatztrainings-Systems im Allgemeinen. Es werden die Vor- und Nachteile des Systems sowie die Bedeutung einer wissenschaftlich-technologischen Fundierung des Messplatztrainings für die Praxis des Nachwuchs- und Spitzensport beleuchtet.
Kapitel 5 identifiziert und analysiert aktuelle Forschungsdefizite im Bereich des sportmotorischen Messplatztrainings. Es werden sowohl theoretische als auch empirische Forschungslücken aufgezeigt und Vorschläge für eine Verbesserung der Situation gemacht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das sportmotorische Messplatztraining, die Optimierung von Sporttechniken, die wissenschaftlich-technologische Fundierung von Trainingsverfahren, die Biomechanik, die Leistungsdiagnostik, das Lernen durch Instruktion, das Lernen durch Ergebnisrückmeldung, das Lernen durch Imagination, das Lernen durch Übung, das Videotraining, die Schnellinformation, die aktuelle Forschungslandschaft und die Herausforderungen des Messplatztrainings im Spitzensport.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein sportmotorisches Messplatztraining?
Es ist eine technikorientierte Trainingsform, bei der wissenschaftlich-technologische Messgeräte eingesetzt werden, um Bewegungsabläufe im Spitzensport in Echtzeit zu analysieren und zu optimieren.
Warum gewinnt die Sporttechnik an Bedeutung?
Da konditionelle Faktoren oft ausgereizt sind, bietet die Optimierung der Technik (z. B. durch Biomechanik) die größten Reserven für neue Weltspitzenleistungen.
Was versteht man unter "Schnellinformation"?
Schnellinformation ist die unmittelbare Rückmeldung an den Athleten nach einer Bewegungsausführung, um Lernprozesse durch direktes Feedback zu beschleunigen.
Welche Rolle spielt Videotraining?
Videotraining ermöglicht die visuelle Analyse von Fehlern und den Vergleich mit Idealkonzeptionen der Bewegung, was für das Techniktraining essenziell ist.
Wer war Reinhard Daugs?
Professor Reinhard Daugs war ein renommierter Sportwissenschaftler, dessen Arbeiten zum Messplatztraining und zum motorischen Lernen die Grundlage für moderne Trainingssysteme bildeten.
- Quote paper
- Diplom Sportwissenschafter Andreas Bocek (Author), 2011, Sportmotorisches Messplatztraining im Spitzensport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262602