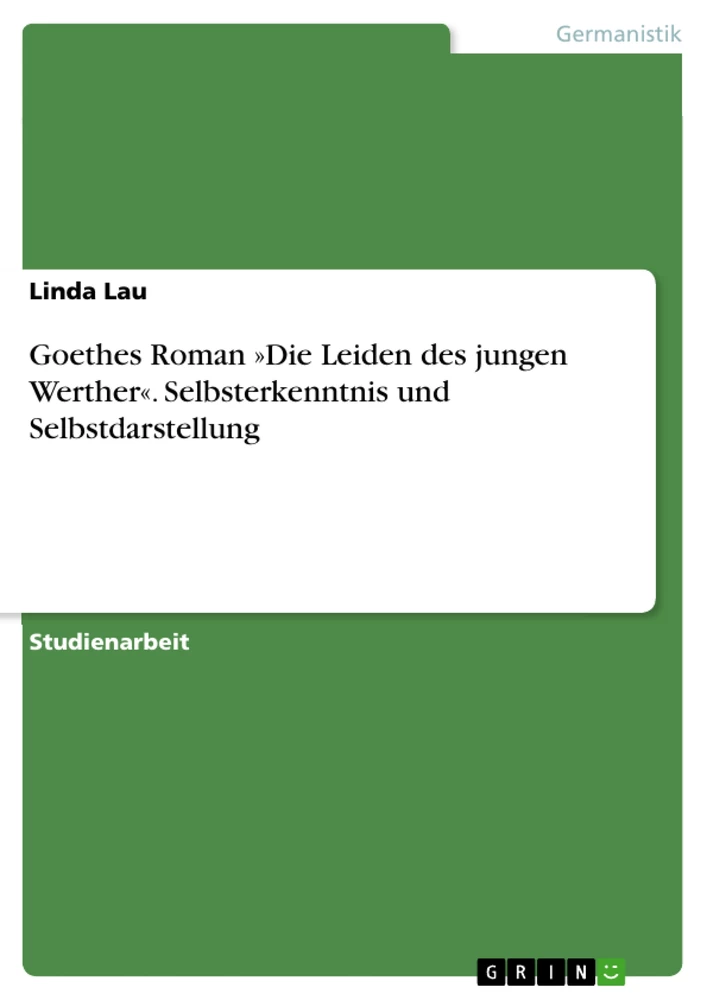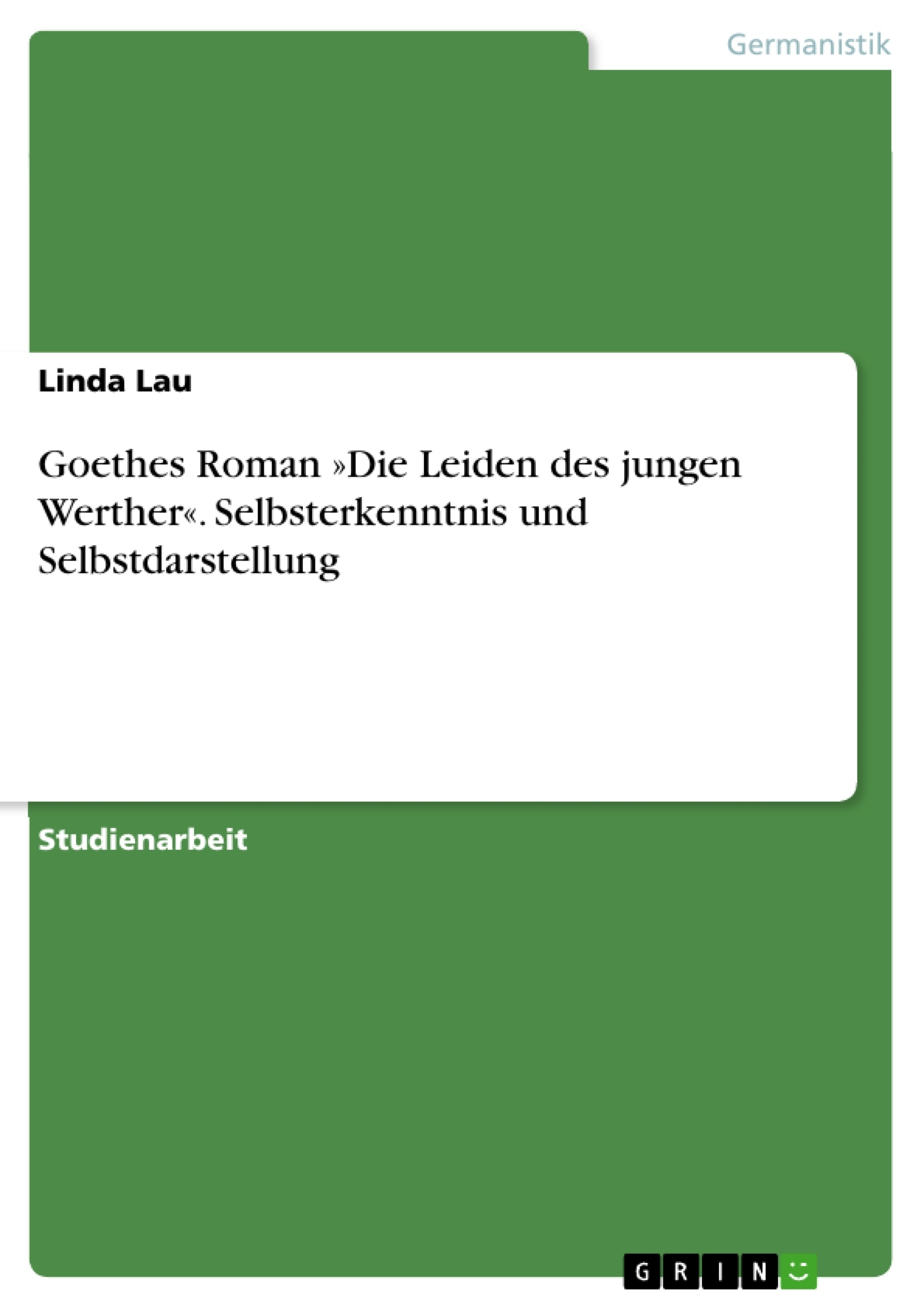Goethes Roman »Die Leiden des jungen Werther« ist ein Zeugnis zweier literarischer Epochen, die neben der Aufklärung bis ins späte 18. Jahrhundert andauern: der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang. Das zentrale Kennzeichen beider Epochen ist die stark ausgeprägte Gefühlsbetontheit. Im Werther-Roman geht es dementsprechend um die Selbstaussprache der leidenden Hauptperson. Werther versucht seine intensiven Gefühle anhand von Briefen und Tagebucheinträgen auszudrücken: „In seinen leidenschaftlichen Übersteigerungen und seiner subjektiven Weltsicht charakterisiert er mit den Gegenständen seiner Erzählung immer auch den Erzähler, sich selbst. [...] Werther macht aus seiner subjektiven Sicht sein Leben und seine Liebe objektiv erfahrbar.“1
Im Rahmen dieser Hausarbeit soll die Frage erörtert werden, inwiefern im Roman von einer Selbsterkenntnis und einer Selbstdarstellung der Hauptperson gesprochen werden kann und auf welche Weise dies sprachlich umgesetzt wird. Es soll dabei insbesondere untersucht werden, inwieweit Werther sich seinem eigenen inneren Zustand bewusst ist und inwieweit er reflektiert, was zu seinem Entschluss, Selbstmord zu begehen, geführt hat.
Vor einer ausführlichen Analyse des Themas in Bezug auf den Roman selbst gehe ich zunächst auf den biografischen und literaturgeschichtlichen Hintergrund des Werks ein, der unverkennbar in Goethes Schreibprozess mit eingeflossen ist. Auf diese kurze Skizzierung der zeitgeschichtlichen Umstände folgt der Hauptteil der Arbeit. Ich beginne mit der Darstellung des Briefromans als ein unmittelbares Medium der Ich-Aussprache. Weiterhin soll die Naturdarstellung im Roman als Spiegel von Werthers Empfindungen beschrieben werden. Darauf folgt – anhand ausgewählter Romanfiguren - eine Analyse des gesellschaftlichen Konflikts, indem Werther sich befindet. Zum Schluss gehe ich näher auf die sogenannte »Krankheit zum Tode« ein. Dabei steht zum einen Werthers seelische Entwicklung und zum anderen der Herausgeberbericht über seine letzten Tage im Vordergrund.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Biografischer und literaturgeschichtlicher Hintergrund
3. Selbsterkenntnis und Selbstdarstellung in Goethes »Die Leiden des jungen Werther«
3.1. Der Briefroman als Medium der Ich-Aussprache
3.2. Die Natur als Spiegel von Empfindungen
3.3. Der Konflikt mit der Gesellschaft
3.3.1. Lotte
3.3.2. Albert
3.3.3. Andere Personen
3.4. Die Krankheit zum Tode
3.4.1. Vorausdeutungen
3.4.2. Herausgeberbericht
4. Fazit
5. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Welchen Epochen lässt sich Goethes "Werther" zuordnen?
Der Roman ist ein zentrales Werk der Empfindsamkeit und des Sturm und Drang, geprägt durch eine starke Gefühlsbetontheit und Subjektivität.
Warum ist die Briefform für den Roman so wichtig?
Der Briefroman dient als unmittelbares Medium der Ich-Aussprache. Er ermöglicht es Werther, seine innersten Gefühle und leidenschaftlichen Übersteigerungen direkt auszudrücken.
Welche Rolle spielt die Natur für Werther?
Die Natur fungiert als Spiegel von Werthers Empfindungen: In glücklichen Zeiten erscheint sie ihm paradiesisch, in Phasen der Verzweiflung als zerstörerische Kraft.
Worin besteht Werthers Konflikt mit der Gesellschaft?
Werther leidet an den starren bürgerlichen Konventionen und Standesschranken, die seine emotionale Entfaltung und seine Liebe zu Lotte einschränken.
Was versteht man unter der „Krankheit zum Tode“ im Roman?
Dies beschreibt Werthers psychische Entwicklung und seinen zunehmenden Realitätsverlust, der schließlich in den Entschluss zum Suizid mündet.
Welche Funktion hat der Herausgeberbericht am Ende?
Der Herausgeberbericht liefert eine scheinbar objektive Perspektive auf Werthers letzte Tage und ergänzt die subjektiven Briefe durch äußere Fakten und Zeugenaussagen.
- Citar trabajo
- Linda Lau (Autor), 2013, Goethes Roman »Die Leiden des jungen Werther«. Selbsterkenntnis und Selbstdarstellung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262630