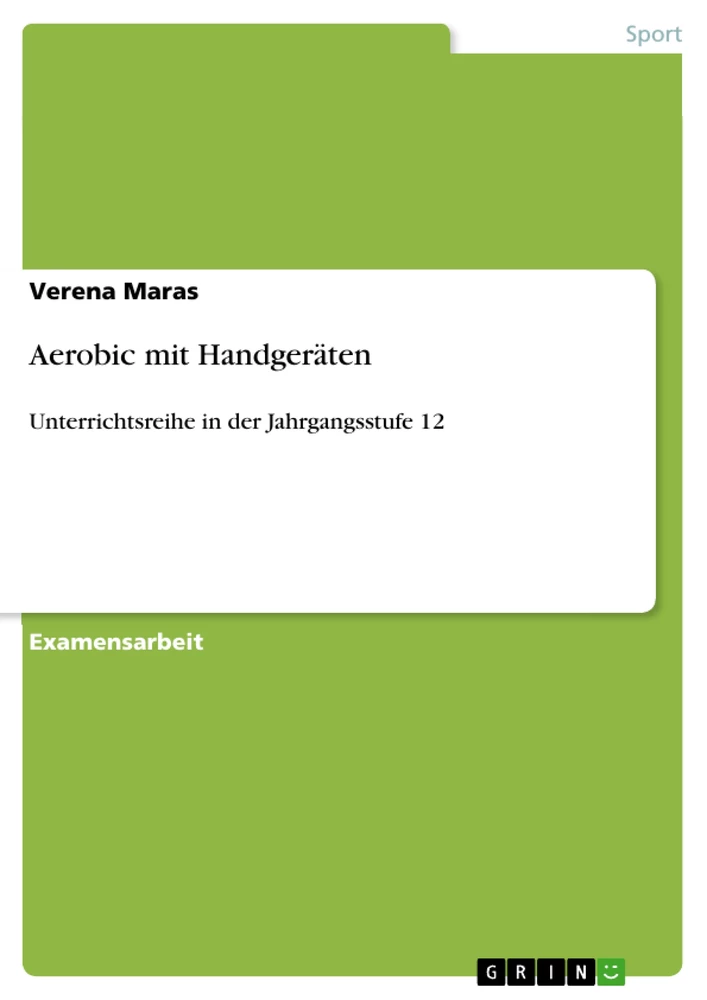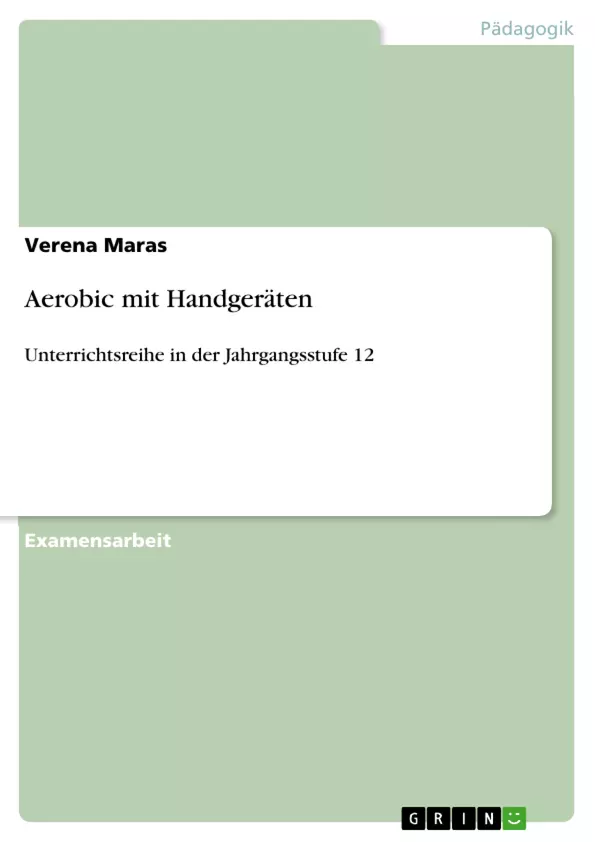Aerobic ist heute durch ganz unterschiedliche Ausprägungsformen gekennzeichnet, die sich aber im Wesentlichen nur durch unterschiedliche Geräte, Trainingsschwerpunkte, Figurtrends und Einflüsse aus anderen Sportarten und Musikrichtungen unterscheiden. Die besondere Rolle von Aerobic in der Fitnesswelt ist unumstritten. Aber auch im Schulsport stellt Aerobic eine enorme Bereicherung dar, weil Jugendliche durch die Musik, ein positives Gruppenerlebnis und Freude an der eigenen Bewegung animiert und motiviert werden können. Mit der vorliegenden Arbeit möchte ich zeigen, dass es sowohl möglich als auch sinnvoll ist den anhaltenden Trend Aerobic in den Sportunterricht der Schulen zu holen und mit bekannten Handgeräten der rhythmischen Sportgymnastik zu verbinden. Durch die Verknüpfung von rhythmisch-tänzerischer Gymnastik (mit Handgeräten) mit der funktionellen Aerobic sollen die Schülerinnen animiert werden ihre Bewegungen in Einklang mit dem Handgerät und der Musik zu bringen. Darin sehe ich eine Chance, die aus der Mode geratenen klassischen Handgeräte für die Schülerinnen wieder attraktiv zu machen und auch gleichzeitig den kreativen Gestaltungsaspekt sowie die gesundheitsförderliche Fitnesskomponente mit einzubeziehen. Über die Fitness- und Gesundheitsperspektive lässt sich für die Heranwachsenden eine Sinngebung erfahren, die eine intrinsische Motivation bewirken und sie zu lebenslangem Sport treiben animieren kann. Des Weiteren bietet die Einheit Aerobic mit Handgeräten die Möglichkeit die Kooperationsfähigkeit sowie die Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen der Schülerinnen zu fördern.
Zusammenfassend lassen sich die zentralen Fragestellungen der Arbeit folgendermaßen formulieren: Wie schafft man erfahrungsoffene Lehr-Lernsituationen mit dem Ziel die Selbstständigkeit, die Kooperation und das Selbstvertrauen der Schülerinnen zu fördern? Und wie wird man dem hohen Maß an Selbstständigkeit und Sozialkompetenz der Lerngruppe bei gleichzeitiger Heterogenität der Leistungsvoraussetzungen gerecht? Wie lässt sich eine sinnvolle und effektive Verzahnung von Theorie und Praxis erreichen, die über die Vermittlung spezifischer Kenntnisse die Schülerinnen zur Handlungskompetenz befähigt und zugleich den Aspekt der Bewegungsaktivität berücksichtigt?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Darstellung der Unterrichtssituation
- 2.1 Rahmenbedingungen
- 2.2 Analyse der pädagogischen Situation
- 3 Didaktisch – methodische Überlegungen zur Unterrichtsreihe
- 3.1 Begründung der Themenauswahl
- 3.2 Aerobic – ein anhaltender Trend
- 3.3 Überlegungen zur Koordination und zu den Handgeräten
- 3.3.1 Der Aspekt der Koordination
- 3.3.2 Die Handgeräte
- 3.3.2.1 Gymnastikball
- 3.3.2.2 Stab
- 3.4 Bedeutung und Einsatz von Musik
- 3.5 Modell / Raster: Didaktisch-methodische Konzeption zur Planung und Durchführung der Reihe
- 3.5.1 Relevantes zum Lehrplan
- 3.5.2 Zentrale Perspektiven der Reihe
- 3.5.2.1 Fitness und Gesundheit
- 3.5.2.2 Bewegungsgestaltung
- 3.5.2.3 Körpererfahrung und -wahrnehmung
- 3.5.2.4 Kooperation
- 3.5.3 Verknüpfung von Theorie und Praxis
- 3.5.4 Die Rolle der Lehrerin im Rahmen von erfahrungsoffenen und handlungsorientierten Lehr-Lernprozessen
- 3.6 Leistungsbewertung und Lernerfolgskontrolle
- 4 Dokumentation der Unterrichtsreihe
- 4.1 Tabellarische Übersicht über den Verlauf der Reihe
- 4.2 Erläuterungen zum Aufbau und zur Dokumentation der Reihe
- 4.3 Dokumentation der zweiten Doppelstunde
- 4.3.1 Didaktisch-methodische Überlegungen zur Stunde
- 4.3.2 Tatsächlicher Verlauf der Stunde
- 4.3.3 Reflexion
- 4.4 Dokumentation der fünften Doppelstunde
- 4.4.1 Didaktisch-methodische Überlegungen zur Stunde
- 4.4.2 Tatsächlicher Verlauf der Stunde
- 4.4.3 Reflexion
- 4.5 Dokumentation der sechsten Doppelstunde
- 4.5.1 Didaktisch-methodische Überlegungen zur Stunde
- 4.5.2 Tatsächlicher Verlauf der Stunde
- 4.5.3 Reflexion
- 5 Gesamtreflexion und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit dokumentiert die Durchführung einer Unterrichtsreihe zum Thema Aerobic mit Handgeräten in der Jahrgangsstufe 12. Ziel ist es, den anhaltenden Trend Aerobic in den Schulsport zu integrieren und klassische Handgeräte der rhythmischen Sportgymnastik neu zu beleben. Es soll ein erfahrungsoffener Unterricht gestaltet werden, der die Selbstständigkeit, Kooperation und das Selbstvertrauen der Schülerinnen fördert. Die Verzahnung von Theorie und Praxis spielt eine zentrale Rolle.
- Integration von Aerobic in den Schulsport
- Neubelebung klassischer Handgeräte
- Erfahrungsorientierter und schülerzentrierter Unterricht
- Verknüpfung von Theorie und Praxis
- Förderung von Selbstständigkeit, Kooperation und Selbstvertrauen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Arbeit untersucht die Integration von Aerobic mit Handgeräten in den Sportunterricht der gymnasialen Oberstufe. Die Autorin begründet die Themenwahl mit dem anhaltenden Trend Aerobic und dem Wunsch, klassische Handgeräte wieder attraktiv zu gestalten. Sie thematisiert die Herausforderungen der Unterrichtsgestaltung, insbesondere im Hinblick auf erfahrungsoffene Lernprozesse und die Berücksichtigung der Heterogenität der Lerngruppe. Die zentralen Fragestellungen der Arbeit betreffen die Schaffung erfahrungsoffener Lehr-Lernsituationen, die Berücksichtigung der Heterogenität der Lerngruppe und die effektive Verzahnung von Theorie und Praxis.
2 Darstellung der Unterrichtssituation: Dieses Kapitel beschreibt die Rahmenbedingungen der Unterrichtssituation, wie den zweistündigen Sportkurs der Jahrgangsstufe 12 mit den Bewegungsfeldern „Bewegung gymnastisch, rhythmisch und tänzerisch gestalten“ und „den Körper trainieren, die Fitness verbessern“. Die Lerngruppe (21 Schülerinnen) wird hinsichtlich ihrer konditionellen und koordinativen Fähigkeiten, ihrer Vorerfahrungen und ihrer Sozialkompetenz analysiert. Die Heterogenität der Lerngruppe wird deutlich herausgestellt.
3 Didaktisch – methodische Überlegungen zur Unterrichtsreihe: Dieses Kapitel erläutert die didaktisch-methodischen Überlegungen zur Unterrichtsreihe. Die Autorin beschreibt die Auswahl des Themas Aerobic mit Handgeräten, die spezifischen Merkmale von Aerobic, die Bedeutung der Koordination und der Handgeräte (Gymnastikball und Stab), sowie den Einsatz von Musik im Unterricht. Es wird ein Modell zur Konzeption der Unterrichtsreihe vorgestellt und der Bezug zum hessischen Lehrplan Sport hergestellt. Besondere Aufmerksamkeit wird der Mehrperspektivität des Unterrichts und der Verknüpfung von Theorie und Praxis gewidmet. Die Rolle der Lehrerin als Moderatorin und Beraterin wird beschrieben, ebenso wie die Leistungsbewertung und Lernerfolgskontrolle.
4 Dokumentation der Unterrichtsreihe: Dieses Kapitel dokumentiert den Ablauf der Unterrichtsreihe, beginnend mit einer tabellarischen Übersicht. Ausgewählte Stunden (2., 5. und 6. Doppelstunde) werden detailliert beschrieben, inklusive didaktisch-methodischer Überlegungen, Verlaufsbeschreibung und Reflexion. Die Autorin beschreibt, wie sie den Unterricht gestaltet, um die Selbstständigkeit der Schülerinnen zu fördern und die Theorie-Praxis-Verzahnung zu gewährleisten. Sie reflektiert die Herausforderungen und Erfolge der jeweiligen Stunden.
Schlüsselwörter
Aerobic, Handgeräte (Gymnastikball, Stab), rhythmische Gymnastik, Fitness, Gesundheit, Koordination, Bewegungsgestaltung, Körpererfahrung, Kooperation, Selbstständigkeit, Lehr-Lernprozesse, Unterrichtsmethoden, Differenzierung, Hessischer Lehrplan Sport.
Häufig gestellte Fragen zur Unterrichtsreihe "Aerobic mit Handgeräten"
Was ist das Thema der Unterrichtsreihe und welche Ziele werden verfolgt?
Die Unterrichtsreihe behandelt das Thema Aerobic mit Handgeräten (Gymnastikball und Stab) in der Jahrgangsstufe 12. Das Ziel ist die Integration des anhaltenden Trends Aerobic in den Schulsport, die Neubelebung klassischer Handgeräte und die Gestaltung eines erfahrungsorientierten Unterrichts, der Selbstständigkeit, Kooperation und Selbstvertrauen der Schülerinnen fördert. Die Verzahnung von Theorie und Praxis spielt eine zentrale Rolle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Darstellung der Unterrichtssituation, didaktisch-methodische Überlegungen zur Unterrichtsreihe, Dokumentation der Unterrichtsreihe und Gesamtreflexion und Ausblick. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Aspekte werden in der Darstellung der Unterrichtssituation behandelt?
Dieses Kapitel beschreibt die Rahmenbedingungen des zweistündigen Sportkurses (Jahrgangsstufe 12), die Lerngruppe (21 Schülerinnen) mit ihren konditionellen und koordinativen Fähigkeiten, Vorerfahrungen und Sozialkompetenzen und analysiert die Heterogenität der Lerngruppe.
Welche didaktisch-methodischen Überlegungen werden angestellt?
Dieses Kapitel erläutert die Themenwahl (Aerobic mit Handgeräten), die Bedeutung der Koordination und der Handgeräte, den Einsatz von Musik, ein Modell zur Konzeption der Unterrichtsreihe, den Bezug zum hessischen Lehrplan Sport, die Mehrperspektivität des Unterrichts, die Verknüpfung von Theorie und Praxis, die Rolle der Lehrerin und die Leistungsbewertung/Lernerfolgskontrolle.
Wie wird die Unterrichtsreihe dokumentiert?
Die Dokumentation umfasst eine tabellarische Übersicht des Verlaufs und detaillierte Beschreibungen ausgewählter Stunden (2., 5. und 6. Doppelstunde) inklusive didaktisch-methodischer Überlegungen, Verlaufsbeschreibung und Reflexion. Der Fokus liegt auf der Förderung der Selbstständigkeit der Schülerinnen und der Theorie-Praxis-Verzahnung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Aerobic, Handgeräte (Gymnastikball, Stab), rhythmische Gymnastik, Fitness, Gesundheit, Koordination, Bewegungsgestaltung, Körpererfahrung, Kooperation, Selbstständigkeit, Lehr-Lernprozesse, Unterrichtsmethoden, Differenzierung, Hessischer Lehrplan Sport.
Welche zentralen Fragestellungen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentralen Fragestellungen betreffen die Schaffung erfahrungsoffener Lehr-Lernsituationen, die Berücksichtigung der Heterogenität der Lerngruppe und die effektive Verzahnung von Theorie und Praxis.
Welche Rolle spielt die Heterogenität der Lerngruppe?
Die Heterogenität der Lerngruppe wird explizit berücksichtigt und als Herausforderung und Chance in der Unterrichtsgestaltung thematisiert.
Wie wird die Verzahnung von Theorie und Praxis umgesetzt?
Die Arbeit legt großen Wert auf die Verzahnung von Theorie und Praxis. Dies wird in den didaktisch-methodischen Überlegungen, der Stundenplanung und der Reflexion der einzelnen Stunden deutlich.
Wie wird die Leistungsbewertung und Lernerfolgskontrolle durchgeführt?
Die Arbeit beschreibt die Vorgehensweise bei der Leistungsbewertung und Lernerfolgskontrolle, jedoch ohne konkrete Details zu nennen.
- Quote paper
- Verena Maras (Author), 2004, Aerobic mit Handgeräten , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26266