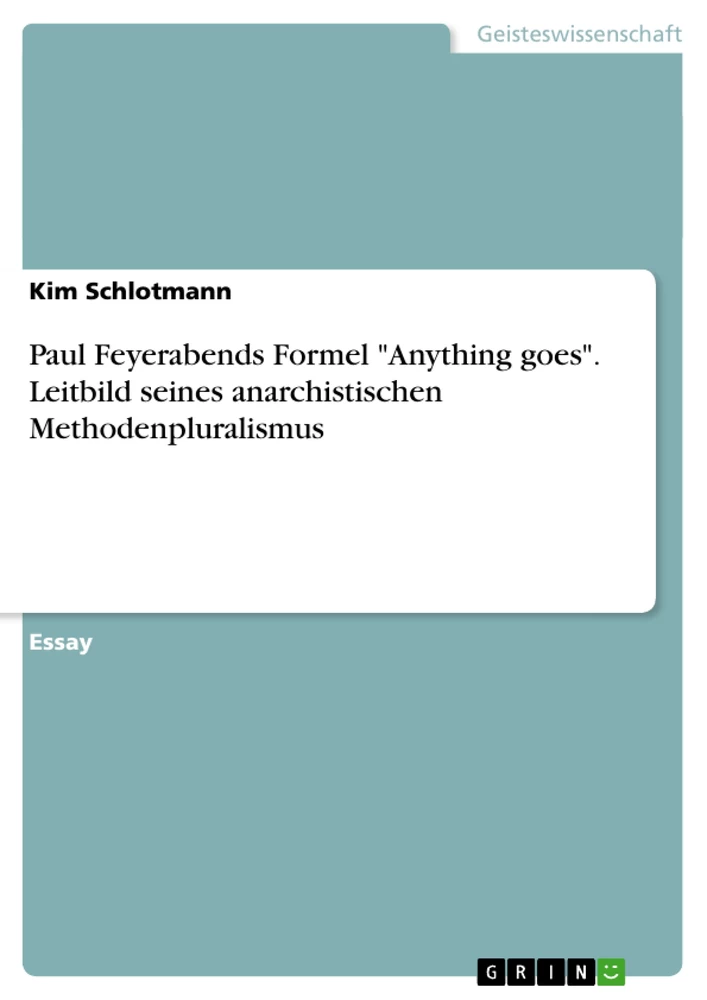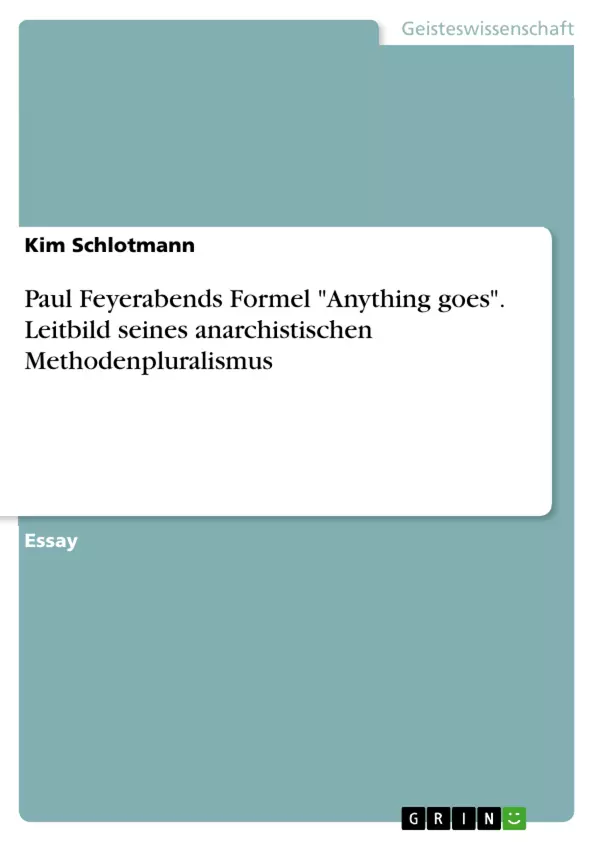Paul K. Feyerabend gilt als der absolute Rebell der Wissenschaftstheorie, grenzt er sich doch mit seinem sogenannten anarchistischen Methodenpluralismus in den Wissenschaften von allem ab, was man bis dato kannte. Seine Auffassung von Wissenschaft, die im krassen Gegensatz zu derjenigen Poppers steht, hat für Furore gesorgt. Die folgende Arbeit nimmt es sich daher zum Ziel, anhand des ersten Kapitels seines Hauptwerkes "Wider den Methodenzwang" den Gedankengängen Feyerabends nachzuspüren.
Inhaltsverzeichnis
- Wider den Methodenzwang: Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie
- Die liberale Praxis des bewußten und unbewußten Bruchs mit den Regeln der Wissenschaft
- Die „Hindemis des Fortschritts"
- Das Verhältnis von Denken und Handeln in der Wissenschaft
- Die Genese des Kopernikanischen Weltbildes
- Fortschritt
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Paul Feyerabends Plädoyer für seine Formel „Anything goes" als Prinzip und Leitbild seines anarchistischen Methodenpluralismus, wie er im ersten Kapitel seines Werkes „Wider den Methodenzwang" dargestellt wird. Die Arbeit untersucht Feyerabends Argumentation und zeigt auf, wie er für eine Methodenfreiheit in den Wissenschaften argumentiert.
- Kritik an der wissenschaftlichen Methodik und ihren „festen, umeränderlichen und absolut verbindlichen Grundsätzen"
- Das Prinzip der „liberalen Praxis", das den bewussten und unbewussten Bruch mit wissenschaftlichen Regeln beinhaltet
- Die Rolle von Interessen, Macht und Propaganda in der Entwicklung der Erkenntnis
- Die Bedeutung von spielerischer Tätigkeit und „unbestimmten Drängen" für wissenschaftliche Erkenntnis
- Die These, dass Theorien erst dann „klar und ‚vernünftig‘" werden, nachdem „inkohärente Bruchstücke von ihnen langen Zeit hindurch verwendet worden sind"
Zusammenfassung der Kapitel
Feyerabend zeichnet ein düsteres Bild der wissenschaftlichen Methodik und argumentiert, dass die Geschichte der Wissenschaft die Existenz von „festen, umeränderlichen und absolut verbindlichen Grundsätzen" widerlegt. Er argumentiert, dass Verstöße gegen diese Grundsätze nicht auf „mangelndem Wissen oder vermeidbarer Nachlässigkeit" beruhen, sondern notwendig sind, um unsere Erkenntnis der Welt zu erweitern. Er veranschaulicht dies anhand von Beispielen wie dem Aufkommen des Atomismus in der Antike, wo Wissenschaftler bewusst oder unbewusst aus dem methodologischen Korsett ihrer Zeit ausbrachen.
Feyerabend charakterisiert die „liberale Praxis" des bewussten und unbewussten Bruchs mit den Regeln der Wissenschaft. Er betont sowohl den historischen als auch den normativen Charakter dieser Regelverletzungen und argumentiert, dass es in bestimmten Situationen notwendig sein kann, „ad-hoc-Hypothesen einzuziehen, auszubauen und zu verteidigen", selbst wenn sie bestehenden experimentellen Ergebnissen widersprechen.
Feyerabend kritisiert die Argumentation als „Hindemis des Fortschritts" und betont die Bedeutung nicht-argumentativer Entwicklung in wissenschaftlichen Institutionen. Er argumentiert, dass fundamentale Umwälzungen in Moralsystemen und Gesellschaften auch neue Argumentationsformen nach sich ziehen und dass überkommene Argumente möglicherweise nur durch Propaganda und Zwang aufrechterhalten werden können.
Feyerabend hinterfragt die Vorstellung, dass einer gründlichen Untersuchung eines Gegenstandes zuerst eine klar ausformulierte Problemstellung vorangehen muss. Er argumentiert, dass die Schaffung eines Gegenstandes und das Verständnis seiner Eigenschaften oft zu einem und demselben Vorgang gehören. Er veranschaulicht dies anhand der Genese des Kopernikanischen Weltbildes, das mit einer „festen Überzeugung", die vollkommen kontraintuitiv und antiempirisch war, begann und sich durch die Unterstützung weiterer irrational erscheinender Überzeugungen (wie dem Trägheitsgesetz und dem Fernrohr) durchsetzte.
Feyerabend stellt verschiedene Interpretationen des Begriffs „Fortschritt" vor, darunter die empirische Sichtweise, die „Fortschritt" als den Übergang zu einer Theorie definiert, die unmittelbare empirische Prüfungen für die meisten ihrer Grundannahmen ermöglicht. Er bietet auch eine alternative Interpretation an, die „Fortschritt" als Vereinheitlichung und Harmonie definiert, möglicherweise sogar auf Kosten der empirischen Stimmigkeit. Feyerabend selbst definiert „Fortschritt" als den Erfolg, der durch anarchistische Schritte erzielt wird, selbst in einer „Gesetz-und-Ordnungs"-Wissenschaft.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den anarchistischen Methodenpluralismus, die „liberale Praxis" des Bruchs mit wissenschaftlichen Regeln, die Rolle von Interessen, Macht und Propaganda in der Wissenschaft, die Bedeutung von spielerischer Tätigkeit und „unbestimmten Drängen" für wissenschaftliche Erkenntnis, sowie die These, dass Theorien erst dann „klar und ‚vernünftig‘" werden, nachdem „inkohärente Bruchstücke von ihnen langen Zeit hindurch verwendet worden sind".
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Paul Feyerabends Formel "Anything goes"?
Es ist das einzige Prinzip, das den wissenschaftlichen Fortschritt nicht behindert. Es besagt, dass es keine universell gültigen, unveränderlichen Regeln für wissenschaftliche Forschung gibt.
Was ist anarchistischer Methodenpluralismus?
Feyerabend argumentiert, dass Wissenschaftler bewusst gegen bestehende Regeln verstoßen müssen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Fortschritt entsteht oft durch das Chaos und die Vielfalt der Methoden, nicht durch starre Logik.
Warum kritisiert Feyerabend die wissenschaftliche Methodik?
Er sieht in festen Regeln ein Hindernis für den Fortschritt. Die Wissenschaftsgeschichte zeige, dass große Entdeckungen (wie die von Kopernikus) oft auf Regelverstößen und irrationalen Annahmen basierten.
Welche Rolle spielt Propaganda in der Wissenschaft?
Laut Feyerabend werden neue Theorien oft nicht durch bessere Argumente, sondern durch Propaganda, Zwang und Interessen durchgesetzt, bis sie schließlich als "vernünftig" wahrgenommen werden.
Wie definiert Feyerabend "Fortschritt"?
Fortschritt ist für ihn der Erfolg, der durch anarchistische Schritte erzielt wird – oft durch die Vereinheitlichung und Harmonie von Ideen, selbst wenn diese der Empirie widersprechen.
- Quote paper
- Kim Schlotmann (Author), 2013, Paul Feyerabends Formel "Anything goes". Leitbild seines anarchistischen Methodenpluralismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262666