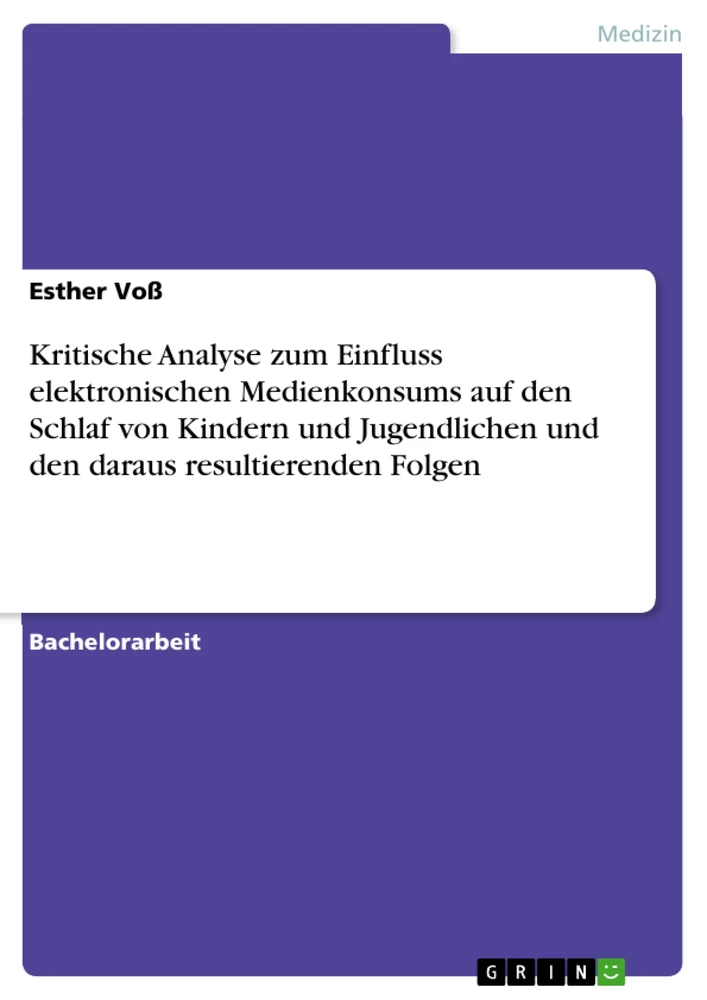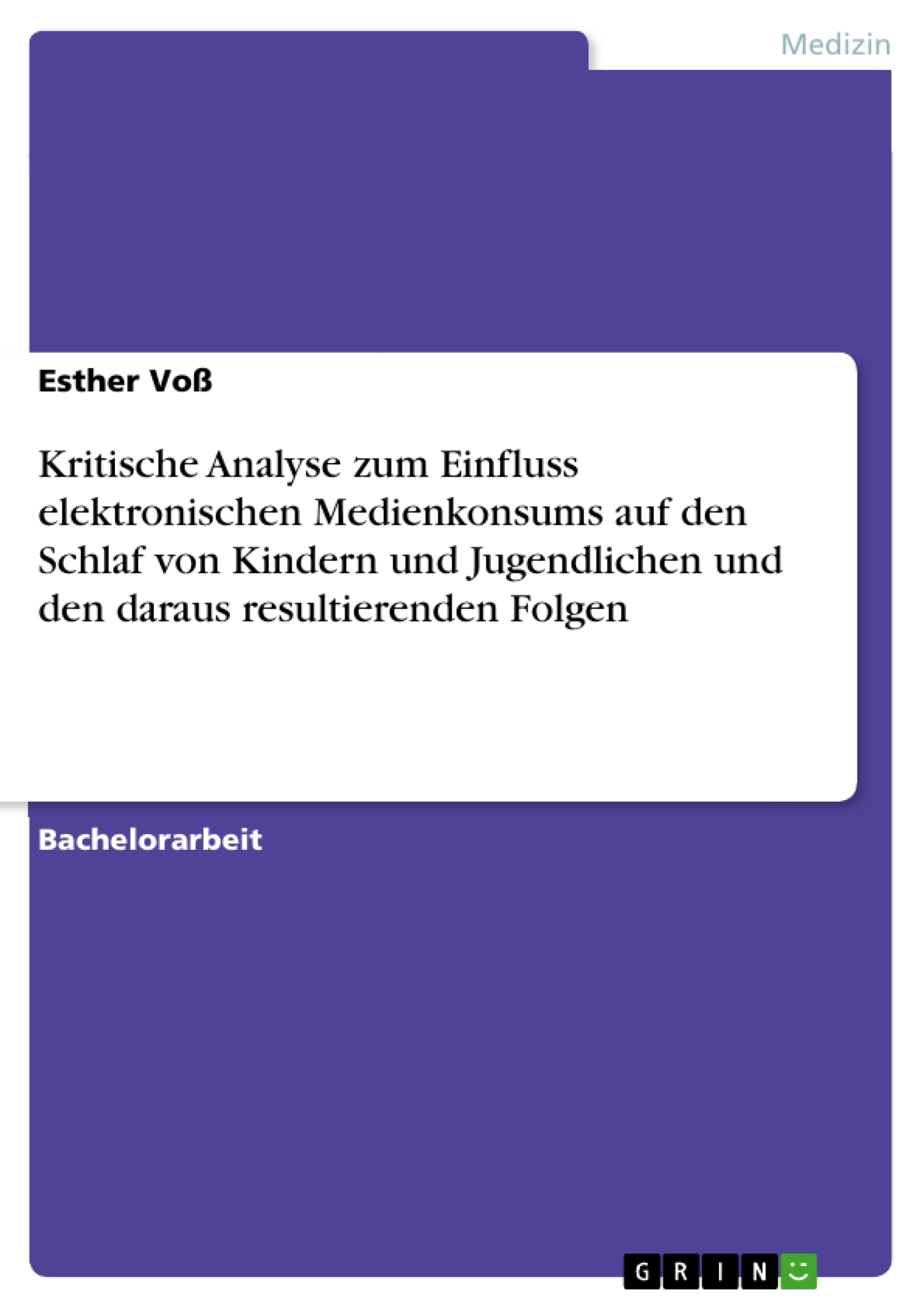Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss elektronischen Medienkonsums auf den Schlaf von Kindern und Jugendlichen und den daraus resultierenden Folgen. Es wird der Frage nachgegangen, welchen Einfluss der elektronische Medienkonsum auf den Schlaf von Kindern und Jugendlichen ausübt und welche Auswirkungen dies auf die körperliche und geistige Gesundheit von Kindern und Jugendlichen hat. Zur Beantwortung der Frage wurden die Ergebnisse von deutsch- und englisch-sprachigen Studien analysiert, welche sich mit dem Einfluss von Fernsehen, Computernutzung und Nutzung von Mobiltelefonen auf den Schlaf von Kindern und Jugendlichen beschäftigen. Die Analyse zeigt, dass die Nutzung dieser Medien mit späten Einschlafzeiten und häufiger Müdigkeit assoziiert werden. Kausalzusammenhänge konnten in den meisten der Studien nicht belegt werden. Im nächsten Abschnitt der Arbeit wird auf die Folgen von Medienkonsum in Verbindung mit unzureichendem Schlaf ein-gegangen. Dazu werden Studienergebnisse analysiert, die sich zum einen mit den Auswirkungen auf die schulische Leistungsfähigkeit, als Merkmal der geistigen Gesundheit, und zum anderen mit den Auswirkungen auf die Körperkomposition, als Merkmal der körperlichen Gesundheit, beschäftigen. Im Ergebnis wird deutlich, dass sowohl ein erhöhter Medienkonsum als auch ein unzureichender Schlaf zu Einschränkungen der schulischen Leistungsfähigkeit führen. Darüber hinaus bewirkt das Zusammenspiel von Medienkonsum und vermindertem Schlaf ein erhöhtes Risiko für Übergewicht und Adipositas. Abschließend werden in dieser Arbeit Handlungsstrategien diskutiert, mit deren Hilfe die beschriebenen Auswirkungen verhindert oder eingedämmt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entwicklung des Schlafes nach Altersstufen
- Zirkadianer Rhythmus
- Funktion des Schlafes
- Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
- Einfluss des elektronischen Medienkonsums auf den Schlaf
- Schlaf und Fernsehen
- Schlaf und Computer
- Schlaf und Nutzung von Mobiltelefonen
- Diskussion
- Auswirkungen des Einflusses von Medienkonsum auf den Schlaf
- Medienkonsum und schulische Leistungsfähigkeit
- Schlaf und schulische Leistungsfähigkeit
- Medienkonsum, Schlaf und Körperkomposition
- Zwischenfazit
- Handlungsbedarf und Handlungsstrategien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Einfluss des elektronischen Medienkonsums auf den Schlaf von Kindern und Jugendlichen und dessen Auswirkungen auf ihre körperliche und geistige Gesundheit. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Mediennutzung, Schlafverhalten und den daraus resultierenden Folgen zu gewinnen. Sie untersucht, welche Medienformen (Fernsehen, Computer, Mobiltelefone) den Schlaf beeinflussen und welche Auswirkungen dies auf die schulische Leistungsfähigkeit und die körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen hat.
- Die Entwicklung des Schlafes im Kindes- und Jugendalter
- Der Einfluss des elektronischen Medienkonsums auf den Schlaf
- Die Auswirkungen von Medienkonsum und Schlaf auf die schulische Leistungsfähigkeit
- Die Auswirkungen von Medienkonsum und Schlaf auf die körperliche Gesundheit
- Handlungsmöglichkeiten zur Prävention und Eindämmung negativer Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz des Schlafens für die körperliche und geistige Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Die steigende Mediennutzung in dieser Altersgruppe und die damit verbundenen potenziellen Auswirkungen auf den Schlaf werden als Problemfeld dargestellt.
- Entwicklung des Schlafes nach Altersstufen: Dieses Kapitel beschreibt die altersbedingten Veränderungen des Schlafes bei Kindern und Jugendlichen, um ein grundlegendes Verständnis für die Schlafbedürfnisse und Schlafgewohnheiten dieser Altersgruppen zu schaffen.
- Zirkadianer Rhythmus: Dieses Kapitel erklärt den zirkadianen Rhythmus, also die natürliche 24-Stunden-Uhr des Körpers, die Schlaf-Wach-Phasen steuert. Es wird die Bedeutung dieses Rhythmus für das Schlafverhalten und die Auswirkungen von Störungen des Rhythmus auf die Gesundheit beleuchtet.
- Funktion des Schlafes: In diesem Kapitel werden die wichtigen Funktionen des Schlafes für die körperliche und geistige Erholung, die kognitiven Fähigkeiten und die emotionale Stabilität erläutert. Es wird die Bedeutung des Schlafes für die Entwicklung und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen hervorgehoben.
- Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland: Dieses Kapitel beleuchtet die Mediennutzungsgewohnheiten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Es wird die Verbreitung von Medien wie Fernsehen, Computer und Mobiltelefonen in dieser Altersgruppe dargestellt.
- Einfluss des elektronischen Medienkonsums auf den Schlaf: Dieses Kapitel analysiert die Forschungsergebnisse zum Einfluss des elektronischen Medienkonsums auf den Schlaf von Kindern und Jugendlichen. Es werden die Auswirkungen verschiedener Medienformen (Fernsehen, Computer, Mobiltelefone) auf die Schlafqualität und das Schlafverhalten untersucht.
- Auswirkungen des Einflusses von Medienkonsum auf den Schlaf: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen des Medienkonsums auf den Schlaf für die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Es werden die Folgen für die schulische Leistungsfähigkeit und die Körperkomposition (z.B. Übergewicht) beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Einfluss von elektronischem Medienkonsum, insbesondere Fernsehen, Computer und Mobiltelefonen, auf den Schlaf von Kindern und Jugendlichen. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen auf die schulische Leistungsfähigkeit und die körperliche Gesundheit, insbesondere das Risiko für Übergewicht und Adipositas. Der Fokus liegt auf der Analyse deutsch- und englischsprachiger Studien, welche die Zusammenhänge zwischen Mediennutzung, Schlafverhalten und gesundheitlichen Folgen untersuchen.
- Arbeit zitieren
- Esther Voß (Autor:in), 2013, Kritische Analyse zum Einfluss elektronischen Medienkonsums auf den Schlaf von Kindern und Jugendlichen und den daraus resultierenden Folgen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262936