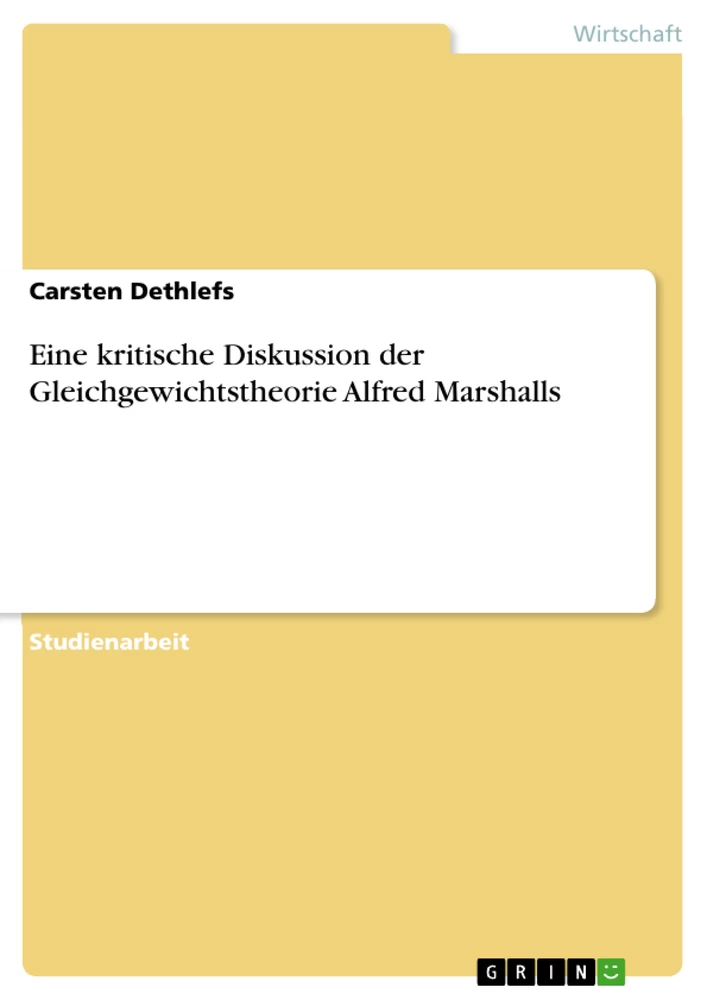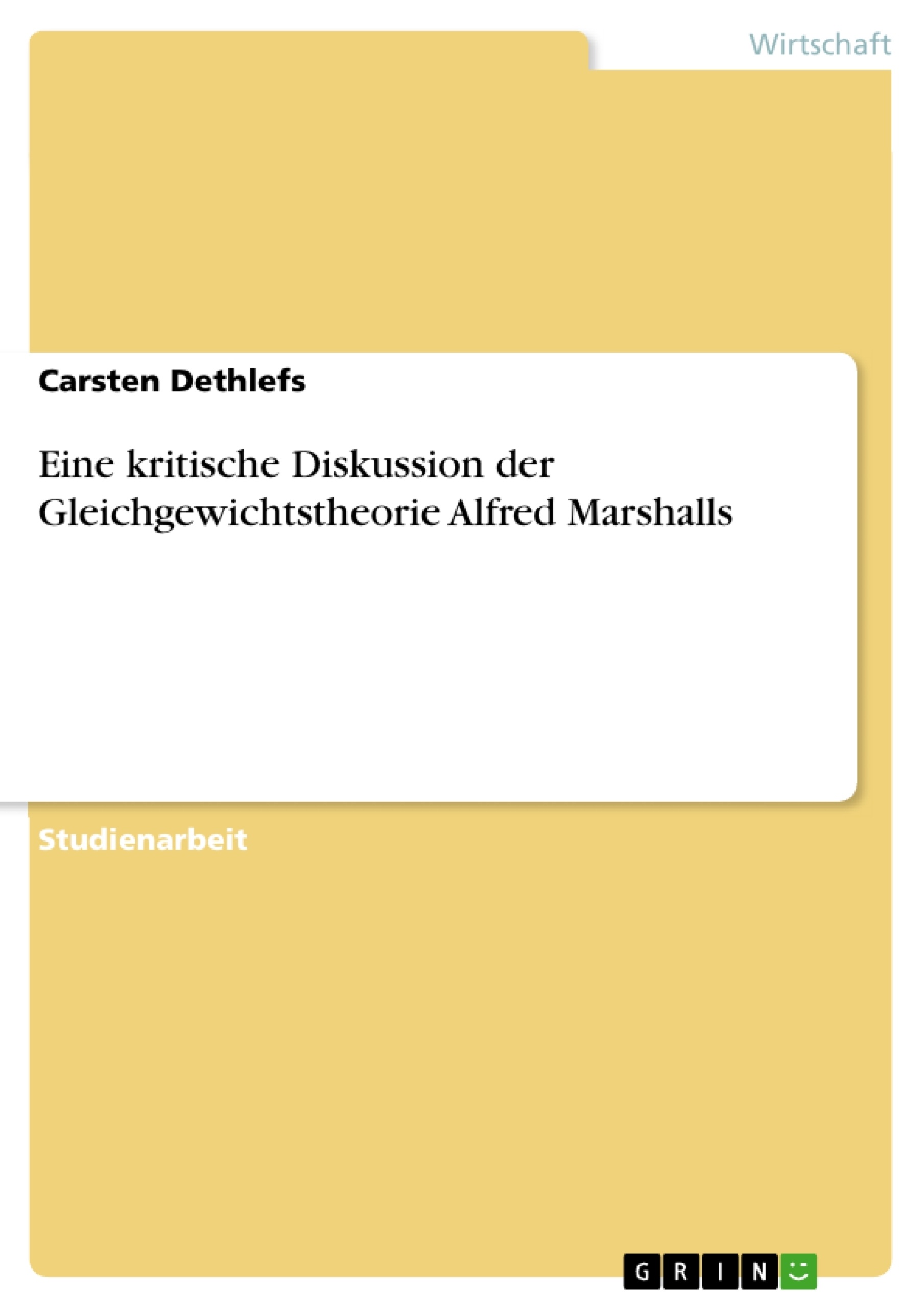Die Gleichgewichtsvorstellungen in der Ökonomie beschäftigen die Volkswirtschaft schon
seit jeher und haben schon so einige Kontroversen ausgelöst. Diese Vorstellungen sind
hierbei immer aus der jeweiligen Zeit heraus zu verstehen. Das gilt insbesondere, wenn
man die Diskussion um die Vorstellungen über das Gleichgewicht nicht nur als abstrakte
Überlegungen der Mathematik begreift, sondern als Ausdruck der philosophischen und
produktionstechnischen Umstände und des vorherrschenden Menschenbildes in den
einzelnen Epochen. Die Reichtumsmaximierung in der Klassik mit ihrem Hauptwerk „An
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“ (1776) von Adam Smith und
die subjektive Nutzenbewertung und Maximierung in der Neoklassik mögen hierfür gute
Beispiele abgeben. Der allwissende Mensch in der Neoklassik und der ganz überwiegend
nach dem Selbstinteresse handelnde, aber der Gesellschaft dienliche Menschentypus des
Homo Oeconomicus in der Klassik implizieren ganz unterschiedliche Handlungsannahmen.
Die Unterschiede in den Ursachen für das Zustandekommen eines
Gleichgewichtes können hiernach die folgenden Ausprägungen annehmen: Sie können im
Einfluss des Preises oder der Menge sowie in einer kurzen oder langen Sichtweise liegen.
Zudem kann sich die Konstruktion einer Gleichgewichtsvorstellung auf die
Interdependenzen zwischen Märkten (allgemeines Gleichgewicht) oder auf den
Entwicklungsgedanken einiger Bereiche (partielles Gleichgewicht) konzentrieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Marshalls Sicht des ökonomischen Gleichgewichts
- 2.1 Grundannahmen
- 2.2 Marshall und der Markt
- 2.3 Temporäres Gleichgewicht
- 2.4 Zusammenfassung
- 3. Kritik an Marshalls Vorstellungen
- 3.1 Sraffas Denkansatz
- 3.2 Kritische Würdigungen
- 4. Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit Alfred Marshalls Theorie des partiellen Gleichgewichts und dessen Bedeutung im Rahmen der modernen Gleichgewichtstheorie. Ziel ist es, Marshalls Gedankengebäude im Kontext der Wirtschaftsgeschichte zu positionieren und seine Relevanz für die heutige Zeit zu untersuchen. Dies geschieht insbesondere durch die Analyse der Kritik von Piero Sraffa an Marshalls Annahmen.
- Marshalls Theorie des partiellen Gleichgewichts
- Die Rolle des temporären Gleichgewichts
- Kritik an Marshalls Annahmen durch Piero Sraffa
- Marshalls Bedeutung für die moderne Ökonomie
- Die Positionierung Marshalls als moderner Klassiker
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Gleichgewichtsvorstellungen in der Ökonomie ein und beleuchtet die historische Entwicklung dieser Konzepte im Kontext des Menschenbildes und der jeweiligen Produktionsverhältnisse.
Kapitel 2 widmet sich Marshalls Theorie des ökonomischen Gleichgewichts. Es werden seine Grundannahmen, seine Interpretation des Marktes und seine Vorstellung vom temporären Gleichgewicht vorgestellt und analysiert.
Kapitel 3 analysiert die Kritik an Marshalls Vorstellungen, insbesondere die sraffaschen Kritikpunkte.
Kapitel 4 beinhaltet die Schlussbetrachtung und einen Ausblick auf die Bedeutung von Marshalls Gedanken für die moderne Wirtschaftswissenschaft.
Schlüsselwörter
Alfred Marshall, Partielles Gleichgewicht, Temporäres Gleichgewicht, Sraffa-Kritik, Moderne Ökonomie, Gleichgewichtstheorie, Homo Oeconomicus, Reichtum, Bedürfnisse, Markt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Alfred Marshalls Theorie des partiellen Gleichgewichts?
Marshall konzentriert sich auf das Gleichgewicht auf einzelnen Märkten unter der Annahme „ceteris paribus“ (alles andere bleibt gleich), statt das gesamte Wirtschaftssystem gleichzeitig zu betrachten.
Welche Kritik äußerte Piero Sraffa an Marshalls Modell?
Sraffa kritisierte die logische Inkonsistenz der Annahmen über steigende und fallende Grenzkosten innerhalb des partiellen Gleichgewichtsrahmens.
Was versteht Marshall unter einem „temporären Gleichgewicht“?
Es beschreibt einen Zustand, in dem sich Angebot und Nachfrage über einen sehr kurzen Zeitraum ausgleichen, ohne dass langfristige Anpassungen der Produktionskapazitäten stattfinden.
Wie beeinflusst das Menschenbild die Gleichgewichtstheorie?
Die Arbeit zeigt auf, wie der „Homo Oeconomicus“ und die subjektive Nutzenmaximierung der Neoklassik die theoretischen Konstruktionen von Gleichgewichten prägen.
Gilt Marshall heute als „moderner Klassiker“?
Ja, die Arbeit positioniert Marshall als eine Brückenfigur, deren Konzepte wie die Elastizität der Nachfrage noch heute fundamentale Bestandteile der Ökonomie sind.
- Quote paper
- Carsten Dethlefs (Author), 2010, Eine kritische Diskussion der Gleichgewichtstheorie Alfred Marshalls, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263048