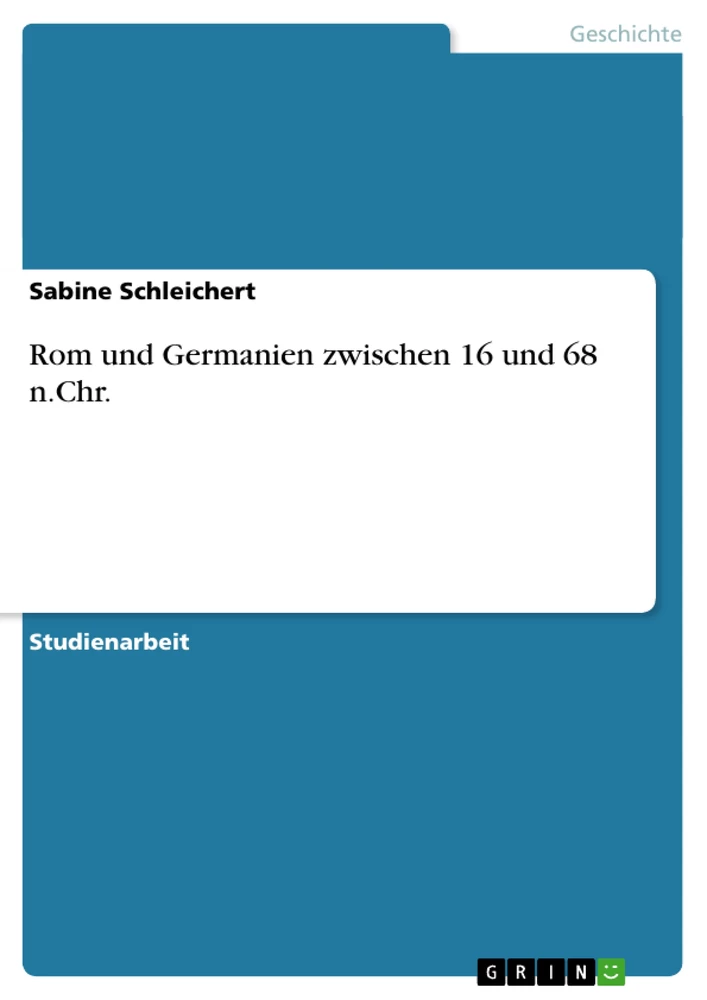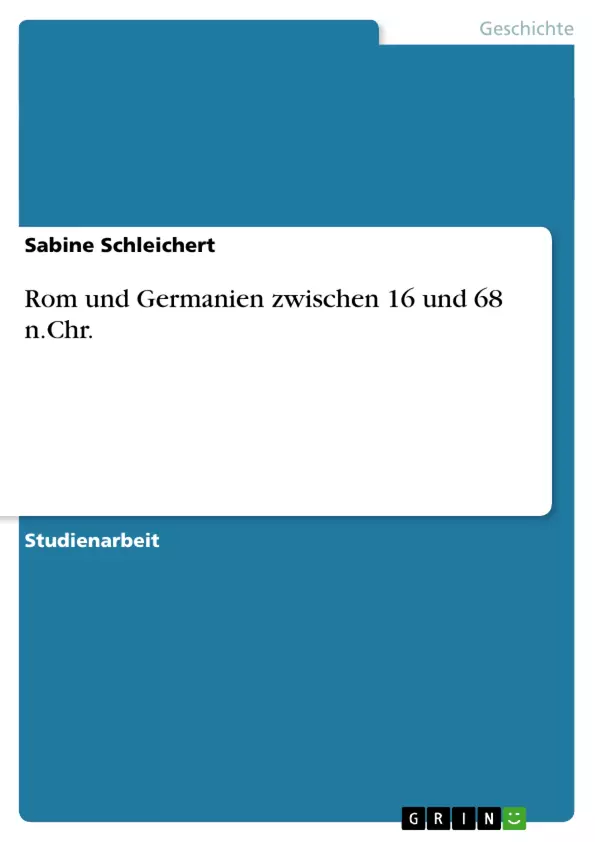Das Thema dieser Hausarbeit sind die Beziehungen zwischen Rom und Germanien in der erstenHälfte des 1. Jahrhunderts n.Chr., d.h. unter der Regierung der Principes Tiberius, Caligula,Claudius und Nero. Eine sinnvolle genauere zeitliche Begrenzung sind auf der einen Seite dieAbberufung des Germanicus durch Tiberius und die Beendigung der erfolglosen Feldzüge imrechtsrheinischen Germanien im Jahre 16 n.Chr., auf der anderen Seite die Aufstände desGalliers J. Vindex und der germanischen Bataver in den Jahren 68 bis 70. Da diese Kette vonAufständen jedoch ein zu komplexes Thema ist und sie auch im Gegensatz zu der Mehrzahl dervorhergehenden Aufstände eher den Charakter eines bellum internum, also eines Bürgerkriegesin Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um das Principat, als den eines externenKrieges mit fremden Völkerschaften trägt, soll dieser Zeitraum hier ausgeklammert bleiben. Diebehandelte Epoche endet daher mit dem Principat Neros und, bezogen auf Germanien, mit derVertreibung der Ampsivarier aus dem rechtsrheinischen Militärland im Jahre 58 n.Chr.
Als Quelle für diese Zeit dienen vor allem die "Annalen" des Tacitus (mit einer Lücke für dieJahre 38 bis 46) und einige Stellen in Suetons "Leben der Caesaren" und Cassius Dios "Römischer Geschichte". Ein grundsätzliches Problem ist dabei, daß auch Tacitus nur über Aufstände und ähnliche Vorkommnisse berichtet, nicht über die allgemeinen Beziehungen zwischenRom und Germanien in dieser Zeit, z.B. was Handel etc. betrifft. Diese literarischen Quellenwerden in ihrer Aussage ergänzt durch verschiedene Münzen aus der Zeit von Caligula undClaudius und durch archäologische Erkenntnisse über Bau und Nutzung von Kastellen undLegionslagern an der römisch-germanischen Grenze.
Aufgrund des beschränkten Quellenmaterials sind die Ziele dieser Hausarbeit vor allem dieDarstellung der Aufstände und der militärischen Aktionen Roms in Gallien und Germanien(meist in Anlehnung an Tacitus) und daneben der Versuch, eine Grundstruktur der römisch-germanischen Beziehungen im 1. Jahrhundert n.Chr. zu finden. Interessant ist daherbeispielsweise die Frage, ob die römische Germanienpolitik als offensiv bzw. imperialistischoder als defensiv zu betrachten ist. Eine kritische Hinterfragung der taciteischen Darstellungmuß dabei wegen der fehlenden Parallelüberlieferung weitgehend wegfallen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangssituation
- Innergermanische Auseinandersetzungen
- Rom, Gallien und Germanien unter dem Principat des Tiberius (14 - 37 n.Chr.)
- Tiberius' Germanienpolitik
- Der Aufstand in Gallien (21 n.Chr.)
- Der Aufstand der Friesen (28 n.Chr.)
- Rom und Germanien unter dem Principat des Caligula (37 - 41 n.Chr.)
- Caligulas Germanienpolitik
- Der Germanienfeldzug Caligulas
- Rom und Germanien unter dem Principat des Claudius (41 - 50 n.Chr.)
- Claudius' Germanienpolitik
- Römische Siege in Germanien
- Rom und Germanien unter dem Principat Neros (54 - 68 n.Chr.)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit den Beziehungen zwischen Rom und Germanien in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. unter den Regierungen von Tiberius, Caligula, Claudius und Nero. Die Arbeit analysiert insbesondere die militärischen Aktionen und die Aufstände, die in dieser Zeit stattfanden, und versucht, eine Grundstruktur der römisch-germanischen Beziehungen zu ermitteln. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, ob die römische Germanienpolitik als offensiv oder defensiv zu betrachten ist.
- Die römische Germanienpolitik unter den Prinzipaten Tiberius, Caligula, Claudius und Nero
- Militärische Aktionen und Aufstände im rechtsrheinischen Germanien
- Die Rolle der innergermanischen Konflikte in der römischen Politik
- Die Grenzen des römischen Machtbereichs und die Beziehungen zu den germanischen Stämmen
- Die Bedeutung der Quellen für das Verständnis der römischen Germanienpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Ausgangssituation nach der Varusniederlage und erläutert die Strategiewechsel der römischen Politik gegenüber Germanien unter Tiberius. Das zweite Kapitel befasst sich mit den innergermanischen Auseinandersetzungen, insbesondere dem Krieg zwischen den Cheruskern und den Markomannen, und zeigt auf, wie Rom von diesen Konflikten profitierte. Die Kapitel 3 bis 6 analysieren die römische Germanienpolitik unter den Prinzipaten Tiberius, Caligula, Claudius und Nero, wobei die Aufstände in Gallien und Germanien, die Feldzüge und die Entwicklung der römischen Militärpräsenz im Vordergrund stehen. Es werden die wichtigsten Militärlager und Stützpunkte an der römischen Rheingrenze beschrieben und die Beziehungen zu den germanischen Stämmen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Römische Germanienpolitik, Varusniederlage, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Germanicus, Arminius, Marbod, Cherusker, Markomannen, Aufstände, Militärlager, Rheingrenze, Bataver, Mattiaker, Friesen, Quellenkritik, Tacitus, Annalen, Sueton, Cassius Dio, Archäologie.
Häufig gestellte Fragen
Welcher Zeitraum der römisch-germanischen Beziehungen wird behandelt?
Die Arbeit behandelt die Jahre 16 bis 68 n.Chr., von der Abberufung des Germanicus bis zum Ende des Principats Neros.
War die römische Germanienpolitik eher offensiv oder defensiv?
Dies ist eine zentrale Fragestellung der Arbeit. Es wird untersucht, ob Rom imperialistische Ziele verfolgte oder primär die Rheingrenze sicherte.
Welche antiken Quellen dienen als Grundlage für diese Epoche?
Primärquellen sind die „Annalen“ des Tacitus, Suetons „Kaiserbiografien“ und Cassius Dios „Römische Geschichte“.
Welche germanischen Stämme spielten eine Rolle bei den Aufständen?
Erwähnt werden unter anderem die Aufstände der Friesen (28 n.Chr.) sowie die Auseinandersetzungen mit den Batavern und Ampsivariern.
Wie ergänzt die Archäologie die literarischen Quellen?
Archäologische Erkenntnisse über den Bau von Kastellen und Legionslagern sowie Münzfunde geben Aufschluss über die tatsächliche Militärpräsenz an der Grenze.
- Quote paper
- Sabine Schleichert (Author), 1987, Rom und Germanien zwischen 16 und 68 n.Chr., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26306