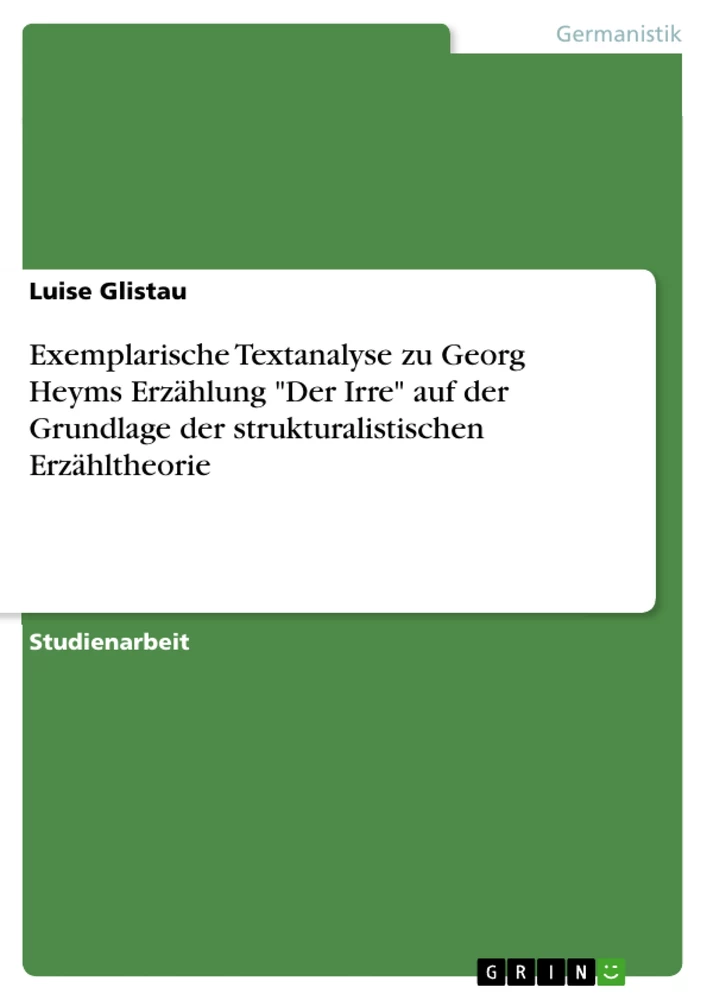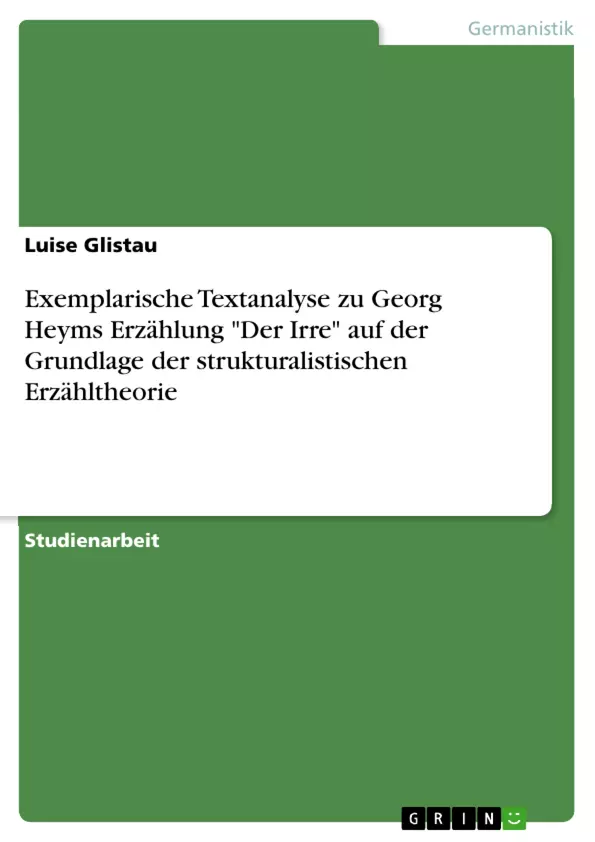"Ein irrtümlich als geheilt entlassener Irrer, der sich an seiner Frau, die er für die Ursache und also für schuldig hält an seinem Aufenthalt im Irrenhaus, rächen will und auf dem Nachhauseweg und dem vergeblichen Suchen nach seiner Frau zum mehrfachen, bestialischen Mörder völlig unbeteiligter, zufälliger Opfer wird, bis der tödliche Schuß eines Polizisten seinem Mord- und Zerstörungsrausch ein Ende macht, ist das Thema der Erzählung Heyms."
Diese kurze Beschreibung stellt Waltraut Schwarz‘ Versuch einer Inhaltsanalyse der oft als Novelle bezeichneten Erzählung Der Irre des expressionistischen Autors Georg Heym dar. Dass dabei gänzlich darauf verzichtet wird, die Eigenheiten der Präsentation des narrativen Inhalts zu beschreiben, könnte darauf zurückzuführen sein, dass dies ein wesentlich komplexeres Vorhaben wäre, als es eine reine Nacherzählung der Ereignisse in ihrer chronologischen Reihenfolge bedeutet. Wie wichtig aber eben die Beschreibung und Analyse der narrativen Gestaltung einer Erzählung sein kann, soll im Rahmen dieser Arbeit durch die Auseinandersetzung mit der strukturalistischen Erzähltheorie sowohl im theoretischen als auch im angewandten Sinn gezeigt werden.
Hierzu wird nach einer Abhandlung zur Entstehung der strukturalistischen Herangehensweise an literarische Texte detailliert auf die Analysekategorie Modus eingegangen, welche wiederum durch die Parameter Distanz und Fokalisierung charakterisiert ist. Um Heyms Erzählung im zweiten Teil der Arbeit in Hinblick auf die strukturalistische Erzähltheorie fundiert beschreiben und analysieren zu können, wird in den theoretischen Abhandlungen versucht, verstärkt einen Schwerpunkt auf diejenigen Aspekte zu legen, welche auf der narrativen Ebene zur Konstitution des Bildes des Wahnsinns des Protagonisten beitragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die strukturalistische Erzähltheorie
- Theoretische Reflexion zur Analysekategorie Modus
- Fokalisierung
- Distanz
- Zur Darstellung des Wahnsinns durch die narrativen Mittel der Kategorie Modus in Georg Heyms Erzählung Der Irre
- Gegenüber von Realität und Wahn durch dynamische Fokalisierungswechsel
- Nutzung des dramatischen Modus zur Vergegenwärtigung der wahnsinnigen Psyche des Protagonisten
- Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Georg Heyms Erzählung "Der Irre" auf der Grundlage der strukturalistischen Erzähltheorie. Ziel ist es, die Gestaltung des Wahnsinns in der Erzählung anhand der Analysekategorie Modus zu untersuchen. Dabei stehen die Parameter Fokalisierung und Distanz im Vordergrund.
- Analyse der Darstellung des Wahnsinns in Georg Heyms "Der Irre"
- Anwendung der strukturalistischen Erzähltheorie auf literarische Texte
- Bedeutung von Fokalisierung und Distanz für die narrative Gestaltung
- Untersuchung der Beziehung zwischen Erzähler und Leser
- Rolle der Erzählperspektive für die Interpretation der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Heyms Erzählung "Der Irre" kurz vor und erläutert den Fokus der Arbeit auf die strukturalistische Erzähltheorie. In Kapitel 2 wird die Entstehung und Entwicklung der strukturalistischen Erzähltheorie skizziert, wobei der Schwerpunkt auf den Begriffen histoire und discours liegt. Kapitel 3 widmet sich der Kategorie Modus und erläutert die Parameter Fokalisierung und Distanz. In Kapitel 4 wird die Darstellung des Wahnsinns in "Der Irre" analysiert, indem die narrative Gestaltung der Fokalisierung und Distanz untersucht wird.
Schlüsselwörter
Georg Heym, "Der Irre", strukturalistische Erzähltheorie, Modus, Fokalisierung, Distanz, Wahnsinn, narrative Gestaltung, Erzählperspektive, literarische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Georg Heyms Erzählung "Der Irre"?
Die Erzählung handelt von einem fälschlicherweise als geheilt entlassenen psychisch Kranken, der auf einem Rachefeldzug zum Mörder wird, bis er von der Polizei gestoppt wird.
Was ist der Fokus der strukturalistischen Erzähltheorie in dieser Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf die Kategorie "Modus", insbesondere auf die Parameter Distanz und Fokalisierung, um die narrative Gestaltung des Wahnsinns zu untersuchen.
Wie wird der Wahnsinn erzähltechnisch dargestellt?
Durch dynamische Wechsel der Fokalisierung und die Nutzung des dramatischen Modus wird die gestörte Wahrnehmung des Protagonisten für den Leser unmittelbar erlebbar gemacht.
Was bedeutet "Fokalisierung" in diesem Kontext?
Fokalisierung beschreibt die Perspektive oder den "Blickwinkel", aus dem erzählt wird. Sie bestimmt, welche Informationen dem Leser über die Innenwelt des "Irren" preisgegeben werden.
Warum ist die Abgrenzung von 'histoire' und 'discours' wichtig?
Die Unterscheidung hilft zu verstehen, dass nicht nur *was* erzählt wird (histoire), sondern vor allem *wie* es erzählt wird (discours), entscheidend für die Wirkung des Expressionismus ist.
- Citation du texte
- Luise Glistau (Auteur), 2013, Exemplarische Textanalyse zu Georg Heyms Erzählung "Der Irre" auf der Grundlage der strukturalistischen Erzähltheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263072