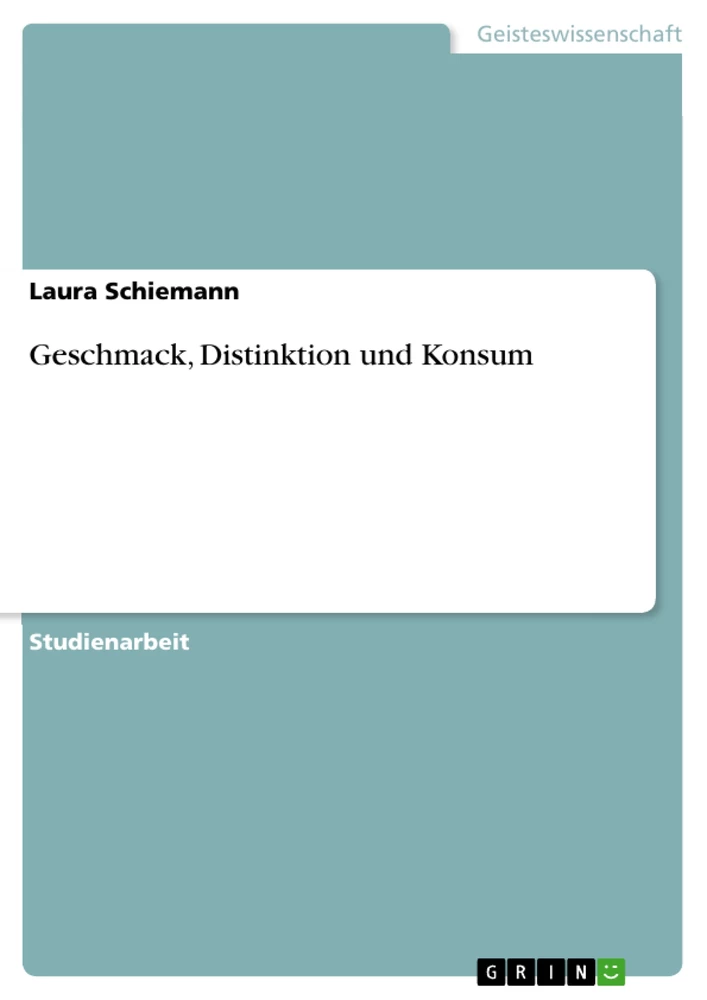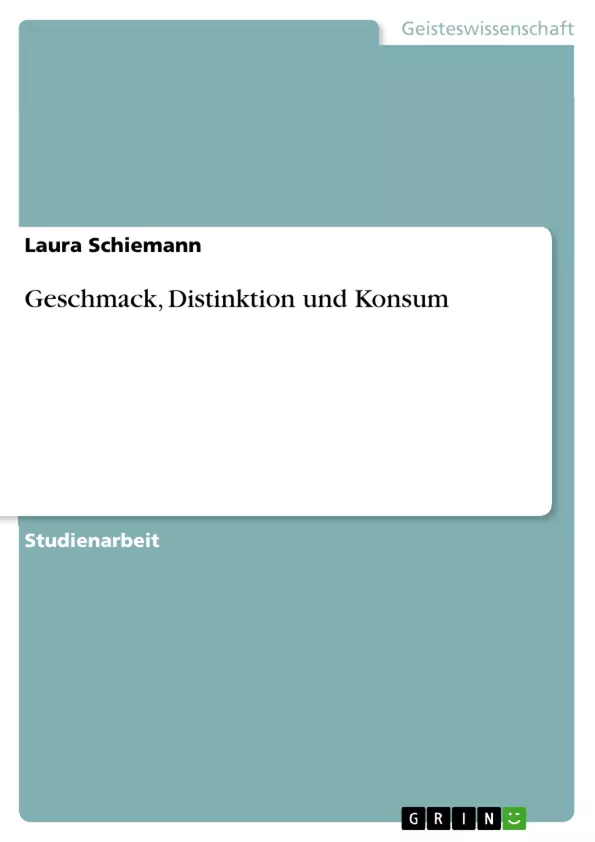Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Doch wie kommt es, dass diese Geschmäcker so variieren? Ist jeder lediglich verschieden oder lassen sich strukturelle Unterschiede und Gründe erkennen? In seinem wohl bekanntesten Werk „Die feinen Unterschiede“ untersucht Bourdieu das Verhältnis von Ungleichheit, Kultur und Herrschaft. Seine Theorie basiert auf empirischen Analysen der französischen Gesellschaft der 60er Jahre. Dennoch geht Bourdieu von einer Übertragbarkeit seines Konzeptes auf alle (Klassen-) Gesellschaften aus, wie im Vorwort der deutschen Ausgabe erläutert ist. So wird die Theorie von Bourdieu auch in dieser Hausarbeit die tragende Säule des theoretischen Konzeptes darstellen.
Mehr als je zuvor prägen Statusobjekte und demonstrativer Konsum unser tägliches Leben. Dies ist nicht zuletzt der medialen Präsenz und geschickten Vermarktungstechniken zu verdanken. Ob es sich dabei um ein bestimmtes Smartphone, ein hochpreisiges Auto oder um exklusive Markenmode handelt - das kann jeweils unterschiedlich zutreffen. Ziel dieses Konsums kann unter anderem der Wunsch nach Inklusion oder auch Exklusion sein.
Das Forschungsinteresse am Phänomen des Konsums und deren Entwicklung ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen, wie die Zunahme der Literatur und Untersuchungen in diesen Bereichen zeigen. Dieses Interessenwachstum entsteht unter anderem durch die Interdisziplinarität dieses Forschungsbereiches. Das individuelle Konsumverhalten wird von verschiedensten kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst. Auch für die Soziologie ist der Konsum ein bedeutsames Phänomen, beispielsweise für die Kommunikation unter den Personen (vgl. Hellmann 2011, S. 212). So wird in vielen Situationen über die Symbolik bestimmter Konsumgüter ein sogenannter Distinktionseffekt erzielt, d.h., man erfüllt damit das Bedürfnis sich von anderen abzugrenzen. Somit stellt der Konsum einen Mechanismus sozialer Ungleichheit dar. Das Konzept des Soziologen Pierre Bourdieu schreibt dem Konsum exemplarisch eine klassenbildende Wirkung zu.
Die leitenden Fragestellungen dieser Hausarbeit sind: Welche Zusammenhänge existieren zwischen dem Konzept des Geschmacks bzw. der Distinktion nach Bourdieu und dem Konsumverhalten?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Definitorische Grundlagen
- Theoretische Grundlagen
- Habitus
- Feld
- Kapital
- Sozialer Raum, Klassen und Geschmack
- Distinktion durch Konsum
- Schlussteil
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Geschmack, Distinktion und Konsum unter Verwendung der Theorie von Pierre Bourdieu. Sie analysiert, wie der Konsum von Gütern und Dienstleistungen als Mittel der sozialen Abgrenzung und der Herstellung von Klassenunterschieden dient.
- Die Rolle des Habitus und der Sozialisation in der Herausbildung des Geschmacks
- Die Bedeutung von Kapitalformen, insbesondere kulturellem Kapital, für die Positionierung im sozialen Raum
- Der Zusammenhang zwischen Konsum und sozialer Distinktion, insbesondere am Beispiel von Markenkleidung
- Die Kritik an Bourdieus Theorie und der Ausblick auf zukünftige Forschungsrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel legt die definitorischen Grundlagen für die Arbeit und erläutert die relevanten Schlüsselbegriffe wie Habitus, Kapital, Feld, Klassen und Konsum. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen des Habitus, des Feldes, des Kapitals und des sozialen Raumes. Im dritten Kapitel wird der Konsum als Mittel der sozialen Distinktion genauer betrachtet, wobei der Fokus auf Markenkleidung gelegt wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Konzepten aus der Theorie von Pierre Bourdieu, darunter Habitus, Kapital, Feld, sozialer Raum, Klassen, Distinktion und Konsum. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen diesen Begriffen und analysiert, wie sie zur Erklärung sozialer Ungleichheit und der Reproduktion von Klassenstrukturen beitragen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Bourdieus Werk „Die feinen Unterschiede“?
Bourdieu untersucht darin das Verhältnis von sozialer Ungleichheit, Kultur und Herrschaft und wie Geschmack zur Abgrenzung zwischen sozialen Klassen genutzt wird.
Was versteht Bourdieu unter dem „Habitus“?
Der Habitus ist ein System von dauerhaften Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmustern, das durch die soziale Herkunft geprägt wird und den Lebensstil einer Person bestimmt.
Wie hängen Kapitalformen und sozialer Raum zusammen?
Die Position eines Individuums im sozialen Raum wird durch sein ökonomisches, soziales und insbesondere sein kulturelles Kapital bestimmt.
Was bedeutet „Distinktion“ im Zusammenhang mit Konsum?
Distinktion bezeichnet das Bedürfnis, sich durch einen bestimmten Konsumstil (z. B. Markenkleidung oder exklusive Güter) von anderen sozialen Gruppen abzugrenzen und den eigenen Status zu markieren.
Ist Bourdieus Theorie heute noch aktuell?
Obwohl seine Analyse auf der französischen Gesellschaft der 60er Jahre basiert, gilt das Konzept der sozialen Abgrenzung durch Konsum und Lebensstil als übertragbar auf moderne Klassengesellschaften.
Welche Rolle spielt Markenkleidung in dieser Analyse?
Markenkleidung dient in der Arbeit als Beispiel für ein Symbol, über das Inklusion in eine begehrte Gruppe oder Exklusion von anderen Gruppen (Distinktionseffekt) erzielt wird.
- Arbeit zitieren
- Laura Schiemann (Autor:in), 2013, Geschmack, Distinktion und Konsum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263100