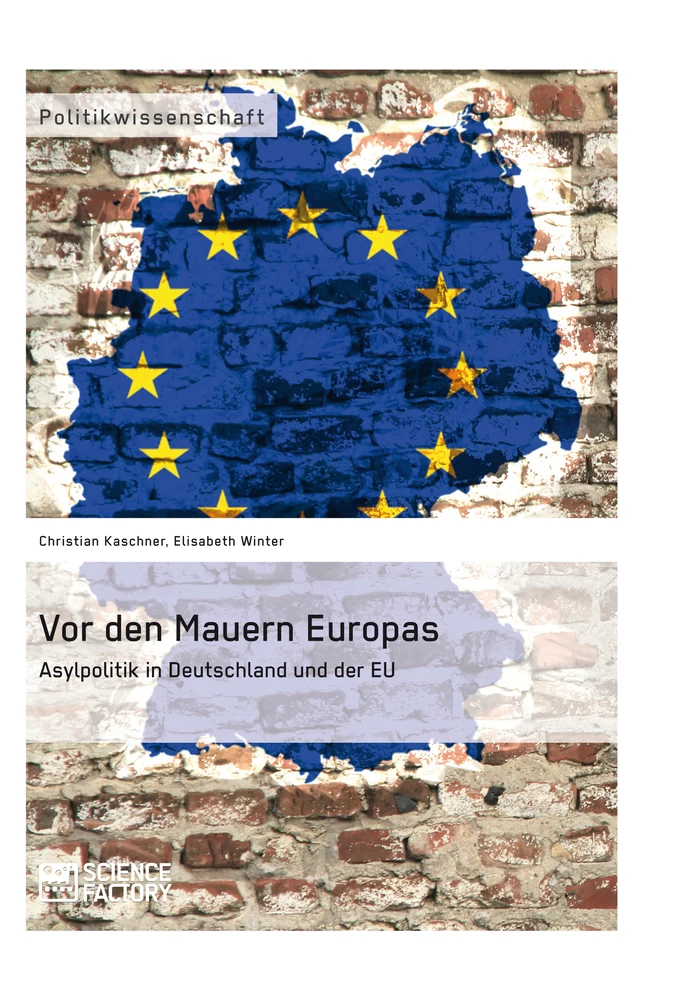Bis zu welchem Grad reicht die Verantwortung für Menschen, die tagtäglich die Flucht nach Europa wagen? Nicht erst seit den Unruhen im Nahen Osten ist der Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden ein kontrovers diskutiertes Thema in der Politik. In Deutschland ebenso wie im gesamteuropäischen Kontext geht es um die Frage: Schutz oder Abschottung?
Dieses Buch gibt einen Einblick in die Grundzüge der europäischen und deutschen Asylpolitik in ihren Entwicklungen, die den Begriff der „Festung Europa“ prägten. Doch wie europäisiert ist die Flüchtlingspolitik wirklich?
Aus dem Inhalt:
Historische Grundlagen der Einwanderungspolitik
Kooperation: Die Genese eines gemeinsamen europäischen Asylsystems
Das Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und Integration
Theorien der europäischen Integration
Inhaltsverzeichnis
- Vor den Mauern Europas Asylpolitik in Deutschland und der EU
- Christian Kaschner (2010): Ist die Entwicklung eines Gesamtkonzepts bei nationalen Steuerungsversuchen im Bereich der Asyl- und Einwanderungspolitik der Europäischen Union nötig?
- Einführung
- Migration in Europa
- Asyl- und Einwanderungspolitik in ausgewählten Mitgliedstaaten der EU
- Asyl- und Einwanderungspolitik der Europäischen Union
- Etablierung eines europäischen Gesamtkonzepts
- Elisabeth Winter (2012): Die Asylpolitik der Europäischen Union im Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und fortschreitender Integration
- Einleitung
- Ausgewählte Theorien der Europäischen Integration
- Die Herausbildung europäischer Kompetenzen im Bereich Asyl
- Die Genese eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der europäischen Asylpolitik, insbesondere die Herausforderungen bei der Harmonisierung nationaler Asylsysteme innerhalb der Europäischen Union. Sie untersucht, warum der Prozess der Integration der Asylpolitik trotz bestehender Verpflichtungen der Mitgliedstaaten so langsam voranschreitet.
- Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und europäischer Integration im Bereich Asyl
- Analyse der wichtigsten Entwicklungsschritte in der europäischen Asylpolitik seit den 1990er Jahren
- Anwendung von Integrationstheorien (Neofunktionalismus und Liberaler Intergouvernementalismus) zur Erklärung der Entwicklung
- Bewertung des Fortschritts beim Aufbau des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS)
- Diskussion der Notwendigkeit eines Gesamtkonzepts für die Asyl- und Einwanderungspolitik der EU
Zusammenfassung der Kapitel
Vor den Mauern Europas Asylpolitik in Deutschland und der EU: Dieser Abschnitt liefert eine umfassende Einführung in die Thematik der Asyl- und Einwanderungspolitik in der EU und ausgewählten Mitgliedsstaaten. Er beleuchtet die historische Entwicklung der Migration in Europa, die unterschiedlichen nationalen Ansätze zur Asyl- und Einwanderungspolitik in Deutschland, Frankreich und Großbritannien, und skizziert die Herausforderungen bei der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik.
Christian Kaschner (2010): Ist die Entwicklung eines Gesamtkonzepts bei nationalen Steuerungsversuchen im Bereich der Asyl- und Einwanderungspolitik der Europäischen Union nötig?: Kaschners Arbeit untersucht die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Asyl- und Einwanderungspolitik angesichts nationaler Steuerungversuche. Sie analysiert die Herausforderungen der Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten und diskutiert die Notwendigkeit eines Gesamtkonzepts, welches sowohl nationale Besonderheiten als auch supranationale Interessen berücksichtigt.
Elisabeth Winter (2012): Die Asylpolitik der Europäischen Union im Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und fortschreitender Integration: Winters Arbeit analysiert die Herausforderungen bei der Entwicklung einer gemeinsamen Asylpolitik in der EU. Sie nutzt Integrationstheorien, um die Entwicklung der Asylpolitik zu erklären und untersucht das Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und dem Ziel eines gemeinsamen europäischen Asylsystems. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Phasen der Integration und die Rolle der EU-Institutionen.
Schlüsselwörter
Asylpolitik, Einwanderungspolitik, Europäische Union, Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS), Nationale Souveränität, Integrationstheorien, Neofunktionalismus, Liberaler Intergouvernementalismus, Dublin-Verordnung, Schengen-Raum, Migrationsströme, Flüchtlinge, subsidiärer Schutz, Solidarität, Harmonisierung, Rückführung.
Häufig gestellte Fragen zu: Asylpolitik in der EU - Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung der europäischen Asylpolitik, insbesondere die Herausforderungen bei der Harmonisierung nationaler Asylsysteme innerhalb der Europäischen Union. Ein Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung der Gründe für das langsame Fortschreiten der Integration der Asylpolitik trotz bestehender Verpflichtungen der Mitgliedstaaten. Die Arbeit bezieht sich auf die Schriften von Kaschner (2010) und Winter (2012) und beleuchtet das Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und europäischer Integration in diesem Bereich.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und europäischer Integration im Asylbereich; die wichtigsten Entwicklungsschritte der europäischen Asylpolitik seit den 1990er Jahren; die Anwendung von Integrationstheorien (Neofunktionalismus und Liberaler Intergouvernementalismus) zur Erklärung der Entwicklung; die Bewertung des Fortschritts beim Aufbau des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS); und die Diskussion der Notwendigkeit eines Gesamtkonzepts für die Asyl- und Einwanderungspolitik der EU.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf zwei zentrale Quellen: Christian Kaschner (2010): Ist die Entwicklung eines Gesamtkonzepts bei nationalen Steuerungsversuchen im Bereich der Asyl- und Einwanderungspolitik der Europäischen Union nötig? und Elisabeth Winter (2012): Die Asylpolitik der Europäischen Union im Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und fortschreitender Integration. Zusätzlich bietet die Arbeit eine umfassende Einführung in die Thematik, inklusive der historischen Entwicklung der Migration in Europa und der Betrachtung nationaler Ansätze in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten.
Welche Schlüsselkonzepte werden verwendet?
Schlüsselkonzepte sind: Asylpolitik, Einwanderungspolitik, Europäische Union, Gemeinsames Europäisches Asylsystem (GEAS), Nationale Souveränität, Integrationstheorien (Neofunktionalismus, Liberaler Intergouvernementalismus), Dublin-Verordnung, Schengen-Raum, Migrationsströme, Flüchtlinge, subsidiärer Schutz, Solidarität, Harmonisierung und Rückführung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Asylpolitik in Deutschland und der EU, detaillierte Analysen der Arbeiten von Kaschner (2010) und Winter (2012) sowie ein Fazit (implizit in der Zusammenfassung der Kapitel enthalten). Jedes Kapitel bietet eine umfassende Analyse seines jeweiligen Themas.
Was ist die zentrale These oder Fragestellung?
Die zentrale Fragestellung ist, warum die Integration der Asylpolitik in der EU trotz bestehender Verpflichtungen der Mitgliedstaaten so langsam voranschreitet. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen, die diesem Prozess innewohnen, und bewertet die Notwendigkeit eines umfassenden Gesamtkonzepts für die Asyl- und Einwanderungspolitik der EU.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen ergeben sich aus den Analysen der beiden zentralen Arbeiten und der umfassenden Einführung in das Thema. Die Arbeit deutet auf die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit und Harmonisierung der Asylpolitik innerhalb der EU hin, unter Berücksichtigung der Spannungen zwischen nationaler Souveränität und europäischen Integrationszielen. Konkrete Schlussfolgerungen sind implizit in den Kapitelzusammenfassungen enthalten.
- Quote paper
- Christian Kaschner (Author), Elisabeth Winter (Author), 2013, Vor den Mauern Europas. Asylpolitik in Deutschland und der EU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263196