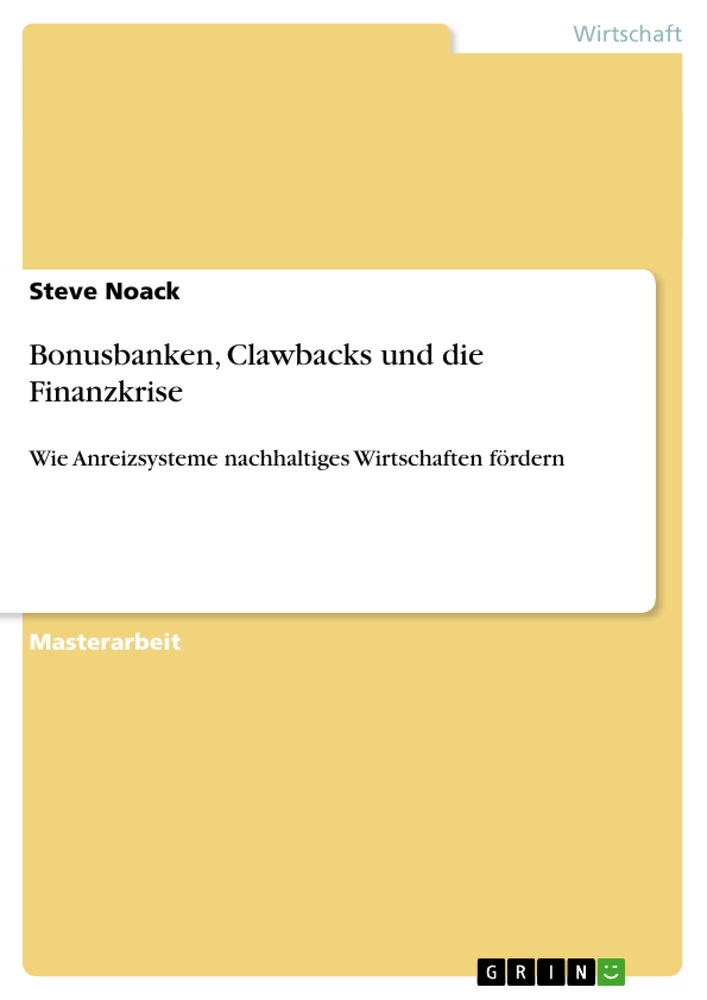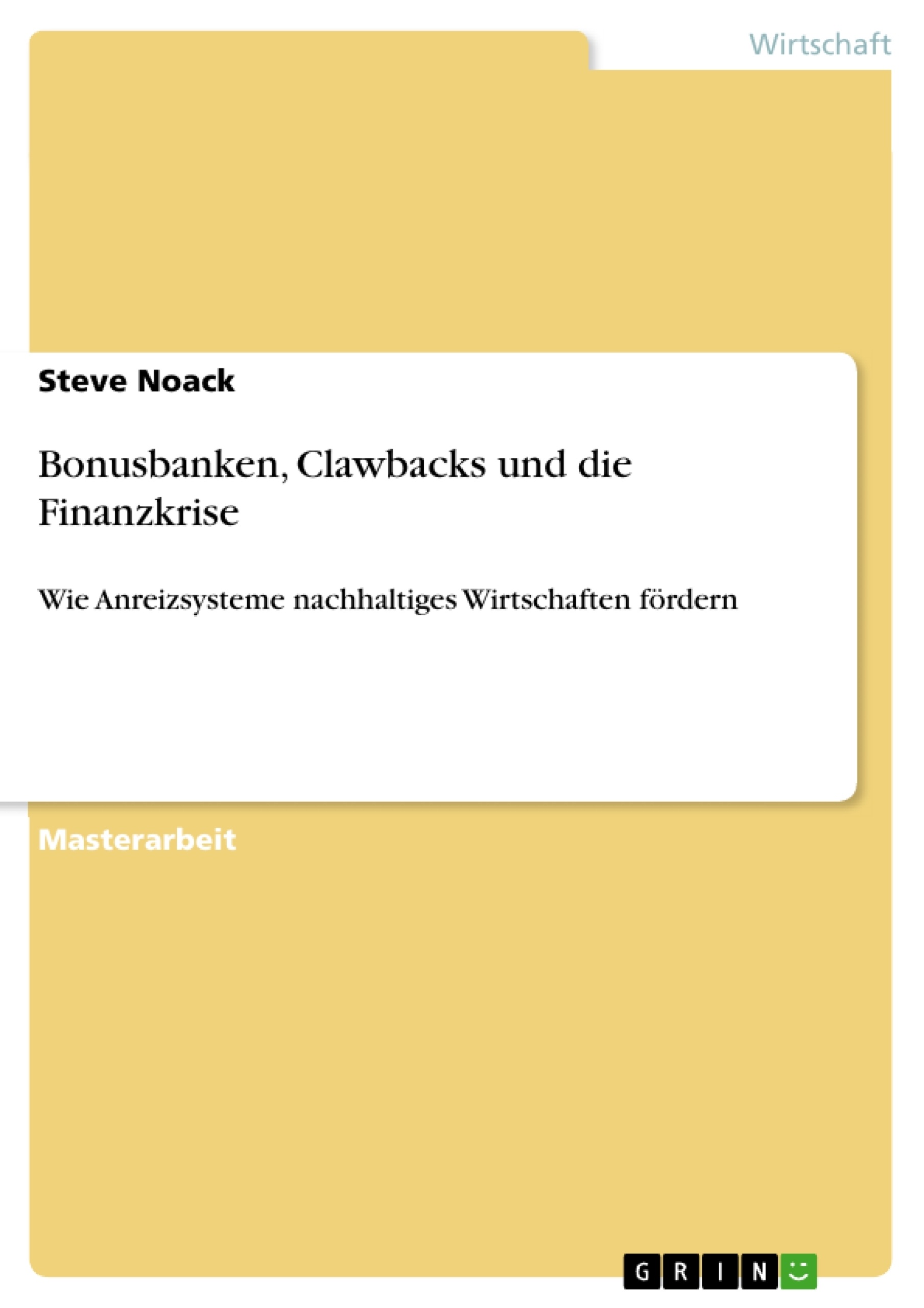„Das Geld zieht nur den Eigennutz an und verführt stets unwiderstehlich zum Missbrauch“
[Albert Einstein]
Dieses Zitat von Albert Einstein, worin er das Streben nach Geld als Ursache des Missbrauchs bezeichnet, stammt aus dem Jahr 1953. Im Zuge der internationalen Finanzkrise und der daraus resultierenden Ursachenforschung wurde die Gier nach hohen Bonuszahlungen einiger Manager als ein Grund der Finanzkrise herausgestellt. Doch genau diese Maximierung des Eigennutzens beschreibt ein Grundprinzip der Ökonomie: das des homo oeconomicus. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass dieser Eigennutz zur Ausblendung hoher Risiken geführt hat. Insbesondere in Krisenzeiten, wie der internationalen Finanzkrise, wird diese Vorgehensweise von Gesellschaft und Politik fokussiert und kritisiert.
Die Presse sprach während und nach der Finanzkrise von „Bankern ohne Gewissen“ mit einer „grenzenlosen Gier“, welche das eigene Wohl über das Wohl der Gesellschaft stellen. In Folge dieser negativen Berichterstattung wuchs die Wut und das Unverständnis über die Vergütungspraxis und die daraus resultierenden exzessiven Bonuszahlungen. Vor allem in den USA wurde diese Diskussion sehr heftig geführt, weil hier fast täglich über neue Millionen-Boni berichtet wurde.
Das Ziel dieser Arbeit ist liegt nicht darin, zu beurteilen, ob die Höhe der Vergütung für Manager gerecht oder ungerecht ist. Vielmehr soll der Frage nachgegangen werden, welche Anforderungen Anreizsysteme erfüllen müssen, damit sie nachhaltig wirken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Konzeptionelle Grundlagen
- 2.1 Anreiz und Anreizsystem
- 2.2 Prinzipal-Agenten-Theorie
- 2.3 Motivationstheoretische Fundierung von Anreizsystemen
- 3. Die Finanzkrise und ihre Auswirkung auf die Gestaltung von Anreizsystemen
- 3.1 Die internationale Finanzkrise 2007 bis 2009
- 3.2 Forderungen zur Ausgestaltung von Anreizsystemen
- 3.2.1 Institute of International Finance
- 3.2.2 Kommission der Europäischen Gemeinschaften
- 3.2.3 G-20 Gipfel
- 3.3 Zentrale Anforderungen nachhaltig gestalteter Anreizsysteme
- 4. Gestaltung wertorientierter Anreizsysteme
- 4.1 Adressatenkreis
- 4.2 Bemessungsgrundlage
- 4.3 Auszahlungsmodus
- 4.4 Art der Incentivierung
- 4.5 Belohnungsfunktion
- 4.6 Kurzfazit
- 5. Vorstandsvergütung in Deutschland und den USA
- 5.1 Vorstandsvergütung in Deutschland
- 5.1.1 Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung
- 5.1.2 Entwicklung der Vergütungsstruktur
- 5.1.3 Eingeleitete Maßnahmen zur Umsetzung des VorstAG
- 5.2 Vorstandsvergütung in den USA
- 5.2.1 Der Dodd-Frank Act in den USA
- 5.2.2 Vergütungsstruktur in den USA
- 5.2.3 Say-on-Pay
- 5.3 Vergleich der Vergütung in den USA und Deutschland
- 6. Bonus-Malus-System
- 6.1 Bonus-Malus-Systeme in Deutschland
- 6.2 Wirkungsweise klassischer Bonussysteme
- 6.3 Die Bonusbank als Sonderform eines Bonus-Malus-System
- 6.3.1 Prinzip einer Bonusbank
- 6.3.2 Wirkung der Bonusbank
- 6.3.3 Bewertung der Bonusbank als nachhaltiges Anreizsystem
- 7. Clawbacks
- 7.1 Begriffsbestimmung
- 7.2 Anforderungen an Clawbacks
- 7.3 Umsetzung in der Praxis
- 7.3.1 Verbreitung von Clawbacks in den Fortune 100
- 7.3.2 Auslöser von Clawbacks
- 7.3.3 Betroffene Vergütungsbestandteile
- 7.3.4 Zusammenfassung
- 8. Wirkungsweise von Clawbacks
- 8.1 Wirkung von Clawbacks aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht
- 8.2 Auswirkung von Clawback Vereinbarungen
- 8.3 Negative Wirkungen von Clawbacks
- 8.4 Bewertung von Clawbacks als nachhaltiges Anreizsystem
- 9. Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Anreizsysteme nachhaltiges Wirtschaften fördern können, insbesondere im Kontext der Finanzkrise.
- Analyse der Auswirkungen der Finanzkrise auf die Gestaltung von Anreizsystemen
- Bewertung verschiedener Ansätze zur Gestaltung von Anreizsystemen, wie Bonus-Malus-Systeme und Clawbacks
- Untersuchung der Wirkungsweise von Clawbacks aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht
- Diskussion der Vor- und Nachteile von Clawbacks als nachhaltige Anreizmechanismen
- Einordnung der Ergebnisse in den aktuellen Diskurs über die Gestaltung von Anreizsystemen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit erläutert. Anschließend werden in Kapitel 2 die konzeptionellen Grundlagen von Anreizsystemen, insbesondere die Prinzipal-Agenten-Theorie und motivationstheoretische Aspekte, dargestellt. Kapitel 3 analysiert die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Gestaltung von Anreizsystemen und beleuchtet die Forderungen nach nachhaltig gestalteten Anreizsystemen. In Kapitel 4 werden die Gestaltungsdimensionen wertorientierter Anreizsysteme diskutiert. Kapitel 5 vergleicht die Vorstandsvergütung in Deutschland und den USA, wobei das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) und der Dodd-Frank Act in den USA beleuchtet werden.
Kapitel 6 widmet sich dem Bonus-Malus-System und stellt die Bonusbank als Sonderform vor. In Kapitel 7 werden Clawbacks, ihre Anforderungen und ihre Umsetzung in der Praxis, ausführlich behandelt. Kapitel 8 untersucht die Wirkungsweise von Clawbacks aus verhaltenswissenschaftlicher Sicht und analysiert die Auswirkungen von Clawback-Vereinbarungen. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 9.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Anreizsysteme, nachhaltiges Wirtschaften, Finanzkrise, Bonus-Malus-Systeme, Bonusbanken, Clawbacks, verhaltenswissenschaftliche Aspekte, Vorstandsvergütung, Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung, Dodd-Frank Act, Say-on-Pay.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatten Bonuszahlungen auf die Finanzkrise?
Hohe, kurzfristig orientierte Boni förderten exzessive Risikobereitschaft bei Managern, was als ein wesentlicher Auslöser für die internationale Finanzkrise 2007-2009 gilt.
Was ist eine Bonusbank?
Eine Bonusbank ist ein System, bei dem Boni nicht sofort ausgezahlt, sondern auf einem Konto angesammelt werden. Bei späteren Verlusten können diese Beträge wieder einbehalten werden (Malus-Prinzip).
Was versteht man unter "Clawbacks"?
Clawbacks sind Vertragsklauseln, die es Unternehmen ermöglichen, bereits ausgezahlte Boni von Managern zurückzufordern, falls sich herausstellt, dass Leistungen auf Fehlern oder Manipulationen beruhten.
Was regelt das VorstAG in Deutschland?
Das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG) verpflichtet Unternehmen dazu, Vergütungssysteme nachhaltig und langfristig auszurichten und die Angemessenheit der Gehälter sicherzustellen.
Was bedeutet "Say-on-Pay"?
Say-on-Pay bezeichnet das Recht der Aktionäre, in der Hauptversammlung über das Vergütungssystem des Vorstands abzustimmen.
- Arbeit zitieren
- Steve Noack (Autor:in), 2013, Bonusbanken, Clawbacks und die Finanzkrise, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263212