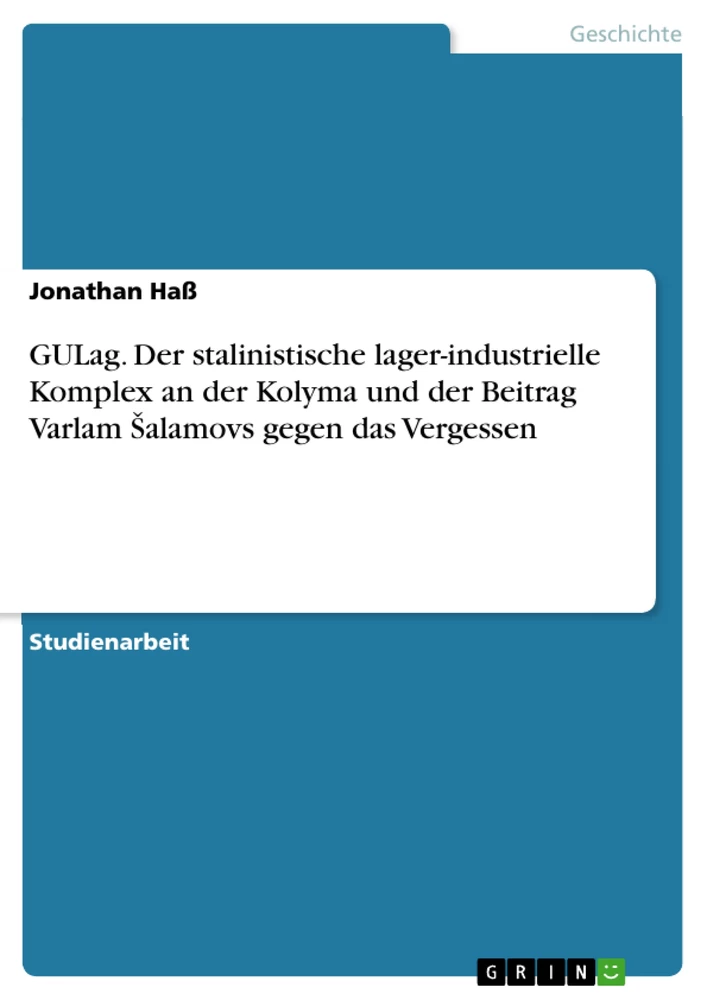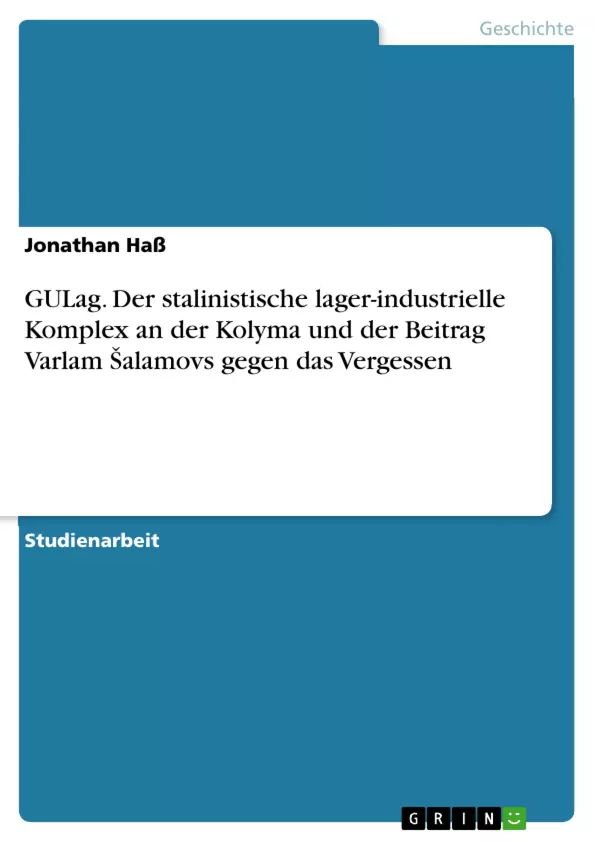„Das, was ich gesehen habe – soll ein Mensch nicht sehen und nicht einmal wissen.“ Diese Aussage legt der Schriftsteller Varlam Šalamov einer seiner Figuren in den „Erzählungen aus Kolyma“ in den Mund. Er verweist damit auf sein zutiefst bitteres Schicksal und gleichermaßen auf das unsägliche Leid, welches das stalinistische „Terrorregime“ in den Weiten des hohen Nordostens der Sowjetunion im Zeitalter des GULag hunderttausenden von Menschen zugefügt hat.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich im Rahmen des Hauptseminars „Raum(ge)schichten Osteuropas, 18.-20. Jahrhundert“ mit der punitiven und ökonomischen Durchdringung des Raumes an der Kolyma im Zuge des Aufstiegs der „Stalin-Ära“, der Wandlung des Raumes zum separierten „industriellen Lagerkomplex“ bis hin zur schrittweisen Auflösung des „Sondergebietes“ im Rahmen der „Tauwetterperiode“. Der vollständigen Umwandlung des Raumes in politischer, wirtschaftlicher und mentaler Hinsicht wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Der spezielle Fokus liegt im Anschluss an die Institutionsgeschichte auf der Raumwahrnehmung in der Literatur Varlam Šalamovs, wobei sowohl auf die spezifische Lagerterminologie hinsichtlich der Raumempfindung als auch auf den „raumlos“ wirkenden Stil der „neuen Prosa“ des Schriftstellers eingegangen wird. Abschließend bleibt nach einer teilweisen literaturwissenschaftlichen Analyse der „Erzählungen aus Kolyma“ zu klären, welchen Stellenwert das Werk Šalamovs im Rahmen der Verdrängungsmechanismen nach der Umgestaltung des „Sondergebietes“ zur regulären oblast‘ einnimmt.
Vor dem Hintergrund des Seminars, welches die räumlichen Aspekte der geschichtlichen Welt in das Zentrum der Betrachtung rückt, soll auch der vorliegenden Arbeit der „Raum“ als Maßstab der Analysen dienen. Die „Raum-Formel“ des Geografie-Historikers Hans-Dietrich Schulz, „Räume sind nicht, Räume werden gemacht!“ , gilt somit als Ausgangsbasis für alle Überlegungen, welche der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen.
Bei der Verwendung von Sekundärliteratur zur Thematik wurde hauptsächlich auf die Aufsätze der Themenhefte „Aufbruch aus dem GULag?“ und „Das Lager Schreiben. Varlam Šalamov und die Aufarbeitung des Gulag“ zurückgegriffen. Die insgesamt berücksichtigten Sekundärwerke sind alle nach der Öffnung der russischen „GULag-Archive“ verfasst worden und reihen sich somit in den Kreis der wissenschaftlich fundierten und archivgestützten Literatur ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Institutionsgeschichte
- Erschließung des Raumes an der Kolyma
- Aufbauphase und punitiv-ökomische Durchdringung des Gebietes
- Entwicklung der Region zum politischen „Sonderstatus“
- „Ein Kombinat besonderen Typs“ - Umgestaltung des hohen Nordens zum „Sonderlager“
- Der Kolyma-Raum unter der „Einheitsleitung“ des NKVD
- Spezielle „Sonderrechte“ des lager-industriellen Großprojekts
- Erste Zeichen des Umbruchs an der Kolyma
- Raum im Wandel – Kontinuierlicher Zerfall eines Großprojekts
- Der „Staat im Staate“ vernichtet sich selbst
- Umgestaltung und Reformierung des Systems in der Zeit der „Tauwetterperiode“
- Entstalinisierung und zivile Erschließung des Kolyma-Gebietes
- Umstrukturierungen des „Herrschaftsraums“
- Umstrukturierungen des „Wirtschaftsraums“
- Umstrukturierungen des „Erfahrungsraums“
- Zwischenfazit
- Raum in der Literatur Varlam Šalamovs
- Allgemeines
- Eckpunkte im Leben Varlam Šalamovs
- Raumterminologie und Raumwahrnehmung im Lager
- Literaturwissenschaftliche Perspektiven der Literatur Varlam Šalamovs
- Wirkung der „neuen Prosa“
- Motivik der Literatur Šalamovs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Kolyma-Raumes im Kontext des sowjetischen GULag-Systems vom Beginn der stalinistischen Herrschaft bis zur „Tauwetterperiode“. Sie beleuchtet die politische, wirtschaftliche und mentale Transformation des Raumes, die durch die Zwangsarbeit und den industriellen Lagerkomplex geprägt wurde. Darüber hinaus analysiert die Arbeit die Raumwahrnehmung in der Literatur Varlam Šalamovs und beleuchtet die spezifische Lagerterminologie sowie den „raumlos“ wirkenden Stil der „neuen Prosa“.
- Die punitiv-ökonomische Durchdringung des Kolyma-Raumes
- Die Umwandlung des Raumes zum industriellen Lagerkomplex
- Die schrittweise Auflösung des „Sondergebietes“
- Die Raumwahrnehmung in der Literatur Varlam Šalamovs
- Der Stellenwert des Werkes Šalamovs im Kontext der Verdrängungsmechanismen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Kontext der Untersuchungen und die zentrale These vor, indem sie auf das Leid der Gefangenen im stalinistischen „Terrorregime“ und die Rolle Varlam Šalamovs als literarischer Zeuge hinweist.
- Institutionsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Erschließung des Kolyma-Raumes und die Entstehung des Industriekombinats Dalʻstroj und des Lagerkomplexes Sevvostlag. Es beschreibt die vernetzte Repression und ökonomische Ausbeutung der Gefangenen sowie die extreme Lage und klimatischen Bedingungen der Region.
- „Ein Kombinat besonderen Typs“: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Umwandlung des Kolyma-Raumes zum „Sonderlager“ unter der Leitung des NKVD. Es beleuchtet die Besonderheiten und „Sonderrechte“ des Lager-industriellen Großprojekts und zeigt erste Zeichen des Umbruchs.
- Raum im Wandel: Dieses Kapitel beschreibt den kontinuierlichen Zerfall des „Sondergebietes“ und beleuchtet den Selbstzerfall des „Staats im Staate“ sowie die Umgestaltung und Reformierung des Systems während der „Tauwetterperiode“.
- Entstalinisierung und zivile Erschließung des Kolyma-Gebietes: Dieses Kapitel behandelt die Umstrukturierungen des „Herrschaftsraums“, des „Wirtschaftsraums“ und des „Erfahrungsraums“ im Zuge der Entstalinisierung.
- Raum in der Literatur Varlam Šalamovs: Dieses Kapitel beleuchtet die Raumwahrnehmung in der Literatur Šalamovs, die spezifische Lagerterminologie und den „raumlos“ wirkenden Stil seiner „neuen Prosa“.
Schlüsselwörter
GULag, Kolyma, Sevvostlag, Dalʻstroj, Varlam Šalamov, „Erzählungen aus Kolyma“, Stalinismus, Zwangsarbeit, industrieller Lagerkomplex, Raumwahrnehmung, „Sondergebiet“, „Tauwetterperiode“, „neue Prosa“, Verdrängungsmechanismen
Häufig gestellte Fragen
Was war der GULag-Komplex an der Kolyma?
Es handelte sich um ein stalinistisches System von Zwangsarbeitslagern im Nordosten der Sowjetunion, das primär der Goldförderung und industriellen Erschließung unter extremen Bedingungen diente.
Wer war Varlam Šalamov?
Šalamov war ein russischer Schriftsteller, der selbst viele Jahre in den Kolyma-Lagern verbrachte und in seinen „Erzählungen aus Kolyma“ das Leid der Gefangenen dokumentierte.
Was versteht man unter der "Raumwahrnehmung" im Lager?
Die Arbeit analysiert, wie der Raum Kolyma durch Repression und Arbeit transformiert wurde und wie Šalamov diesen Raum in einem fast „raumlosen“ Stil literarisch verarbeitete.
Was änderte sich in der sogenannten „Tauwetterperiode“?
Nach Stalins Tod kam es zu einer schrittweisen Auflösung der Sondergebiete und einer Umwandlung der Lagerregionen in reguläre Verwaltungsgebiete (Oblasten).
Was war das Industriekombinat „Dal’stroj“?
Dal’stroj war die staatliche Organisation des NKVD, die die absolute Herrschaft über die Wirtschaft und die Lager im Kolyma-Gebiet ausübte.
- Quote paper
- Jonathan Haß (Author), 2011, GULag. Der stalinistische lager-industrielle Komplex an der Kolyma und der Beitrag Varlam Šalamovs gegen das Vergessen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263226