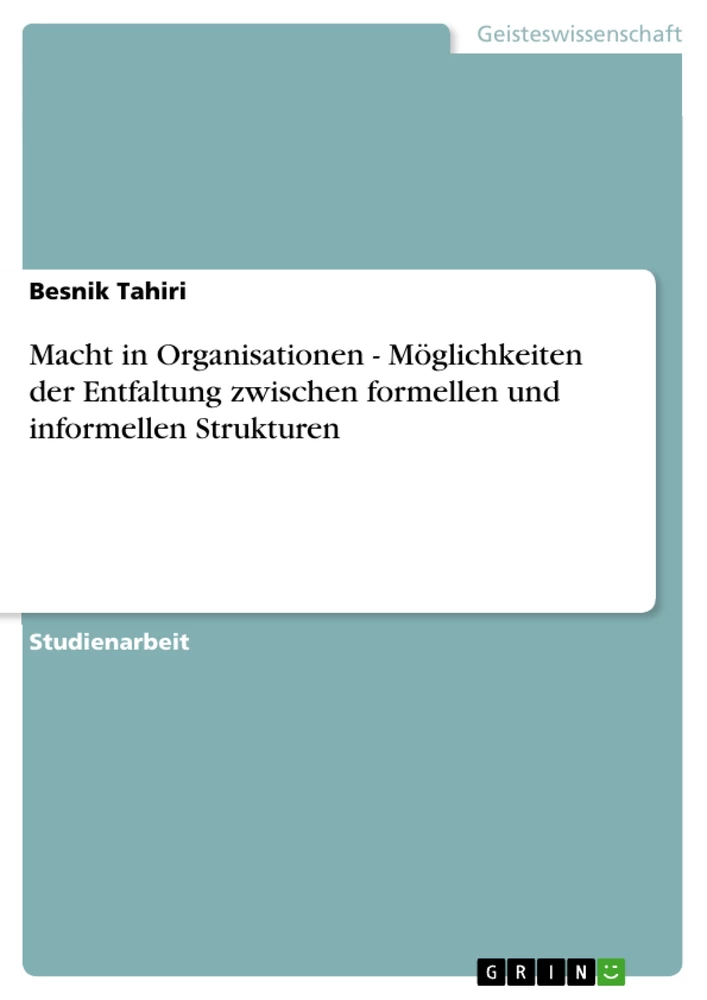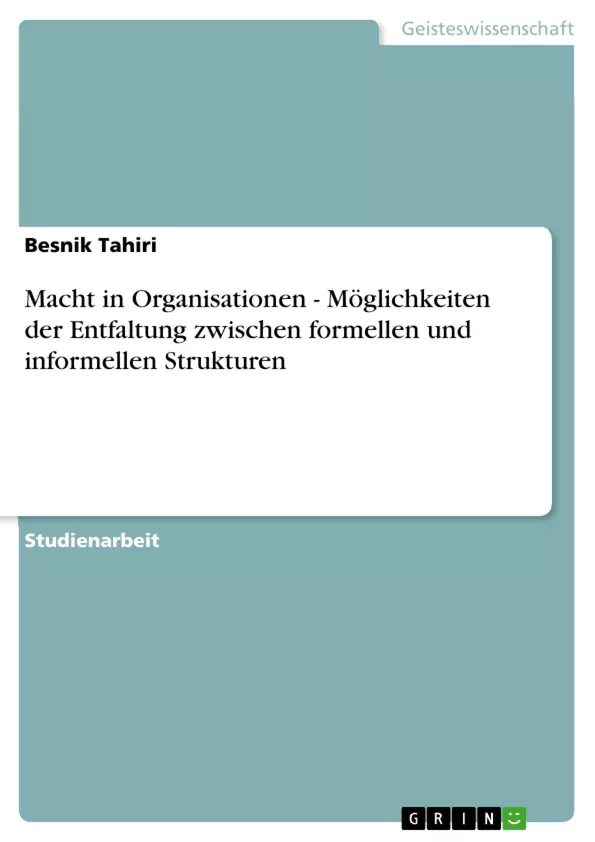In Organisationen sind alle Organisationsmitglieder in einem Geflecht von Beziehungen involviert. Sie erfüllen im Rahmen einer Arbeitsteilung ihre Aufgaben und befinden sich demnach primär in Arbeitsbeziehungen. In diesem Geflecht treffen Organisationsmitglieder aufeinander, die entweder gleich mächtig sind, unterlegen oder überlegen, sprich, mehr oder weniger Macht haben als andere. Der Erwerb von Machtmitteln ist ein dynamischer Prozess, der von allen Organisationsmitgliedern unterschiedlich intensiv und erfolgsgekrönt anvisiert wird. Demnach ist es nicht verwunderlich, dass es in Organisationen zu Machtkämpfen kommt, deren Ausgang offen ist, denn nur dann werden diese auch ausgetragen (Haubl/ Daser 2007: 7).
Da die Ausübung von Macht konstruktive und destruktive Folgen haben kann, wird explizit gefordert, sie zu kontrollieren, da sonst eine Organisationskultur entsteht, die allen schadet (Haubl/ Daser 2007: 8).
Angesichts dieser Fakten stellt sich die Frage, ob und wie die Ausübung von Macht kontrollierbar ist. Ist es gar möglich, Macht in Organisationen abzuschaffen? Das Abschaffen ist nicht Ziel der Erforschung von Machtbeziehungen, vielmehr werden Ausprägungen und Formen beschrieben. Macht kann verwendet werden, um anderen Mitgliedern Angst zu machen, was nicht nur die Kreativität und Arbeitsmotivation lähmt; daraus folgen auch Feindseligkeiten untereinander, die das Funktionieren der Organisation beeinträchtigen. Hingegen bedeutet ein Ablehnen der Macht, also sich aus Machtkämpfen raushalten und nicht teilnehmen, das Verschleiern, was den Missbrauch wiederum begünstigt (Haubl/ Daser 2007: 8). Dass Macht scheinbar ein fester Bestandteil von Organisationen ist, sei nun bekannt. Fraglich ist, unter welchen Bedingungen und in welchem Rahmen sich Macht in Organisationen am besten entfalten kann. Hierbei wird zwischen formeller und informeller Struktur unterschieden.
Der vorliegende Beitrag setzt sich mit der zuletzt genannten Fragestellung auseinander. Es wird nicht explizit nach einer Lösung des Problems gesucht; vielmehr soll untersucht werden, durch welche Faktoren und unter welchen Gegebenheiten die Machtentfaltung begünstigt wird. Diesbezüglich werden zunächst Begriffsdefinitionen geklärt, um die nötigen Bedingungen zu schaffen: Was ist Macht? Was sind Organisationen und was ist zwischen informeller und formeller Verfassung zu verstehen? Danach wird Macht als Vakuum der Formalität und Informalität in Organisationen thematisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen: Macht, Organisation und formelle/ informelle Struktur
- Was ist Macht?
- Was ist eine Organisation?
- Formelle und informelle Strukturen in Organisationen
- Macht in Organisationen – Möglichkeiten der Entfaltung zwischen formellen und informellen Strukturen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Beitrag befasst sich mit der Frage, wie Macht in Organisationen zwischen formellen und informellen Strukturen agiert. Dabei geht es weniger um die Abschaffung von Macht, sondern um die Analyse von Formen und Auswirkungen ihrer Ausübung.
- Definition von Macht und Organisation
- Unterscheidung zwischen formellen und informellen Strukturen in Organisationen
- Macht als Vakuum der Formalität und Informalität
- Analyse der Machtentfaltung in verschiedenen organisationalen Kontexten
- Bedeutung von Macht für die Organisationskultur und das Zusammenspiel der Mitglieder
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt ein in die Thematik und stellt die Relevanz der Machtbeziehungen in Organisationen dar. Es wird auf die Ambivalenz von Macht und die Notwendigkeit ihrer Kontrolle eingegangen, um negative Auswirkungen auf die Organisationskultur zu vermeiden.
Kapitel 2 widmet sich der Klärung von Begriffen wie Macht, Organisation und der Unterscheidung zwischen formellen und informellen Strukturen. Die Definitionen von Macht und Organisation werden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und durch verschiedene Machttypen veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Beitrags sind Macht, Organisation, formelle Strukturen, informelle Strukturen, Machtentfaltung, Organisationskultur, Arbeitsbeziehungen, Machtkämpfe, Kontrollmechanismen, Machttypen, Aktionsmacht, instrumentelle Macht, autoritative Macht, Macht des Datensetzens.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich formelle und informelle Strukturen?
Formelle Strukturen sind offiziell festgelegt (Organigramm), während informelle Strukturen durch persönliche Beziehungen und ungeschriebene Regeln entstehen.
Kann man Macht in Organisationen abschaffen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Macht ein fester Bestandteil von Organisationen ist; Ziel sollte daher nicht die Abschaffung, sondern die Kontrolle und konstruktive Nutzung sein.
Was sind die Gefahren von unkontrollierter Macht?
Unkontrollierte Macht kann Kreativität und Motivation lähmen, Feindseligkeiten fördern und das Funktionieren der gesamten Organisation beeinträchtigen.
Welche Machttypen werden im Text genannt?
Es werden unter anderem Aktionsmacht, instrumentelle Macht, autoritative Macht und die Macht des Datensetzens unterschieden.
Warum führen informelle Strukturen oft zu Machtkämpfen?
Weil sie Handlungsspielräume bieten, die nicht durch formelle Regeln begrenzt sind, was Akteure nutzen, um eigene Interessen durchzusetzen.
- Arbeit zitieren
- Besnik Tahiri (Autor:in), 2013, Macht in Organisationen - Möglichkeiten der Entfaltung zwischen formellen und informellen Strukturen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263244