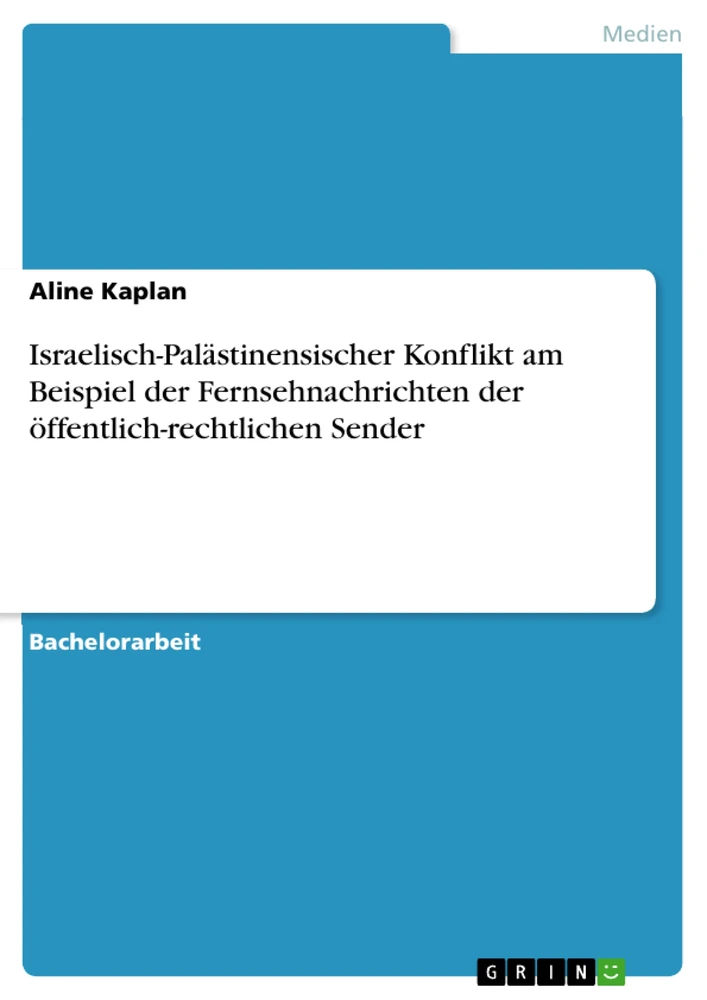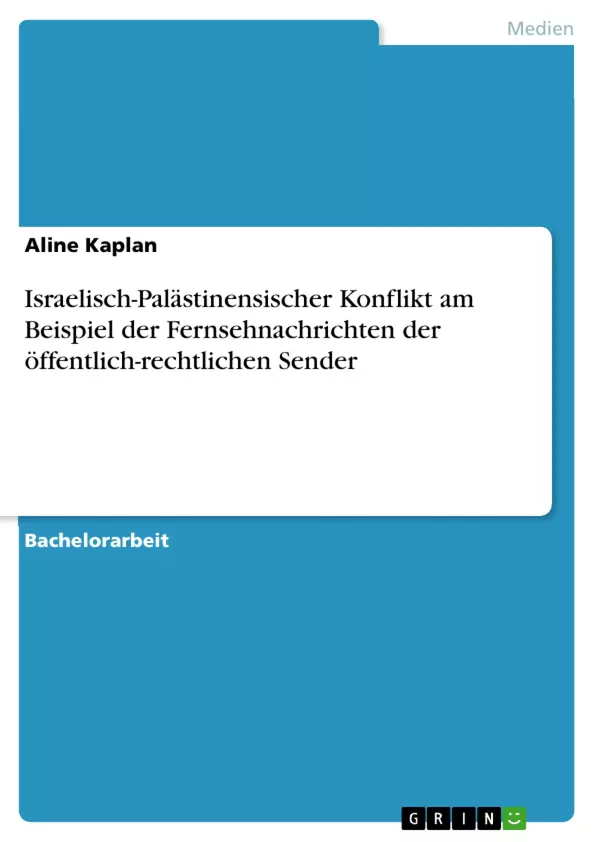"Das Bild vor das Auge gestellt, da bleibt der Geist ein Knecht.“
Johann Wolfgang von Goethe
Wie Journalisten und Medien über andere Länder referieren, prägt unsere
Wahrnehmung und Vorstellung über diese Länder entscheidend und nachhaltig.
Massenmedien fungieren in der interkulturellen Kommunikation als Schnittstelle
zwischen dem Weltgeschehen und der Bevölkerung. Durch die Abbildung
bestimmter Themen und die Auslassung anderer konstruieren Medien eine
spezifische Realität, die, anders als bei Geschehnissen im Inland, bei
Geschehnissen im Ausland von den Zuschauern auf Grund der fehlenden eigenen
Erfahrungen oder alternativer Informationsquellen nicht oder nur schwer
überprüfbar sind. Diese konstruierte mediale Realität kann Auswirkungen auf den
gesellschaftlichen und politischen Umgang mit anderen Ländern und Nationen
haben. Insbesondere die als einseitig negativ und falsch kritisierte
Berichterstattung über die Konflikte im Nahen Osten, sprich der
Auseinandersetzung von Israelis und Palästinensern, steht seit Jahrzehnten lang
schon im Fokus. Gerade diese Berichterstattung ist besonders kontrovers, weil mit ihr oft eine Antisemitismusdebatte verbunden ist: Dürfen Medien Israel
kritisieren? Wo ist die Grenze zwischen legitimer Israelkritik und
Antisemitismus? Ist die Kritik nur ein Vorwand, um judenfeindliche Ideen und
Gefühle zu artikulieren? Werden gar antisemitische Vorurteile und Stereotype
transportiert? Welche Rolle nehmen die Medien bei der Vermittlung von
Informationen, speziell im Hinblick auf die Berichterstattung über den
Nahostkonflikt ein? Tatsache ist, dass die Gratwanderung zwischen
Antisemitismus und Israelkritik schmal ist.
Inhaltsverzeichnis
-
-
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
- Einleitung
- THEORETISCHER TEIL
- Israel und der Nahost-Konflikt in den deutschen Nachrichten
- News Bias Theory
- Studien und ihre Ergebnisse
-
- Antisemitismus, Antizionismus und Israelbild in Deutschland
- Zum Begriff des Antisemitismus
- Antizionismus und sekundärer Antisemitismus im 20. Jahrhundert
- Antisemitische Stereotype, Vorurteile und das Feindbild Islam
- Zusammenfassung des theoretischen Teils
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Berichterstattung der ARD und ZDF über den Nahost-Konflikt im November 2012. Ziel ist es, die Darstellung des Konflikts durch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zu untersuchen und die Frage zu klären, ob und in welchem Maße antiisraelische Tendenzen in der Berichterstattung zu finden sind. Dabei wird insbesondere auf die Frage eingegangen, ob antisemitische Stereotype und Vorurteile in den Nachrichten transportiert werden und welche Rolle die Medien bei der Vermittlung von Informationen über den Konflikt spielen.
- News Bias Theory und ihre Anwendung auf die Berichterstattung über den Nahost-Konflikt
- Antisemitismus und Antizionismus im Kontext der Israel-Debatte
- Analyse der Berichterstattung über den Nahost-Konflikt in der ARD und ZDF
- Identifizierung von antiisraelischen Tendenzen in der Berichterstattung
- Bewertung der Rolle der Medien im Nahost-Konflikt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil setzt sich mit den Begriffen Antisemitismus und Antizionismus auseinander und beleuchtet die News Bias Theory, welche die tendenzielle Ausrichtung von Nachrichtenberichten erklärt. Der empirische Teil analysiert die Berichterstattung der ARD und ZDF über den Nahost-Konflikt anhand von ausgewählten Nachrichtenbeiträgen. Es werden formale und inhaltliche Variablen untersucht, um antiisraelische Tendenzen in der Berichterstattung aufzudecken.
Schlüsselwörter
Nahost-Konflikt, Israel, Palästina, Antisemitismus, Antizionismus, News Bias Theory, Medienberichterstattung, ARD, ZDF, Inhaltsanalyse, Stereotype, Vorurteile.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflussen Medien die Wahrnehmung des Nahost-Konflikts?
Medien konstruieren eine spezifische Realität, die Zuschauer mangels eigener Erfahrung oft nicht überprüfen können, was den gesellschaftlichen Umgang mit Israel prägt.
Was besagt die „News Bias Theory“?
Die Theorie untersucht die tendenzielle Ausrichtung von Nachrichtenberichten und erklärt, wie durch Auswahl oder Auslassung von Informationen eine einseitige Darstellung entstehen kann.
Wo verläuft die Grenze zwischen Israelkritik und Antisemitismus?
Die Arbeit analysiert Indikatoren wie die Nutzung antisemitischer Stereotype oder die Delegitimation Israels, um legitime Kritik von Judenfeindlichkeit abzugrenzen.
Was wurde in der Inhaltsanalyse von ARD und ZDF untersucht?
Untersucht wurde die Berichterstattung von „Tagesschau“ und „heute“ im November 2012 hinsichtlich formaler und inhaltlicher Variablen auf antiisraelische Tendenzen.
Gibt es einen „sekundären Antisemitismus“ in den Medien?
Die Arbeit beleuchtet, ob durch die Berichterstattung unbewusst oder verdeckt antisemitische Vorurteile und Feindbilder transportiert werden.
- Arbeit zitieren
- Aline Kaplan (Autor:in), 2013, Israelisch-Palästinensischer Konflikt am Beispiel der Fernsehnachrichten der öffentlich-rechtlichen Sender, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263289