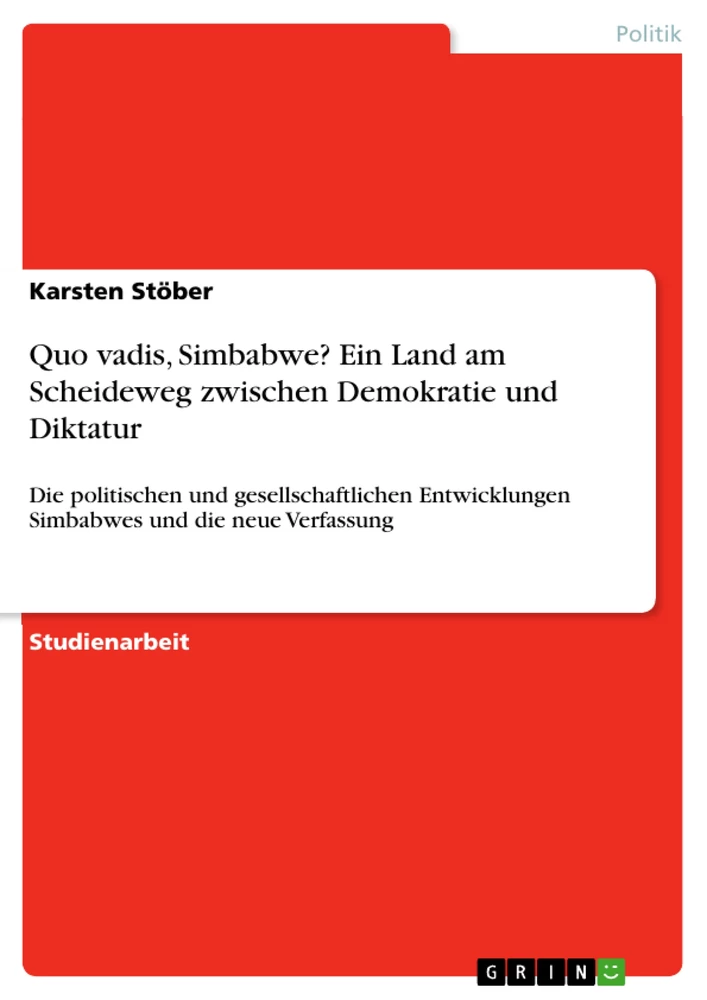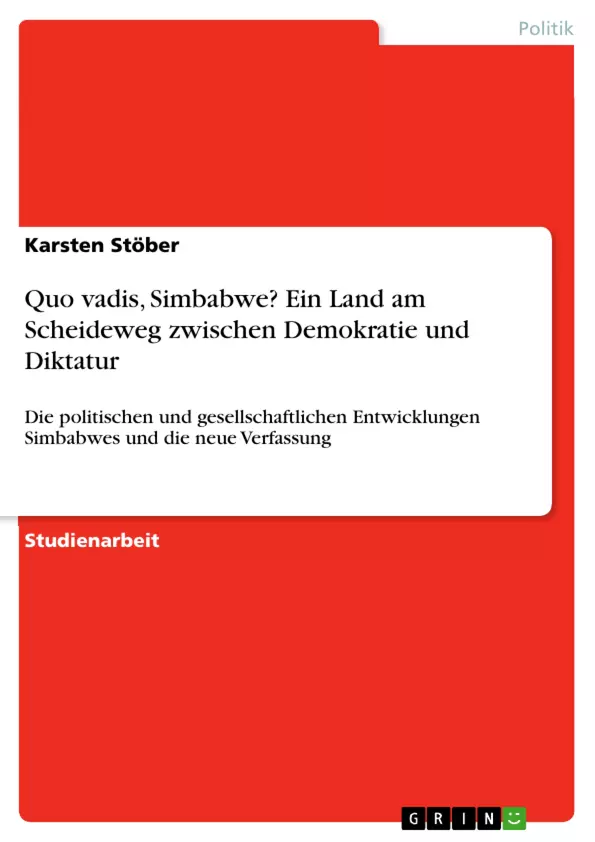Hoffnung keimt auf in Simbabwe. Die Partei ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) von Präsident Mugabe und der Koalitionspartner MDC (Movement for a Democratic Chance) einigten sich kürzlich nach jahrlangen Verhandlungen auf eine neue Verfassung, die per Referendum mit knapp 95 Prozent vom Volk angenommen wurde. Ob das Land dadurch demokratischer wird und die gewaltsamen Auseinandersetzungen ein Ende finden, bleibt abzuwarten.
Untersuchungsgegenstand dieser Hausarbeit ist eine Analyse der Prozesse, die zur Entstehung der Verfassung führten und eine Bewertung der Erfolgschancen für eine demokratische und gewaltfreie Entwicklung des Landes.
Im deskriptiven Teil gehe ich auf den historischen Hintergrund der gesellschaftlichen und politischen Konflikte in Simbabwe ein. Hierbei ist auch ein kurzer geschichtlicher Überblick hilfreich, da historische Faktoren wie die Kolonialherrschaft und ethnische Konflikte für die gegenwärtige Situation nach wie vor von Bedeutung sind.
Im analytischen Teil widme ich mich neben der Bewertung des historischen Hintergrunds Simbabwes der neuen Verfassung. Dabei versuche ich, auf zentrale Fragen Antworten zu geben: Welche bedeutsamen Veränderungen sind in der neuen Verfassung vorgesehen? Welche Auswirkungen könnte sie für das politische System und die gesellschaftlichen Konflikte haben? Wie groß sind die Erfolgschancen für eine friedliche und demokratische Entwicklung? Wie ist die Kritik der Nichtregierungsorganisationen zu bewerten?
Zum Schluss fasse ich die Untersuchungsergebnisse in einem Fazit zusammen und versuche, die weitere Entwicklung zu prognostizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deskriptiver Teil
- Historischer Hintergrund der gesellschaftspolitischen Entwicklungen in Simbabwe
- Koloniale Zeit
- Befreiungskampf und Unabhängigkeit
- Gesellschaftspolitische Entwicklungen von 1980 bis 1987
- Gesellschaftspolitische Entwicklungen von 1990 bis 2004
- Gesellschaftspolitische Entwicklungen von 2004 bis 2008
- Gesellschaftspolitische Entwicklungen von 2008 bis 2013
- Analytischer Teil
- Analyse des historischen Hintergrunds
- Die neue Verfassung
- Zentrale Veränderungen
- Grundrechte
- Die Rolle des Staatspräsidenten und die Exekutive
- Die Legislative
- Die Judikative
- Sicherheitskräfte
- Kritik am Verfassungsentwurf
- Bewertung der Erfolgschancen
- Ergebnisse
- Fazit und Ausblick
- Fazit
- Ausblick
- Quellen
- Literatur
- Internet
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Prozesse, die zur Entstehung der neuen Verfassung Simbabwes führten und bewertet die Erfolgschancen für eine demokratische und gewaltfreie Entwicklung des Landes. Sie untersucht den historischen Hintergrund der gesellschaftlichen und politischen Konflikte in Simbabwe und beleuchtet die zentralen Veränderungen der neuen Verfassung.
- Die Auswirkungen der Kolonialherrschaft auf die gesellschaftliche und politische Entwicklung Simbabwes
- Die Rolle des Befreiungskampfes und die Herausforderungen nach der Unabhängigkeit
- Die wichtigsten Veränderungen der neuen Verfassung Simbabwes
- Die Kritik an der neuen Verfassung und ihre möglichen Folgen
- Die Erfolgschancen für eine friedliche und demokratische Entwicklung Simbabwes
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Entstehung der neuen Verfassung Simbabwes und den Hintergründen des politischen und gesellschaftlichen Umbruchs im Land. Es werden die wichtigsten Ereignisse der Geschichte Simbabwes beleuchtet, insbesondere die Kolonialzeit, der Befreiungskampf und die Herausforderungen nach der Unabhängigkeit.
Kapitel 2 bietet eine detaillierte Analyse der neuen Verfassung. Die Analyse konzentriert sich auf die wichtigsten Änderungen im Vergleich zur alten Verfassung, insbesondere in den Bereichen Grundrechte, die Rolle des Staatspräsidenten, der Exekutive, der Legislative, der Judikative und der Sicherheitskräfte. Des Weiteren werden Kritikpunkte an der neuen Verfassung sowie die Bewertung der Erfolgschancen für eine demokratische Entwicklung diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Hauptaugenmerke der Arbeit liegen auf den politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen in Simbabwe, der Rolle der Kolonialisierung, der Befreiungskämpfe, den ethnischen Konflikten, der neuen Verfassung, den Grundrechten, der Exekutive, der Legislative, der Judikative und der Sicherheitskräfte.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Anlass für die neue Verfassung in Simbabwe?
Nach jahrelangen Konflikten einigten sich die Parteien ZANU-PF und MDC auf eine neue Verfassung, um den Weg für demokratische Reformen und ein Ende der politischen Gewalt zu ebnen.
Welche zentralen Änderungen sieht die neue Verfassung vor?
Die Verfassung stärkt die Grundrechte, begrenzt die Amtszeit des Präsidenten und sieht Reformen in der Legislative, Judikative sowie bei den Sicherheitskräften vor.
Welchen Einfluss hatte die Kolonialzeit auf Simbabwe?
Die Kolonialherrschaft hinterließ tiefe gesellschaftliche und ethnische Spannungen sowie ungelöste Landbesitzfragen, die bis heute die politische Instabilität des Landes prägen.
Warum kritisieren Nichtregierungsorganisationen (NGOs) den Verfassungsentwurf?
Viele NGOs bemängeln, dass die Exekutive (der Präsident) weiterhin zu viel Macht behält und die Umsetzung der Reformen in der Praxis oft an politischem Widerstand scheitert.
Wie hoch sind die Erfolgschancen für eine demokratische Entwicklung?
Trotz der Annahme der Verfassung mit 95 % bleibt die Lage aufgrund der tiefen politischen Gräben und der Rolle der Sicherheitskräfte unsicher und fragil.
- Quote paper
- B.A. Karsten Stöber (Author), 2013, Quo vadis, Simbabwe? Ein Land am Scheideweg zwischen Demokratie und Diktatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263298