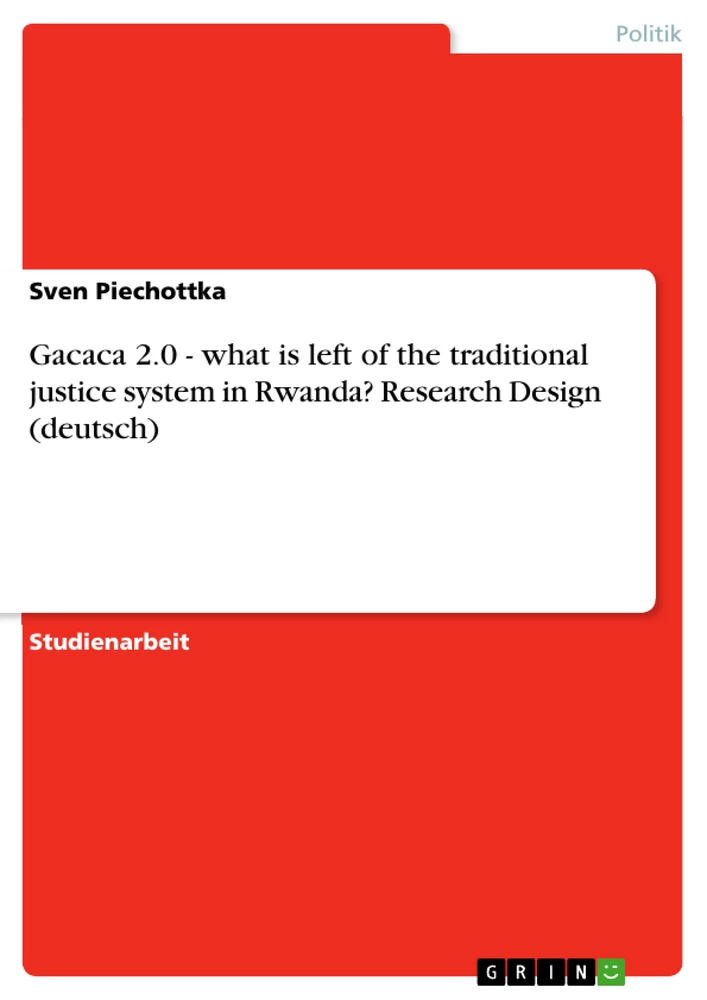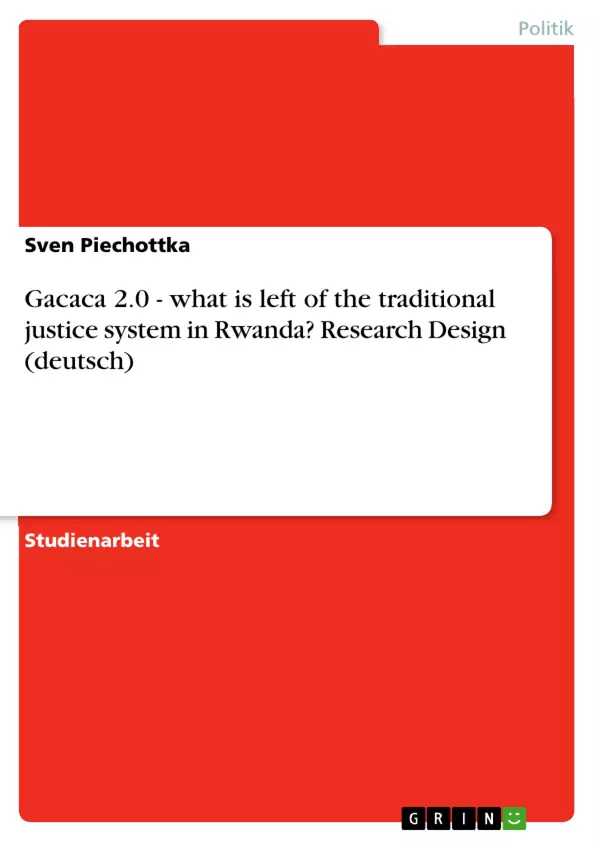Der Hauptgedanke der Arbeit soll nach den Vorstellungen des Autors die Klärung der Auswirkungen (kolonial-)staatlichen Einflusses auf die Legitimität der Gacaca-Gerichte sein. Die Befunde sollen verallgemeinerungsfähig sein und somit dabei helfen, die Anwendbarkeit traditioneller Konfliktlösungsmechanismen auch in anderen afrikanischen Staaten einschätzen zu lernen. Als Research Design lässt das Papier die Durchführung der Studie offen und regt lediglich mittels eines methodologischen Rahmens zu derselben an.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand / Literaturübersicht
- Konzeptualisierung
- Forschungsfrage und -hypothese
- Methodologie
- Kritischer Blick
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Research Design zielt darauf ab, die Gacaca-Courts in Ruanda kritisch zu beleuchten. Es soll untersucht werden, inwieweit die Entstehung dieser Gerichte durch staatlichen Einfluss geprägt war und ob dieser Einfluss zu Legitimitätsverlusten bei der Bevölkerung führte. Die Studie befasst sich mit der Frage, ob die Gacaca-Courts eine „invented tradition“ darstellen und welche Auswirkungen dies auf ihre Akzeptanz und Anwendung in Ruanda und anderen afrikanischen Ländern hat.
- Der Einfluss kolonialer und staatlicher Strukturen auf die Entwicklung der Gacaca-Courts
- Die Frage, ob Gacaca eine „invented tradition“ darstellt und welche Auswirkungen dies auf die Akzeptanz der Gerichte hat
- Die Auswirkungen des staatlichen Einflusses auf die Legitimität der Gacaca-Courts
- Die Übertragbarkeit des Konfliktlösungsmechanismus der Gacaca-Courts auf andere afrikanische Länder
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt den Kontext des Research Designs vor, indem es auf die instabilen Staatsstrukturen in Afrika und die Besonderheiten des Völkermordes in Ruanda eingeht. Es wird die Bedeutung der Gacaca-Courts als traditioneller Justizmechanismus in Ruanda hervorgehoben und die Forschungsfrage nach dem Einfluss der Kolonialisierung und staatlichen Einflussnahme auf die Gacaca-Courts formuliert.
- Forschungsstand / Literaturübersicht: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die vorhandene Literatur zum Völkermord in Ruanda und den Gacaca-Courts. Es wird die unterschiedliche Sichtweise auf die Gacaca-Courts in der Literatur dargestellt, die zwischen einer positiven Bewertung als Beispiel für die Einbindung indigener Traditionen in das moderne Staatswesen und einer kritischen Betrachtung als Instrumentalisierung durch die Regierung reicht.
- Konzeptualisierung: Das Kapitel beschreibt den theoretischen Rahmen der Forschungsarbeit und beleuchtet die spezifischen Forschungsfragen und -hypothesen, die in der Studie untersucht werden sollen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themengebiete der Forschungsarbeit sind: Gacaca-Courts, Völkermord in Ruanda, traditionelle Justiz, kolonialer Einfluss, staatliche Einflussnahme, Legitimität, „invented tradition“, Konfliktlösung, afrikanische Staatsstrukturen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Gacaca-Gerichte in Ruanda?
Gacaca-Gerichte sind ein traditionelles Justizsystem, das nach dem Völkermord in Ruanda wiederbelebt wurde, um die juristische Aufarbeitung auf lokaler Ebene zu bewältigen.
Was bedeutet der Begriff „invented tradition“ in diesem Kontext?
Es wird untersucht, ob die Gacaca-Gerichte eine echte indigene Tradition sind oder ob sie vom modernen Staat künstlich konstruiert und instrumentalisiert wurden.
Welchen Einfluss hatte die Kolonialzeit auf die Gacaca-Gerichte?
Die Arbeit analysiert, wie koloniale und staatliche Strukturen die ursprünglichen Mechanismen der traditionellen Konfliktlösung verändert haben.
Wie wirkt sich staatlicher Einfluss auf die Legitimität der Gerichte aus?
Es wird die Hypothese geprüft, ob die staatliche Einmischung zu einem Legitimitätsverlust der Gacaca-Gerichte bei der ruandischen Bevölkerung geführt hat.
Sind traditionelle Konfliktlösungssysteme auf andere afrikanische Staaten übertragbar?
Das Research Design zielt darauf ab, Erkenntnisse zu gewinnen, die helfen, die Anwendbarkeit ähnlicher Systeme auch in anderen post-konfliktären Gesellschaften Afrikas einzuschätzen.
- Quote paper
- Sven Piechottka (Author), 2013, Gacaca 2.0 - what is left of the traditional justice system in Rwanda? Research Design (deutsch), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263335