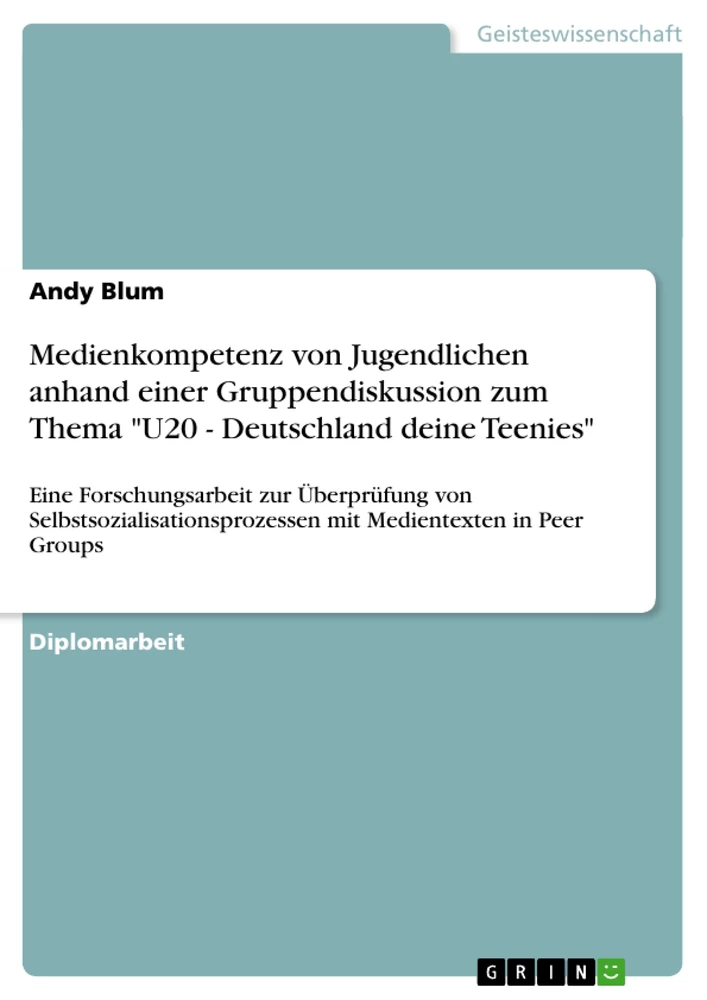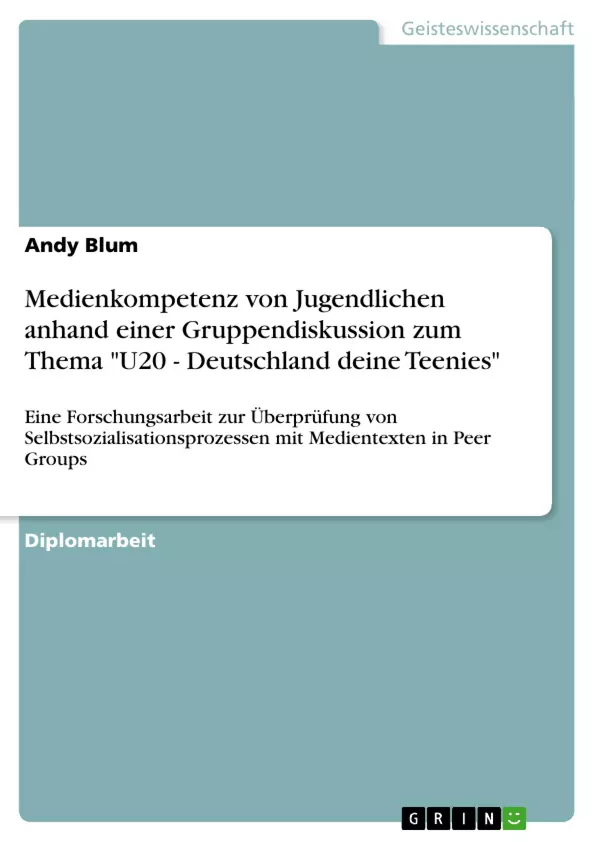Wir leben heute in einer Welt, in der digitalen Medien eine enorme Bedeutung zukommt. Fernseher und Computer sind aus einem normalen Haushalt nicht mehr wegzudenken und das Handy ist als multifunktioneller Wegbegleiter ständig präsent. Nicht nur in der Freizeit, sondern auch zunehmend in Ausbildung und Beruf, nehmen digitale Medien einen hohen Stellenwert ein. Diese Beobachtung ist sowohl durch einen persönlichen Blick in den Alltag zu verifizieren, als auch durch die JiM-Studie in den letzten Jahren durchweg empirisch bestätigt worden. So kann der komplette Einkauf via Mausklick oder Teleshopping ausgeführt werden, eine Konferenz mit Mikrofon und Webcam über viele Kilometer hinweg überbrückt und die aktuellsten Informationen zu jedem erdenklichen Thema über das Fernsehen oder das Internet, zu weiten Teilen selektiv, bezogen werden. Selbst körperliche Betätigung kann schon in einem simulierten Setting, über eine Spielekonsole, betrieben werden. Die Vielfalt von Möglichkeiten und auch von Medien selbst eröffnet völlig neue und individuelle Handlungsräume für den Menschen.
Die Kehrseite der Medaille ist hingegen, dass die Selektion von Medien und das Nutzbarmachen ihrer Inhalte, sowie das Schritthalten innerhalb ständiger Neuerungen, Anforderungen an den einzelnen stellen bzw. ihm Kompetenzen abverlangen, die zuvor auf dem Weg der Sozialisation erworben werden müssen. Diese Kompetenzen werden in der öffentlichen Diskussion zumeist als Medienkompetenzen spezifiziert und sind nach allgemeinem Konsens heute Schlüsselqualifikationen zu gesellschaftlicher Partizipation. Gerade junge Personen stehen unter dem Druck, Medien als selbstverständliche Werkzeuge in ihrem Leben zu nutzen. Als „Digital Native“ (Prensky 2001) genießen sie einen gewissen Vorteil gegenüber der Erwachsengeneration im Umgang mit digitalen Medien und doch bekunden einige Medienkritiker, dass der Umgang Heranwachsender mit Medien sehr wohl auch Risiken birgt, was einer Legitimation pädagogischer Intervention zur Förderung von Medienkompetenzen gleich kommt. Nicht zuletzt ist aber auch die Kritik am selbstinitiierten Umgang Heranwachsender mit Medien ein Grund, einen wissenschaftlichen Blick in ihre Lebenswelt zu werfen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Teil 1: Die Grundlagen
- 2.1. Die Generation Medienjugend
- 2.2. Jugendmedienforschung
- 2.2.1. Die Entwicklung der Medienforschung
- 2.2.2. Uses-and-Gratification Approach
- 2.2.3. Begriffsdefinition: Medienkompetenz
- 2.2.4. Der Kompetenzbegriff
- 2.2.5. Die Fernsehserie „U20 - Deutschland deine Teenies“
- 2.2.6. Zusammenfassung
- 2.3. Das Medium Fernsehen und seine Bedeutung für die heutige Jugend
- 2.3.1. Die aktuelle Programmlandschaft
- 2.3.2. Exkurs: Fernsehprogrammanalyse der Sender ProSieben, RTL und MTV
- 2.3.3. Das Echte Leute Fernsehen: Reality TV
- 2.3.4. Parasoziale Interaktion – Figuren, Personen und Rahmen
- 2.3.5. Die Position der Cultural Studies
- 2.3.6. Identitätsfindung als Lebensaufgabe – Die Frage nach der Sozialisation
- 2.3.7. Zusammenfassung
- 2.4. Medienkompetenz – Der Schlüssel zum Umgang mit Medien
- 2.4.1. Nach Dieter Baacke
- 2.4.2. Die gemeinsamen Schnittpunkte in der Vielfalt moderner Definitionen
- 2.4.3. Medienkritik als übergreifende Dimension von Medienkompetenz
- 2.4.4. Selektion von Teilaspekten des Medienkompetenzbegriffs zur Schaffung einer für diese Arbeit gültigen und hinreichenden Definition
- 3. Teil 2: Erforschung des Themenfeldes
- 3.1. Gruppendiskussion als qualitative Forschungsmethode
- 3.1.1. Die dokumentarische Methode als Auswertungsverfahren
- 3.2. Der Aufbau der Forschung – Vorbereitungen und Hypothesen
- 3.2.1. Zur Auswahl einer exemplarischen Folge „U20 – Deutschland deine Teenies“
- 3.2.2. Die Zusammensetzung der Diskussionsgruppen
- 3.2.3. Das Setting
- 3.2.4. Die Konzeption der Gruppendiskussion
- 3.3. Der Ablauf der Forschung – Resümee der Ereignisse
- 3.3.1. Erfahrungsbericht - Die Verfügbarkeit Jugendlicher als Forschungsteilnehmer
- 3.3.2. Vorstellung der Diskussionsgruppen und Bezeichnung klarer Differenzen
- 3.3.3. Formale Interpretation der einzelnen Gruppendiskussionen
- 3.3.3.1. Gruppe 1- „U20“
- 3.3.3.2. Gruppe 2- „Deutschland“
- 3.3.3.3. Gruppe 3- „Teenies“
- 3.3.4. Vergleich der drei Gruppen auf Grundlage der formalen Interpretationen
- 3.4. Die Auswertung der Forschung – Ergebnisse der Diskussionsgruppen
- 3.4.1. Dokumentarische Interpretation der einzelnen Gruppendiskussionen
- 3.4.1.1. Gruppe 1- „U20“
- 3.4.1.2. Gruppe 2- „Deutschland“
- 3.4.1.3. Gruppe 3- „Teenies“
- 3.4.2. Komparative Analyse und Typenbildung
- 4. Teil 3: Zusammenführung der Arbeitsteile (Fazit)
- Die Rolle von Medien in der Sozialisation von Jugendlichen
- Die Entwicklung und Bedeutung von Medienkompetenz
- Der Einfluss der Fernsehserie „U20 – Deutschland deine Teenies“ auf die Selbstsozialisation von Jugendlichen
- Die Herausforderungen und Chancen von Mediennutzung in Peer Groups
- Die Bedeutung von qualitativen Forschungsmethoden zur Analyse von Medienkompetenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Medienkompetenz von Jugendlichen anhand einer Gruppendiskussion zum Thema „U20 – Deutschland deine Teenies“. Das Ziel ist es, Selbstsozialisationsprozesse mit Medientexten in Peer Groups zu untersuchen. Die Arbeit analysiert die Mediennutzung von Jugendlichen, insbesondere im Hinblick auf die Fernsehserie „U20 – Deutschland deine Teenies“.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Themenfeld Medienkompetenz von Jugendlichen ein und stellt die Relevanz des Themas im Kontext der heutigen Medienlandschaft dar. Kapitel 2 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Medienkompetenz. Es werden die Entwicklung der Medienforschung, der Uses-and-Gratification Approach sowie verschiedene Definitionen von Medienkompetenz vorgestellt. Zudem wird die Fernsehserie „U20 – Deutschland deine Teenies“ als Untersuchungsgegenstand genauer betrachtet. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der methodischen Vorgehensweise der Arbeit. Hier wird die Gruppendiskussion als qualitative Forschungsmethode erläutert und der Aufbau der Forschung, inklusive der Auswahl der Diskussionsgruppen, des Settings und der Konzeption der Gruppendiskussion, beschrieben. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Gruppendiskussionen analysiert und interpretiert. Es werden sowohl formale als auch dokumentarische Interpretationen der einzelnen Diskussionsgruppen vorgestellt. Darüber hinaus erfolgt eine komparative Analyse und Typenbildung der Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Medienkompetenz, Jugendmedienforschung, Sozialisation, Selbstsozialisation, Peer Groups, Gruppendiskussion, qualitative Forschung, Fernsehserie, „U20 – Deutschland deine Teenies“, Mediennutzung, Identitätsfindung, Medienkritik
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die Medienkompetenz und Selbstsozialisationsprozesse von Jugendlichen am Beispiel der TV-Serie „U20 – Deutschland deine Teenies“.
Wie wird Medienkompetenz in der Arbeit definiert?
Medienkompetenz wird als Schlüsselqualifikation zur gesellschaftlichen Partizipation verstanden, basierend auf Theorien von Dieter Baacke und anderen Forschern.
Welche Rolle spielt Reality-TV für Jugendliche?
Reality-TV dient oft als Raum für parasoziale Interaktion und als Reibungspunkt für die Identitätsfindung innerhalb von Peer Groups.
Welche Forschungsmethode wurde angewandt?
Es wurde eine qualitative Forschung mittels Gruppendiskussionen durchgeführt, die mit der dokumentarischen Methode ausgewertet wurden.
Was sind „Digital Natives“?
Der Begriff beschreibt die Generation, die mit digitalen Medien als selbstverständliche Werkzeuge aufgewachsen ist, was jedoch pädagogische Interventionen nicht überflüssig macht.
- Quote paper
- Diplom Pädagoge Andy Blum (Author), 2010, Medienkompetenz von Jugendlichen anhand einer Gruppendiskussion zum Thema "U20 - Deutschland deine Teenies", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263361