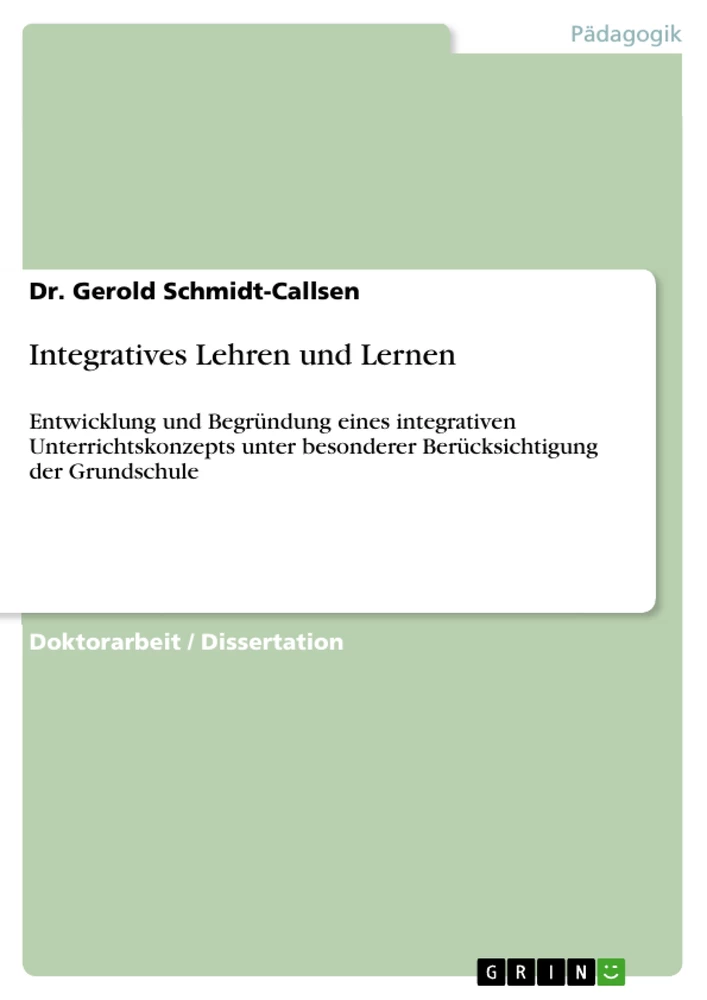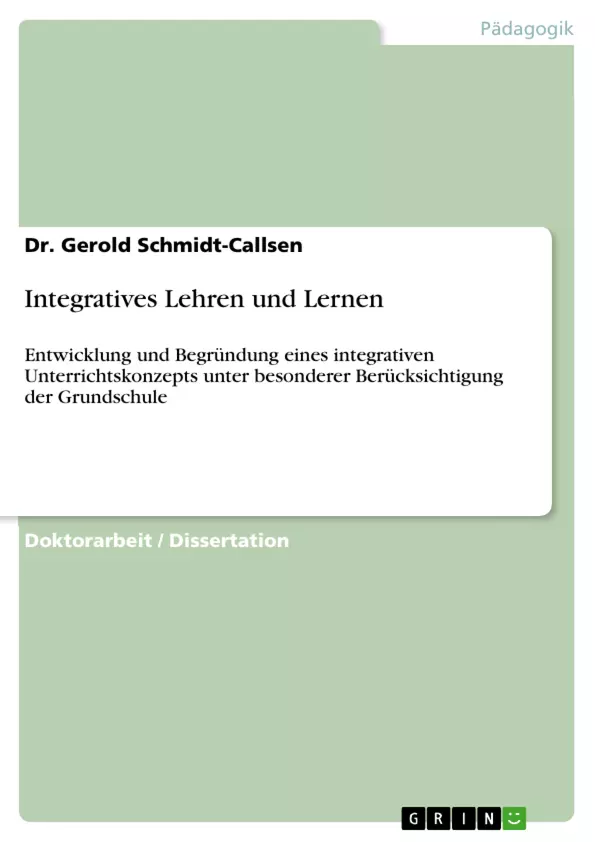In dieser Arbeit soll versucht werden, ein pädagogisches integratives Konzept mit dem Schwerpunkt Grundschule zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht der Begriff integrativ. Damit ist gemeint,dass bei der Konstruktion eines Unterrichtskonzepts möglichst alle relevanten wissenschaftlichen Perspektiven berücksichtigt und zu einem Gesamtkonzept verdichtet werden sollen.
Die Formulierung des integrativen Konzepts erfolgt in mehreren Schritten. Die einzelnen Schritte werden nach und nach aus dem ersten Schritt entwickelt. Dieser enthält die wichtigsten Grundannahmen und stellt den zentralen Bezugspunkt für die Entwicklung des Konzepts dar.Die Erörterungslinie ist dabei so konzipiert, dass sie vom Abstrakten zum Konkreten verläuft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Möglichkeiten menschlicher Grundbeziehungen zur Welt - Formulierung eines integrativen Konzepts
- 1.1 Eine integrative Weltbeziehung - Versuch einer begrifflichen Annäherung
- 1.2 Die integrative Beziehung zwischen Mensch und Lebenswirklichkeit - Formulierung konkreter Merkmale einer dynamischen Beziehung
- 1.2.1 Einleitung und Problemstellung
- 1.2.2 Die Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner
- 1.2.3 Die subjektive Perspektive (Mensch)
- 1.2.4 Die objektive Seite (Lebenswirklichkeit)
- 1.2.5 Merkmale integrativer Entwicklung - Zusammenfassung und Ausblick
- 2. Merkmale integrativer Entwicklung der Lebenswirklichkeit
- 2.1 Einleitung und Fragestellung
- 2.2 Der Bereich der engeren persönlichen Umgebung
- 2.3 Der Bereich der öffentlichen Erziehung
- 2.3.1 Die Reformdebatte der Schulstrukturen im Grundschulbereich
- 2.3.2 Die inhaltliche Reformdebatte
- 2.3.3 Die methodische Debatte
- 2.3.4 Die Rahmenbedingungen
- 2.4 Der Bereich Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Natur
- 2.5 Der Bereich der Weltanschauungen, Kultur, Ideologien, religiösen und philosophischen Prägung
- 2.6 Zusammenfassung der Ergebnisse in Thesen
- 3. Merkmale integrativer Persönlichkeitsentwicklung
- 3.1 Einleitung und Fragestellung
- 3.2 Persönlichkeitstheorien in der wissenschaftlichen Forschung
- 3.2.1 Persönlichkeitstheorien: Typen und Traits
- 3.2.2 Psychodynamische Theorien
- 3.2.3 Humanistische Theorien
- 3.2.4 Soziale Lerntheorien und kognitive Theorien
- 3.2.5 Theorien des Selbst
- 3.3 Merkmale integrativer Persönlichkeitsentwicklung
- 3.4 Ein integratives Bewusstseinskonzept
- 4. Merkmale integrativer Bildung
- 4.1 Einleitung und Fragestellung
- 4.2 Thesen zur Entwicklung eines integrativen Bildungsbegriffs
- 4.3 Die Entwicklung des Bildungsbegriffs aus integrativer Perspektive
- 4.3.1 Bildung - eine begriffliche Annäherung
- 4.3.2 Historische Ansätze in der Bildungstheorie
- 4.3.3 Bildungstheoretische Ansätze der Gegenwart unter integrativer Perspektive
- 4.4 Merkmale integrativer Bildung
- 4.5 Integrative Schlüsselbeziehungen
- 5. Integratives Lernen in der Grundschule
- 5.1 Einleitung und Fragestellung
- 5.2 Integrative Entwicklung
- 5.3 Merkmale integrativen Lernens
- 5.3.1 Allgemeine Begrifflichkeit
- 5.3.2 Lernkonzeptionen unter integrativer Perspektive
- 5.3.2.1 Psychologische Lerntheorien
- 5.3.2.2 Subjektbezogene Ansätze
- 5.3.2.3 Pädagogische Lerntheorien
- 5.3.2.4 Lernbedingungen
- 5.4 Grundsätze integrativen Lernens
- 5.41 Merkmale integrativen Lernens
- 6. Merkmale einer integrativen Didaktik
- 6.1 Einleitung und Fragestellung
- 6.2 Didaktische Grundpositionen unter integrativer Perspektive
- 6.2.1 Bioenergetische Didaktik
- 6.2.2 Spiel- und Arbeitsdidaktik
- 6.2.3 Kommunikative Didaktik
- 6.2.4 Dramaturgische Didaktik
- 6.2.5 Lerneffizienzdidaktik
- 6.2.6 Phantasie- und Kreativitätsdidaktik
- 6.2.7 Meditative und integrative Didaktik
- 6.2.8 Mediendidaktik
- 6.2.9 Sinnesdidaktik
- 6.3 Merkmale einer integrativen Didaktik
- 7. Skizze eines integrativen Lehrplans
- 7.1 Einleitung und Fragestellung
- 7.2 Lehrplantheorien
- 7.2.1 Lehrplantheorien der geisteswissenschaftlichen Pädagogik
- 7.2.2 Die Curriculumtheorie Robinsons
- 7.2.3 Neuere Forschungen im Bereich der Lehrplantheorie
- 7.2.4 Merkmale eines integrativen Lehrplans
- 7.2.5 Skizze eines integrativen Lehrplans
- 8. Integrative Unterrichtspraxis in der Grundschule
- 8.1 Einleitung und Fragestellung
- 8.2 Integrativer Lehrplan und Möglichkeiten seiner unterrichtlichen Umsetzung
- 8.3 Unterrichtsbeispiele zum integrativen Lehrplan
- 8.3.1 Schlüsselbereich Natur
- 8.3.1.1 Gärtnern in der Schule
- 8.3.1.2 Kinder helfen Schmetterlingen
- 8.3.1.3 Klassenfahrten mit Naturerlebnissen
- 8.3.2 Schlüsselbereich Gesellschaft
- 8.3.2.1 Eine Klassenfahrt mit Behinderten
- 8.3.2.2 Feuerwehr- und Sanitätsdienst in der Schule
- 8.3.2.3 Theateraufführungen im Seniorenheim
- 8.3.3 Schlüsselbereich Kultur und Bildung
- 8.3.3.1 Biografien von vorbildlichen Persönlichkeiten
- 8.3.3.2 Fremde Länder in unserer Klasse
- 8.3.3.3 Integratives Lesen lernen
- 8.3.4 Schlüsselbereich Technik/Wissenschaft
- 8.3.4.1 Wir reparieren, löten, schmieden, leimen, sägen, nageln, schrauben für andere Menschen
- 8.3.5 Schlüsselbereich Politik
- 8.3.5.1 Kinderparlamente
- 8.3.1 Schlüsselbereich Natur
- 8.4 Zusammenfassung und kritische Würdigung der Unterrichtbeispiele
- 9. Integrativer Unterricht in der Sekundarstufe – Anmerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation zielt darauf ab, ein integratives Unterrichtskonzept für die Grundschule zu entwickeln und zu begründen. Es untersucht die Möglichkeiten menschlicher Grundbeziehungen zur Welt und leitet daraus Merkmale integrativer Entwicklung auf persönlicher, gesellschaftlicher und bildungsbezogener Ebene ab. Das Konzept soll praktische Anwendung im Unterricht finden und dazu beitragen, ein ganzheitliches und umfassendes Lernen zu fördern.
- Integrative Weltbeziehung und deren Merkmale
- Merkmale integrativer Persönlichkeitsentwicklung
- Merkmale integrativer Bildung und deren Umsetzung im Unterricht
- Entwicklung eines integrativen Lehrplans für die Grundschule
- Beispiele integrativer Unterrichtspraxis in der Grundschule
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des integrativen Lehrens und Lernens ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie begründet die Notwendigkeit eines integrativen Ansatzes im Unterricht und stellt die zentrale Forschungsfrage dar.
1. Möglichkeiten menschlicher Grundbeziehungen zur Welt - Formulierung eines integrativen Konzepts: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein für das integrative Unterrichtskonzept. Es erörtert verschiedene Ansätze der Mensch-Welt-Beziehung und entwickelt ein Verständnis von integrativer Entwicklung als dynamische Wechselwirkung zwischen Subjekt und Lebenswirklichkeit. Die Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner spielt dabei eine zentrale Rolle.
2. Merkmale integrativer Entwicklung der Lebenswirklichkeit: Das Kapitel beschreibt die Merkmale integrativer Entwicklung in verschiedenen Bereichen der Lebenswirklichkeit: der engeren persönlichen Umgebung, der öffentlichen Erziehung (mit Fokus auf die Reformdebatte in der Grundschule), Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Natur sowie Weltanschauungen und kulturellen Einflüssen. Es analysiert die Wechselwirkungen zwischen diesen Bereichen.
3. Merkmale integrativer Persönlichkeitsentwicklung: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Persönlichkeitstheorien (typen-, traits-, psychodynamische, humanistische, soziale Lerntheorien, Theorien des Selbst) und leitet daraus Merkmale einer integrativen Persönlichkeitsentwicklung ab. Der Fokus liegt auf einem ganzheitlichen Verständnis der Persönlichkeit.
4. Merkmale integrativer Bildung: Das Kapitel entwickelt einen integrativen Bildungsbegriff, indem es verschiedene bildungstheoretische Ansätze (historische und gegenwärtige) analysiert und in Beziehung setzt. Es definiert die Merkmale integrativer Bildung und identifiziert wichtige Schlüsselbeziehungen.
5. Integratives Lernen in der Grundschule: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Anwendung des integrativen Ansatzes im Kontext der Grundschule. Es definiert integrative Lernmerkmale, analysiert relevante Lerntheorien (psychologische, subjektbezogene, pädagogische) und formuliert Grundsätze für integratives Lernen.
6. Merkmale einer integrativen Didaktik: Hier werden verschiedene didaktische Ansätze (bioenergetische, spiel- und arbeitsdidaktische, kommunikative, dramaturgische, usw.) unter der Perspektive des integrativen Lehrens und Lernens untersucht und zu einem zusammenhängenden Konzept einer integrativen Didaktik synthetisiert.
7. Skizze eines integrativen Lehrplans: Das Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen Lehrplantheorien und entwirft auf dieser Basis eine Skizze eines integrativen Lehrplans für die Grundschule. Es berücksichtigt die in den vorhergehenden Kapiteln entwickelten Merkmale integrativer Bildung und Didaktik.
8. Integrative Unterrichtspraxis in der Grundschule: Dieses Kapitel präsentiert konkrete Unterrichtsbeispiele aus verschiedenen Schlüsselbereichen (Natur, Gesellschaft, Kultur und Bildung, Technik/Wissenschaft, Politik), um die praktische Umsetzung des integrativen Lehrplans zu veranschaulichen.
Schlüsselwörter
Integratives Lehren und Lernen, Grundschule, integrativer Unterricht, Persönlichkeitsentwicklung, Bildungstheorie, Didaktik, Lehrplanentwicklung, Unterrichtspraxis, ganzheitliches Lernen, Mensch-Umwelt-Beziehung, Bronfenbrenner.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Integratives Lehren und Lernen in der Grundschule
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Dissertation entwickelt und begründet ein integratives Unterrichtskonzept für die Grundschule. Sie untersucht die Möglichkeiten menschlicher Grundbeziehungen zur Welt und leitet daraus Merkmale integrativer Entwicklung auf persönlicher, gesellschaftlicher und bildungsbezogener Ebene ab. Ziel ist die praktische Anwendung im Unterricht zur Förderung ganzheitlichen Lernens.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Integrative Weltbeziehung und deren Merkmale, Merkmale integrativer Persönlichkeitsentwicklung, Merkmale integrativer Bildung und deren Umsetzung im Unterricht, Entwicklung eines integrativen Lehrplans für die Grundschule und Beispiele integrativer Unterrichtspraxis in der Grundschule. Es werden verschiedene Theorien der Persönlichkeitsentwicklung, Bildung und Didaktik analysiert und miteinander in Beziehung gesetzt.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf verschiedene theoretische Ansätze, darunter die Ökologie der menschlichen Entwicklung nach Bronfenbrenner, diverse Persönlichkeitstheorien (z.B. psychodynamische, humanistische, soziale Lerntheorien), bildungstheoretische Ansätze (historische und gegenwärtige) und verschiedene didaktische Konzepte (bioenergetische, spiel- und arbeitsdidaktische, kommunikative etc.).
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Einleitung, Möglichkeiten menschlicher Grundbeziehungen zur Welt, Merkmale integrativer Entwicklung der Lebenswirklichkeit, Merkmale integrativer Persönlichkeitsentwicklung, Merkmale integrativer Bildung, Integratives Lernen in der Grundschule, Merkmale einer integrativen Didaktik, Skizze eines integrativen Lehrplans und Integrative Unterrichtspraxis in der Grundschule (mit konkreten Beispielen). Jedes Kapitel wird mit einer Einleitung und Fragestellung begonnen und mit einer Zusammenfassung beendet.
Was sind die Merkmale integrativer Entwicklung?
Integrative Entwicklung wird als dynamische Wechselwirkung zwischen Subjekt und Lebenswirklichkeit verstanden. Merkmale umfassen die Berücksichtigung verschiedener Bereiche der Lebenswirklichkeit (persönliche Umgebung, öffentliche Erziehung, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Natur, Weltanschauungen etc.) und eine ganzheitliche Betrachtung der Persönlichkeit. Im Bildungsbereich umfasst dies die Integration verschiedener Lernbereiche und -methoden.
Wie sieht der integrative Lehrplan aus?
Die Arbeit skizziert einen integrativen Lehrplan für die Grundschule, der auf den vorhergehenden Kapiteln aufbauend, die Merkmale integrativer Bildung und Didaktik berücksichtigt. Der Lehrplan integriert verschiedene Schlüsselbereiche wie Natur, Gesellschaft, Kultur und Bildung, Technik/Wissenschaft und Politik.
Welche konkreten Unterrichtsbeispiele werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert konkrete Unterrichtsbeispiele aus verschiedenen Schlüsselbereichen, z.B. Gärtnern in der Schule (Natur), Klassenfahrten mit Behinderten (Gesellschaft), Theateraufführungen im Seniorenheim (Gesellschaft), integratives Lesen lernen (Kultur und Bildung), Kinderparlamente (Politik). Diese Beispiele veranschaulichen die praktische Umsetzung des integrativen Lehrplans.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehramtsstudierende, Grundschullehrer*innen, Schulentwickler*innen und alle, die sich mit integrativen Lern- und Unterrichtsmethoden befassen. Sie bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungsmöglichkeiten für einen ganzheitlichen und umfassenden Ansatz im Grundschulunterricht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Integratives Lehren und Lernen, Grundschule, integrativer Unterricht, Persönlichkeitsentwicklung, Bildungstheorie, Didaktik, Lehrplanentwicklung, Unterrichtspraxis, ganzheitliches Lernen, Mensch-Umwelt-Beziehung, Bronfenbrenner.
- Arbeit zitieren
- Dr. Gerold Schmidt-Callsen (Autor:in), 2013, Integratives Lehren und Lernen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263436