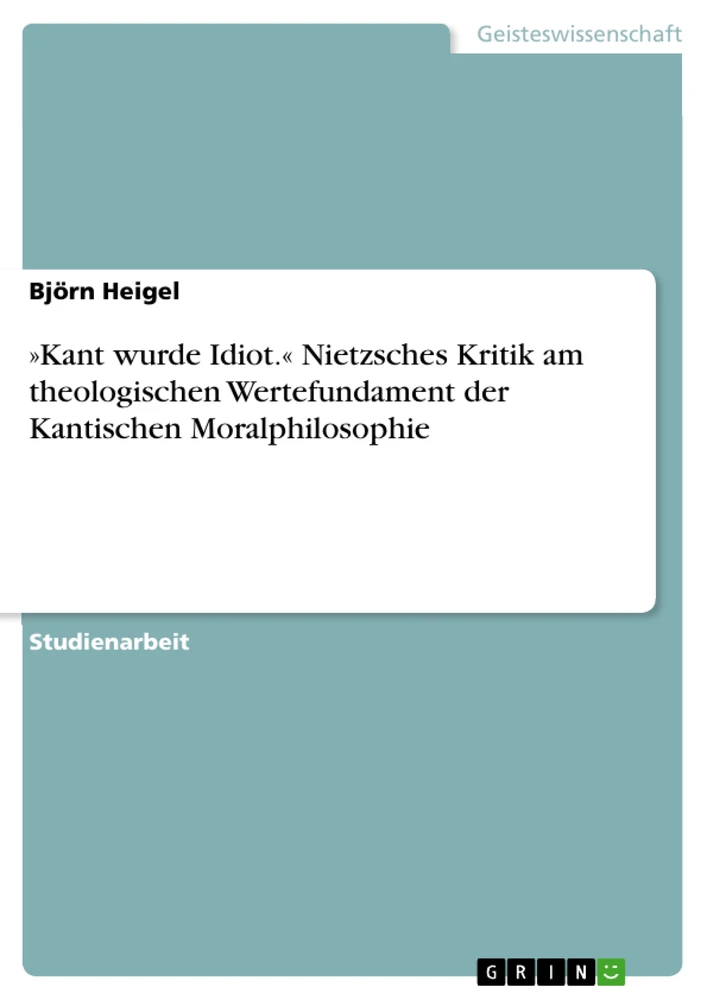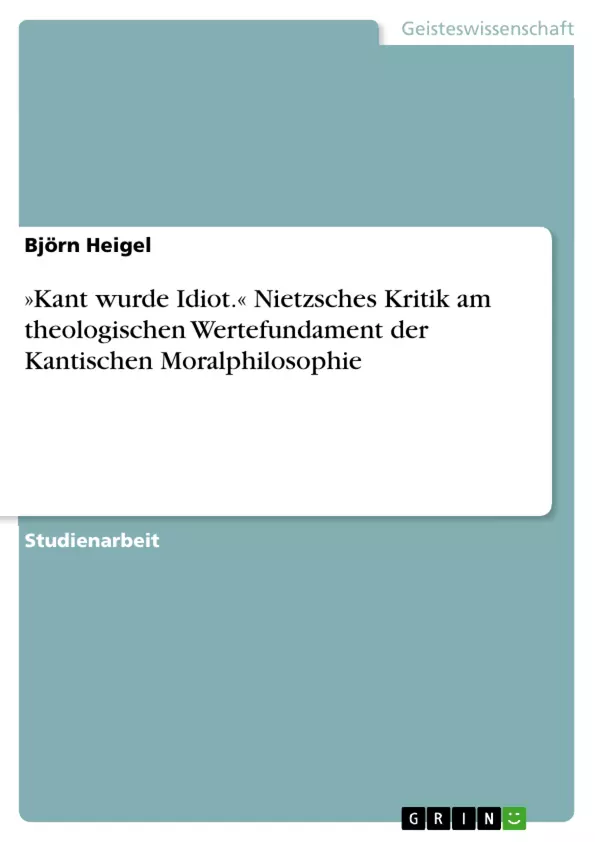1865 notiert der junge Nietzsche zu Beginn seiner Studienzeit in Bonn: »Die Lehre von der Subjektivität der Erscheinungen war ganz neu« und bezieht sich hier auf Kant. Doch schon 1872 findet sich in der Geburt der Tragödie erste Kritik an der "ungeheuren Tapferkeit und Weisheit Kant's […]" und – bis kurz vor Nietzsches Zusammenbruch – liest man immer wieder ablehnende Hasstiraden gegen "jenen verwachsensten Begriffs-Krüppel, den es je gegeben hat, den grossen Kant" – Was war passiert?
Nach einem einleitenden Exkurs in die theoretische Philosophie Kants wird der Werdegang des kategorischen Imperativs umrissen, jenes "objektive[n] Prinzip[s], woraus, als einem obersten praktischen Grunde, alle Gesetze des Willens […] abgeleitet werden können." So soll der erste Teil dieser Arbeit zunächst einen grundlegenden Überblick über Anspruch und Leistung der praktischen Philosophie Kants geben. Der zweite Teil rückt oben erwähnten Befund Nietzsches ins Zentrum, gleichsam dessen Behandlung von "Irrthümlichkeit und Wahn aller moralischen Urtheile" soweit sie den Kontext der Moralphilosophie Kants betreffen. Im Fokus steht dabei keine chronologische Betrachtung der Kant-Kritiken unter den Wirk- und Schaffensperioden Nietzsches. Viel eher geht es um eine systematische Kritik des kategorischen Imperativs, verstanden als Höhepunkt der Kantischen Ethik, der hier innerhalb des Kontextes der Moral- und Religionsphilosophie Nietzsches betrachtet wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Teil:
- DIE GENESE DES KATEGORISCHEN IMPERATIVS IN KANTS PRAKTISCHER PHILOSOPHIE
- 1.1 Das Fundament des Kantischen Kritizismus: die kopernikanische Wende der Metaphysik.
- 1.2 Der gute Wille als Voraussetzung des kategorischen Imperativs
- 1.3 Die Maxime des Willens als allgemeines Sittengesetz: der kategorische Imperativ
- II. Teil:
- > DER KATEGORISCHE IMPERATIV RIECHT NACH GRAUSAMKEIT ... << NIETZSCHES DESTRUKTION DER KANTISCHEN MORALPHILOSOPHIE
- 2.1 Der kategorische Imperativ in genealogischer‹ Kritik
- 2.1.1 Herren- und Sklaven-Moral als Ursprung eines »absoluten Werte[s] des bloßen Willens« (Kant).
- 2.1.2 Der kategorische Imperativ als religiöses Herrschaftsinstrument
- 2.1.3 NIETZSCHES Kritik am autoritären Charakter des kategorischen Imperativs
- 2.3 NIETZSCHE als philosophischer Erbe KANTS – ein Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Nietzsches Kritik an Kants Moralphilosophie, insbesondere an dessen kategorischem Imperativ. Sie untersucht, wie Nietzsches genealogische Kritik die Grundlagen der Kantischen Ethik in Frage stellt und dabei den Einfluss von Machtstrukturen und dem Willen zur Macht auf die Entstehung von Moral aufzeigt.
- Die Genese des kategorischen Imperativs in Kants praktischer Philosophie.
- Die Kritik am kategorischen Imperativ aus der Perspektive der genealogischen Methode Nietzsches.
- Die Rolle von Herren- und Sklavenmoral bei der Entstehung des kategorischen Imperativs.
- Die Funktion des kategorischen Imperativs als religiöses Herrschaftsinstrument.
- Der autoritäre Charakter des kategorischen Imperativs im Kontext der Nietzsche'schen Kritik.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den historischen und philosophischen Kontext der Arbeit. Sie zeigt die Bedeutung von Kants Moralphilosophie und den Einfluss des kategorischen Imperativs auf die Entwicklung der europäischen Kultur.
Der erste Teil widmet sich der Entstehung des kategorischen Imperativs in Kants praktischer Philosophie. Er beschreibt die kopernikanische Wende in der Metaphysik, die als Grundlage für Kants Kritik der reinen Vernunft dient.
Der zweite Teil analysiert Nietzsches Kritik an Kants Moralphilosophie. Er beleuchtet die genealogische Kritik des kategorischen Imperativs, die Herren- und Sklavenmoral als Ursprung des Willens und die Funktion des kategorischen Imperativs als religiöses Herrschaftsinstrument.
Schlüsselwörter
Kant, Nietzsche, kategorischer Imperativ, Moralphilosophie, Genealogie der Moral, Herrenmoral, Sklavenmoral, Macht, Wille zur Macht, Religion, Autorität.
Häufig gestellte Fragen
Warum kritisierte Nietzsche Immanuel Kant so scharf?
Nietzsche sah in Kants Moralphilosophie ein verstecktes theologisches Fundament und kritisierte den kategorischen Imperativ als lebensfeindlich und autoritär.
Was versteht Nietzsche unter der "genealogischen Kritik" am kategorischen Imperativ?
Nietzsche untersucht die Herkunft moralischer Werte und argumentiert, dass Kants "objektive" Moral tatsächlich in Machtstrukturen und dem Willen zur Macht wurzelt.
Welche Rolle spielen Herren- und Sklavenmoral in der Kant-Kritik?
Nietzsche deutet Kants Moral als Ausdruck einer Sklavenmoral, die universelle Pflichten nutzt, um individuelle Stärke und Instinkte zu unterdrücken.
Was meinte Nietzsche mit der Aussage "Kant wurde Idiot"?
Dies ist eine polemische Zuspitzung seiner Kritik an Kants Rückfall in religiöse Denkmuster trotz seines Anspruchs auf reine Vernunft.
Inwiefern ist der kategorische Imperativ laut Nietzsche ein Herrschaftsinstrument?
Er fungiert als Werkzeug zur Disziplinierung der Massen durch die Verinnerlichung von Pflichten, die ursprünglich religiösen Ursprungs sind.
- Quote paper
- Björn Heigel (Author), 2013, »Kant wurde Idiot.« Nietzsches Kritik am theologischen Wertefundament der Kantischen Moralphilosophie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263487