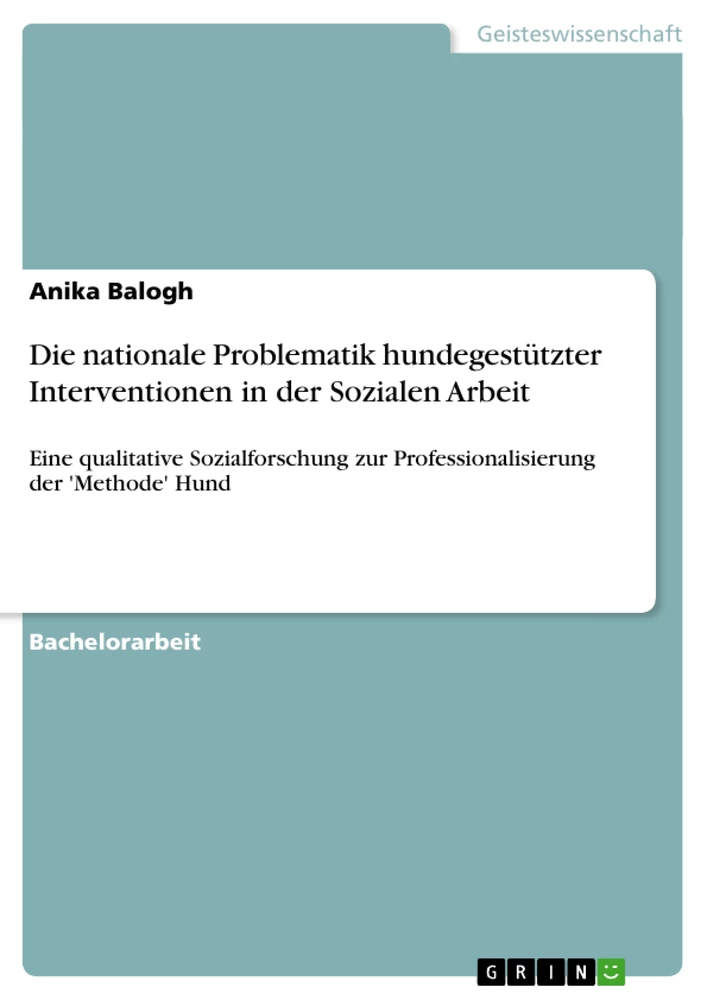"Tag 19. Ich habe meinen Meister erfolgreich konditioniert, zu lächeln und in sein Buch zu schreiben jedesmal wenn ich sabber. -Pavlov´s Hund." (Anonym)
Während der Studienzeit kommt jeder Sozialarbeiter irgendwann auf diesen Hund. Pavlovs Lehre ist ein fundamentaler Inhalt des Studiums. Doch dabei bleibt es manchmal nicht. Der Hund als Methode in der Sozialen Arbeit erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Die positive Wirkung von Hunden auf den Klienten selbst sowie auf die Beziehung zwischen Klienten und Sozialarbeiter ist belegt und Grundannahme dieser Bachelorthesis. Die Problematik der Methode Hund ist jedoch, dass es kaum Ausbildungsstandards für den Hund sowie für die tiergestützte Pädagogik gibt. Auf Grundlage einer qualitativen Sozialforschung mit der Delphi-Methode wurden konkrete Handlungsempfehlungen zur Professionalisierung gefunden.
Inhaltsverzeichnis
- Danksagungen
- Abstract
- Inhaltsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Vorwort
- 2 Einleitung
- 2.1 Begriffsdefinition "Hundegestützte Interventionen" - die "Methode Hund"
- 2.2 Begriffsdefinition "Therapie"
- 2.2.1 Begriffsdefinition "Therapiehund"
- 3 Ausgangssituation
- 3.1 Die Domestikation des Wolfes zum Hund im Abgleich mit der Bedürfnishierarchie nach Maslow
- 3.1.1 Die demokratisch/hierarchische Beziehung zwischen Mensch und Hund
- 3.2 Der Auftrag Sozialer Arbeit
- 3.2.1 Hundegestützte Interventionen als Methode der Sozialen Arbeit
- 4 Nationale Problematik
- 4.1 Wirtschaftspolitische Aspekte
- 4.2 Aktueller Stand der tiergestützten Interventionen in Deutschland
- 4.3 Internationale Entwicklung der Organisationsstrukturen
- 5 Empirischer Teil
- 5.1 Delphie- Methode
- 6 Forschungsdesign
- 6.1 Vorbereitungsphase
- 6.2 Einstiegs- und Orientierungsphase
- 6.2.1 Befragungsaufbau
- 7 Erhebungsphase I & II
- 7.1 Erhebungsphase I (Offene Befragung)
- 7.2 Erhebungsphase II (Geschlossene Befragung)
- 8 Grundauswertung
- 8.1 Auswertungsverfahren
- 8.2 Ergebnisse
- 9 Bezugnahme zur Fachdiskussion
- 9.1 Ausblick / Empfehlungen
- 10 Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang A
- Anhang B
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorthesis befasst sich mit der nationalen Problematik hundegestützter Interventionen in der Sozialen Arbeit und setzt sich zum Ziel, die Professionalisierung der "Methode" Hund zu fördern. Sie analysiert die aktuelle Situation und identifiziert Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Qualität und Anerkennung des Hundes im pädagogischen und therapeutischen Kontext.
- Analyse der aktuellen Situation und Herausforderungen im Bereich der hundegestützten Interventionen
- Entwicklung von Qualitätsstandards für die Ausbildung von Therapiehunden und Sozialarbeitern
- Verbesserung des gesellschaftlichen Bildes von Hundehaltern und Therapiehunden
- Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Bereich der tiergestützten Therapie und Pädagogik
- Förderung der Forschung und wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der "Methode" Hund
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beleuchtet zunächst den historischen Hintergrund der Beziehung zwischen Mensch und Hund und die Entwicklung der "Methode" Hund in der Sozialen Arbeit. Sie analysiert die nationale Problematik, die sich durch fehlende Standards und mangelnde Anerkennung der Methode Hund auszeichnet. Im empirischen Teil werden die Ergebnisse einer qualitativen Sozialforschung mithilfe der Delphi-Methode dargestellt. Dabei werden Experten aus verschiedenen Bereichen befragt, um Handlungsempfehlungen zur Professionalisierung zu gewinnen. Der Fokus liegt auf der Optimierung von Ausbildungsstandards, der Förderung der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren und der Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Thema der hundegestützten Interventionen in der Sozialen Arbeit, der Professionalisierung der "Methode" Hund, der Entwicklung von Qualitätsstandards, der tiergestützten Therapie und Pädagogik, der Delphi-Methode und den relevanten Organisationen wie ESAAT, ISAAT und ADI.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptproblem hundegestützter Interventionen in Deutschland?
Es mangelt an einheitlichen Ausbildungsstandards für die Hunde sowie für die tiergestützte Pädagogik und Soziale Arbeit insgesamt.
Was versteht man unter der "Methode Hund"?
Die Methode beschreibt den gezielten Einsatz von Hunden zur Verbesserung der Klientenbeziehung und zur Unterstützung pädagogischer oder therapeutischer Prozesse.
Wie wurde in der Bachelorthesis geforscht?
Es wurde eine qualitative Sozialforschung mithilfe der Delphi-Methode durchgeführt, um Expertenmeinungen zu bündeln und Handlungsempfehlungen zu entwickeln.
Welche Rolle spielen Organisationen wie ESAAT oder ISAAT?
Diese Organisationen setzen sich für die Professionalisierung und die Etablierung von Qualitätsstandards in der tiergestützten Therapie ein.
Wie wirkt sich die Domestikation des Wolfes auf die heutige Arbeit aus?
Die geschichtliche Entwicklung der Mensch-Hund-Beziehung wird im Kontext der Bedürfnishierarchie nach Maslow analysiert, um die tiefe Bindung zu erklären.
- Quote paper
- Anika Balogh (Author), 2013, Die nationale Problematik hundegestützter Interventionen in der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263539