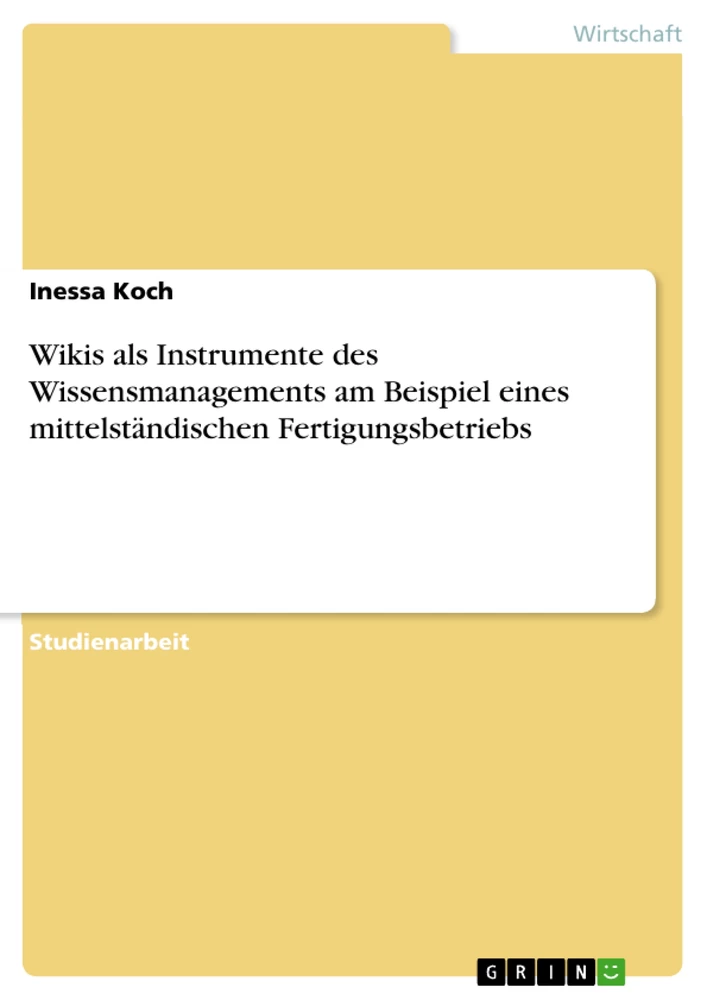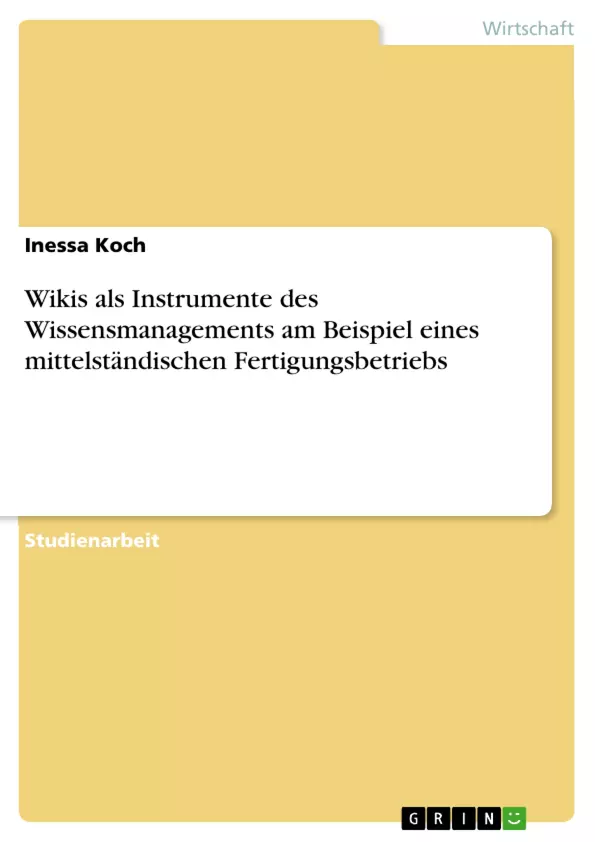In der heutigen Zeit ist das Wort „Wiki“ überall bekannt und wird sogleich mit dem Begriff „Wikipedia“ assoziiert. Das verwundert nicht, denn es ist die weltweit größte geschaffene Enzyklopädie. Des Weiteren erscheint Wikipedia fast immer ganz oben in der Ergebnisliste einer Suchmaschine im Internet, wenn nach Begriffsdefinitionen gesucht wird. In dieser Enzyklopädie erstellen Autoren aus der ganzen Welt Artikel in verschiedenen Sprachen. Die Anwendung ist leicht zu bedienen und verleitet, durch die Möglichkeit Texte jederzeit ändern zu können, zum Mitmachen. Durch das erfolgreiche Konzept von Wikipedia sind u. a. auch deutsche Unternehmen auf diese Software gestoßen und haben versucht es auf die Speicherung interner Daten zu übertragen. Inzwischen ist die Wiki-Software ein beliebtes Instrument zur Sammlung von Wissen in Unternehmen. Nicht nur die einfache Handhabung, auch die Tatsache, dass viele Versionen kostenfrei bereitgestellt werden können, verlocken zur Anschaffung. Ist das aber eine logische Überlegung? Sind Wikis für jedes Unternehmen als Wissensmanagementlösung geeignet? Das in dieser Seminararbeit untersuchte Praxisbeispiel, ein Fertigungsunternehmen aus dem Mittelstand, stellt konkrete Bezüge zu dieser Fragestellung her. Anhand der dargestellten Problemfelder beim Wiki-Einsatz, werden Handlungsanweisungen für eine effektive Zusammenarbeit am Wissenssammlungsprozess mithilfe von Wikis gegeben.
Im Theorieteil dieser Arbeit werden die Begriffe Wissen, Wissensmanagement und Wiki im Unternehmenskontext definiert und ihre Verflechtung untereinander explizit erläuert. Im weiteren Verlauf werden Anwendungsgebiete und die Zweckmäßigkeit dieser Software beleuchtet mit dem Verweis auf generelle und mögliche Problemfelder.
Der Praxisbezug stellt Parallelen zur Theorie her, indem die praktische Umsetzung eines Wikis im Beispielunternehmen beschrieben und kritisch hinterfragt wird. In der Schlussbetrachtung wird exponiert, inwiefern ein Wiki als Wissensmanagementsystem in Unternehmen sinnvoll ist und wie eine erfolgreiche Anwendung langfristig sichergestellt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie: Wissen, Wissensmanagement und Wikis
- 2.1. Begriffsabgrenzung: Informationen und Wissen
- 2.2. Wissensmanagement: Definition, Aufgaben und Bausteine
- 2.3. Wiki: Definition und Funktionsweise
- 2.3.1. Wikis im Zusammenhang mit Wissensmanagement
- 2.3.2. Wiki als Wissensmanagementsystem in Unternehmen: Nutzen und Problemfelder
- 2.3.3. Wikis in kleinen und mittelständischen Unternehmen
- 3. Praxisbezug: Wiki als Instrument der Wissenssammlung in einem mittelständischen Fertigungsbetrieb
- 3.1. Einführung und Einsatz
- 3.2. Probleme und Lösungsansätze
- 4. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Anwendung von Wikis als Instrumente des Wissensmanagements im Kontext eines mittelständischen Fertigungsbetriebs. Sie untersucht die Eignung und Herausforderungen dieser Software zur Wissensgewinnung und -verbreitung in Unternehmen. Der Fokus liegt auf den praktischen Erfahrungen und der konkreten Umsetzung eines Wiki-Systems in einem exemplarischen Fertigungsunternehmen.
- Begriffsdefinition von Wissen, Wissensmanagement und Wikis
- Vorteile und Herausforderungen des Wiki-Einsatzes im Unternehmenskontext
- Analyse der praktischen Anwendung eines Wiki-Systems in einem mittelständischen Fertigungsbetrieb
- Bewertung der Effektivität von Wikis als Wissensmanagementsystem
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für die erfolgreiche Implementierung und Nutzung von Wikis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und stellt den aktuellen Stand der Forschung zum Thema „Wikis als Wissensmanagementinstrumente“ dar. Es wird auf die Relevanz des Themas im Kontext von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) eingegangen.
- Kapitel 2: Theorie: Wissen, Wissensmanagement und Wikis
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen des Wissensmanagements und beleuchtet die Bedeutung von Wikis als Instrumente der Wissensvermittlung und -organisation. Es werden Definitionen für die Begriffe „Wissen", „Wissensmanagement" und „Wiki" gegeben und die Funktionsweise von Wikis im Kontext von Wissensmanagement erläutert.
- Kapitel 3: Praxisbezug: Wiki als Instrument der Wissenssammlung in einem mittelständischen Fertigungsbetrieb
In diesem Kapitel wird die praktische Anwendung eines Wiki-Systems in einem exemplarischen Fertigungsunternehmen aus dem Mittelstand betrachtet. Es werden die Erfahrungen mit der Einführung und dem Einsatz des Wikis im Unternehmen beschrieben und die Herausforderungen und Chancen der Wissensgewinnung durch Wiki-Software analysiert.
Schlüsselwörter
Wissensmanagement, Wiki, Mittelstand, Fertigungsbetrieb, Wissenssammlung, Informationsmanagement, Unternehmenskultur, Kollaboration, Wissenstransfer, digitale Transformation, Software-Anwendungen, Praxisbeispiel, Fallstudie
Häufig gestellte Fragen
Wie können Wikis im Wissensmanagement genutzt werden?
Wikis dienen als kollaborative Plattformen zur Speicherung, Strukturierung und gemeinsamen Bearbeitung von internem Unternehmenswissen.
Welche Vorteile bietet ein Wiki für mittelständische Unternehmen?
Vorteile sind die einfache Handhabung, geringe Kosten (oft Open Source) und die Förderung eines schnellen Informationsaustauschs zwischen Mitarbeitern.
Was sind typische Probleme bei der Einführung eines Firmen-Wikis?
Herausforderungen sind mangelnde Akzeptanz der Mitarbeiter, unklare Verantwortlichkeiten für die Pflege der Inhalte und eine fehlende Wissenskultur.
Was ist der Unterschied zwischen Information und Wissen?
Informationen sind Daten in einem Kontext. Wissen entsteht erst, wenn diese Informationen durch Erfahrung und Verknüpfung für Handlungen nutzbar gemacht werden.
Wie sichert man den langfristigen Erfolg eines Wikis?
Durch klare Nutzungsregeln, die Motivation der Mitarbeiter zur aktiven Teilnahme und die Integration des Wikis in die täglichen Arbeitsprozesse.
- Quote paper
- Inessa Koch (Author), 2012, Wikis als Instrumente des Wissensmanagements am Beispiel eines mittelständischen Fertigungsbetriebs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263590