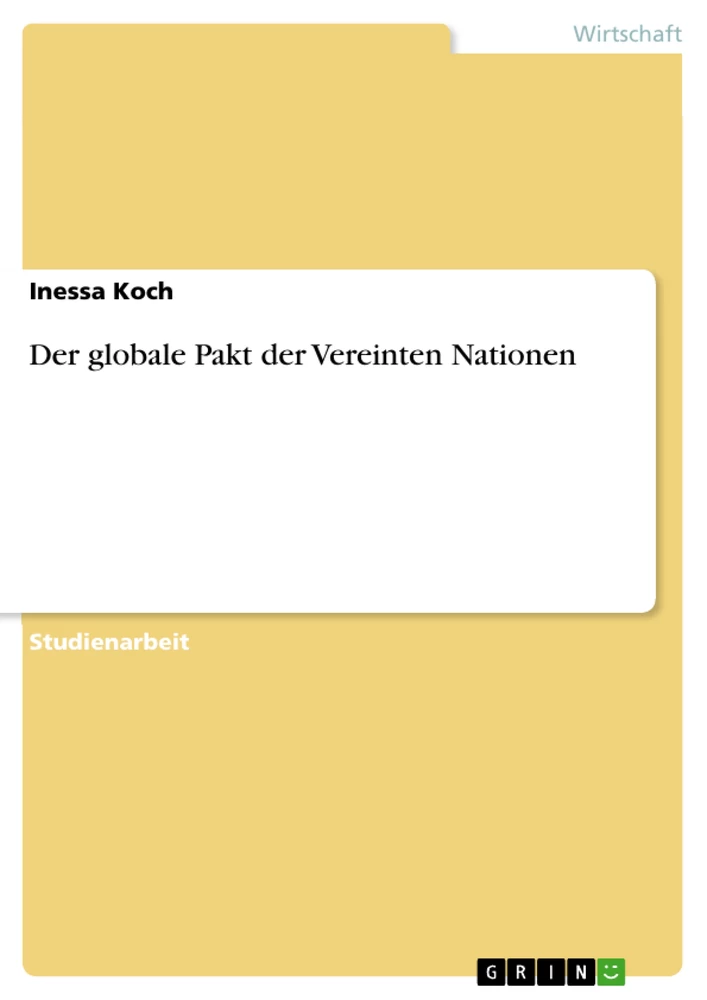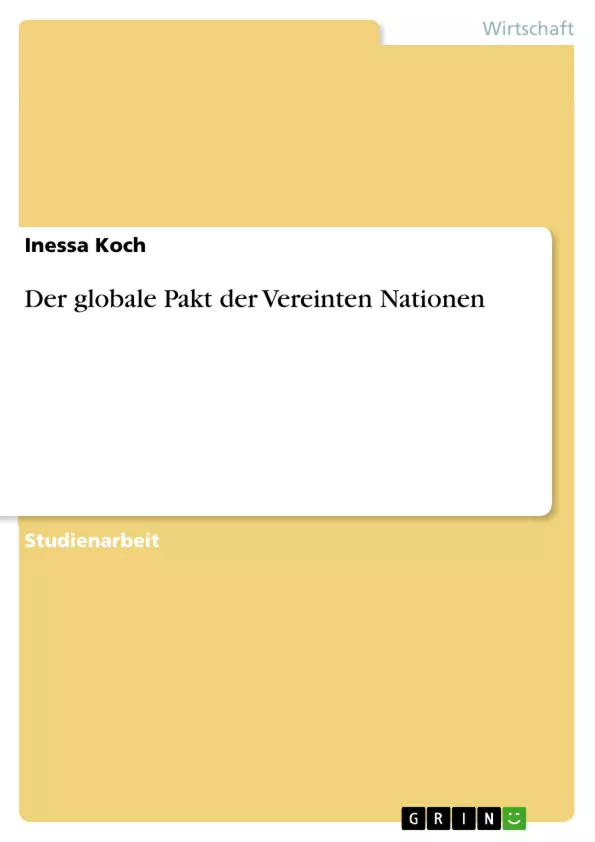Die Globalisierung und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Zusammenwirken der Menschen verändert nach und nach die Welt, in der wir leben. In den 80er Jahren war das Ergattern einer Pampelmuse ein rares Festmahl; heutzutage sind u. a. Papayas aus Brasilien, Bananen aus Afrika und Orangen aus Spanien in zahlreichen Supermärkten erwerbbar. Jedoch ist dieser Luxus der westlichen Welt auf Kosten der Menschen in der Dritten Welt entstanden. Umweltzerstörung, Armut, Kinderarbeit und Diskriminierung sind nur wenige der Kausalitäten der Globalisierung. Die vereinten Nationen stehen für global wichtige Themen wie die Achtung der Menschenrechte, des Friedens sowie für menschenwürdigen Bedingungen ein. Um Unternehmen in diese Thematik stärker einbinden zu können wurde von der UNO (United Nations Organization, deutsch: Organisation der Vereinten Nationen) das Projekt „Global Compact“ geschaffen, das als Richtlinie für unternehmerisches Handeln die internationale Zusammenarbeit menschen- sowie umweltfreundlicher gestalten soll. Mittlerweile ist dieser Pakt weltweit stark vertreten. Wie sinnvoll ist jedoch dieses gemeinsame Unternehmensprojekt? Gibt es reale Ergebnisse oder ist das Ganze eine Art PRMaßnahme durch die Marke „Global Compact“?
In dieser Seminararbeit wird untersucht, was genau der globale Pakt aussagt, mit sich bringt und wie sinnvoll dieser ist. Im Verlauf der Arbeit wird die Entwicklung, die Ziele und Inhalte des Global Compact, der Zusammenhang zur Unternehmensethik sowie die Verbindung zur UNO herausgearbeitet. Im letzten Abschnitt werden die positiven und negativen Effekte anhand von zwei Weltkonzernen erläutert und daraus das Fazit gezogen, inwieweit der globale Pakt tatsächlich Nutzen bringt.
Global Compact: Entwicklung, Zielsetzung und Inhalt
Das aktive Zusammenwirken der UNO mit Akteuren aus der Wirtschaft war vor einigen Jahren noch ein unvorstellbares Szenario. Inzwischen ist, aufgrund der immer mehr bedeutsamen Thematik der Wirtschafts- und Unternehmensethik, die gemeinsame Arbeit an Projekten unter den Teilnehmern am Global Compact eine Selbstverständlichkeit. Dieser Meinungsumschwung war kein einmaliges Ereignis; es war ein über Jahrzehnte andauernder Prozess, auf den im Folgenden näher eingegangen wird (vgl. BRÜHL et al. 2001, S. 104 ff.).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Global Compact: Entwicklung, Zielsetzung und Inhalt
- 2.1. Entstehungsgeschichte
- 2.2. Ziele und Inhalte
- 3. Der globale Pakt: Pfeiler der Unternehmensethik
- 3.1. Auswirkungen des Paktes auf Unternehmen
- 3.2. Der Global Compact als Regelwerk der UNO
- 4. Mitwirkung weltweit bedeutender Unternehmen
- 4.1. Positivbeispiel Novartis
- 4.2. Negativbeispiel Nestlé
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert den „Global Compact“ der Vereinten Nationen. Ziel ist es, die Entstehung, Ziele und Inhalte des Paktes sowie dessen Auswirkungen auf Unternehmensethik und internationale Zusammenarbeit zu untersuchen.
- Entwicklung des Global Compact
- Ziele und Inhalte des Global Compact
- Auswirkungen des Global Compact auf Unternehmensethik
- Zusammenhang zwischen Global Compact und UNO
- Bewertung der Wirksamkeit des Global Compact anhand von Beispielen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung erläutert den aktuellen Kontext der Globalisierung und deren Auswirkungen auf die Welt. Sie führt den Global Compact als Antwort der Vereinten Nationen auf diese Herausforderungen ein und stellt die Fragestellung der Arbeit dar.
- Kapitel 2 beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Global Compact. Es wird die Entwicklung von der anfänglichen Spaltung zwischen der UNO und der Wirtschaft bis hin zur Entstehung einer gemeinsamen Arbeitsweise im Rahmen des Global Compact dargestellt.
- Kapitel 3 befasst sich mit den Zielen und Inhalten des Global Compact. Es werden die zehn Prinzipien des Paktes sowie deren Auswirkungen auf Unternehmen und ihre ethischen Grundsätze behandelt.
- Kapitel 4 untersucht die Beteiligung von Unternehmen am Global Compact. Es werden sowohl positive als auch negative Beispiele von Weltkonzernen aufgezeigt, um die praktischen Auswirkungen des Paktes zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Unternehmensethik, Vereinte Nationen, Global Compact, Nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte, Umweltstandards, Internationalisierung, Wirtschaftsbeziehungen, UN-Initiative, Unternehmenskultur, Corporate Social Responsibility (CSR).
Häufig gestellte Fragen
Was ist der UN Global Compact?
Der Global Compact ist eine Initiative der Vereinten Nationen, die Unternehmen weltweit dazu aufruft, zehn Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsprävention umzusetzen.
Welche Ziele verfolgt der Global Compact?
Ziel ist es, die Globalisierung sozialer und ökologischer zu gestalten und Unternehmen stärker in die Verantwortung für globale Probleme wie Armut und Umweltzerstörung einzubinden.
Ist der Global Compact rechtlich bindend?
Nein, es handelt sich um ein freiwilliges Regelwerk bzw. eine Richtlinie für unternehmerisches Handeln, nicht um ein einklagbares Gesetz.
Welche Kritik wird am Global Compact geübt?
Kritiker hinterfragen oft die reale Wirksamkeit und befürchten, dass Unternehmen die Teilnahme als reine PR-Maßnahme ("Blue-Washing") nutzen, ohne echte Veränderungen herbeizuführen.
Welche Unternehmen werden in der Arbeit als Beispiele genannt?
Die Arbeit erläutert die Auswirkungen anhand des Positivbeispiels Novartis und des Negativbeispiels Nestlé.
- Citation du texte
- Inessa Koch (Auteur), 2013, Der globale Pakt der Vereinten Nationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263592