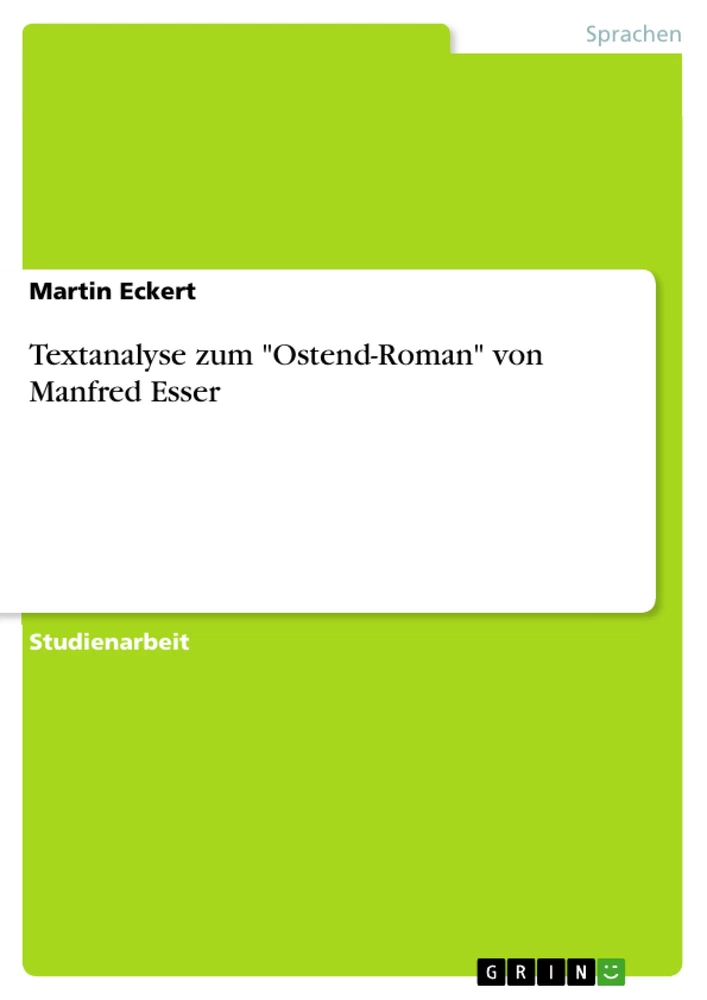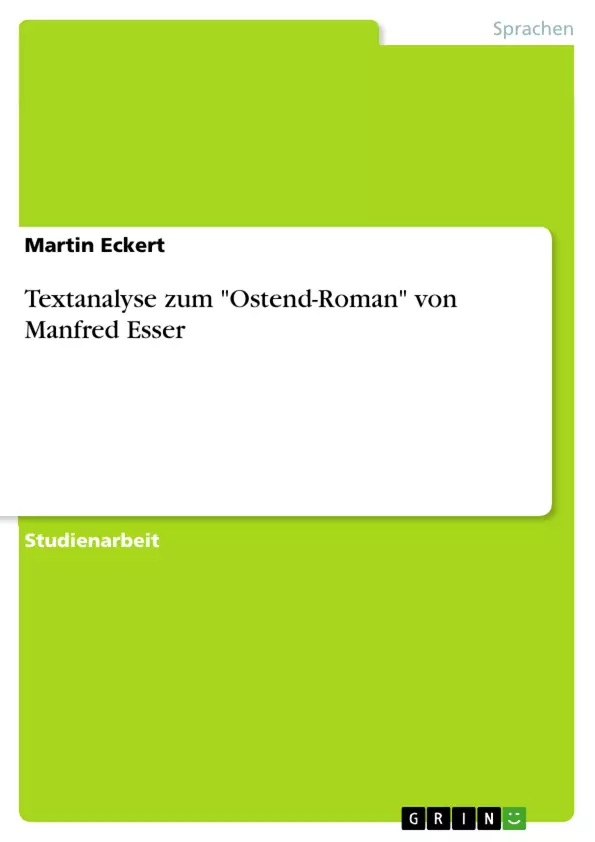Der "Ostend-Roman" von Manfred Esser wirft in 37 kurzen Kapiteln auf 256 Seiten ein Schlaglicht auf etwa sechzehn Stunden im Leben einiger Menschen, die, charakterlich und sozial höchst unterschiedlich in ihre Welt gestellt, dieses Arbeiterviertel im Stuttgarter Osten bewohnen. Indem der Erzähler eine Welt in ihren Nebensächlichkeiten schildert und sie, "sinnfällig, an ihnen erkennen" will, beschreibt er so den Arbeits- und Familienalltag der Menschen, spürt ihren Gefühlen, Wünschen, Konflikten und Zwängen nach bis hin zu den politischen Auseinandersetzungen, die in diesem Sommer des Jahres 1973 diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung, Fabel
- Handelnde Personen
- Motive
- Raum und Zeit
- Komposition und Sprachstil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der "Ostend-Roman" von Manfred Esser bietet einen Einblick in das Leben von Menschen, die in einem Stuttgarter Arbeiterviertel leben. Der Roman schildert den Alltag dieser Figuren, ihre Gefühle, Konflikte und Zwänge vor dem Hintergrund der politischen Auseinandersetzungen im Sommer 1971.
- Alltagsleben und soziale Konflikte in einem Arbeiterviertel
- Entfremdung und Resignation der Protagonisten
- Die Rolle von Politik und Ideologie in der Alltagswelt
- Die Grenzen zwischen privater und öffentlicher Sphäre
- Das Streben nach Glück und Sinn in einer enttäuschenden Welt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung, Fabel: Die Einleitung stellt den Rahmen des Romans vor und skizziert die Lebenswelt der Protagonisten im Stuttgarter Ostend. Der Fokus liegt auf dem alltäglichen Leben der Figuren, ihren Gefühlen und Konflikten.
- Handelnde Personen: In diesem Kapitel werden die wichtigsten Personen vorgestellt, die im Roman eine Rolle spielen. Es wird deutlich, dass diese Figuren trotz ihres gemeinsamen Wohnortes unterschiedliche Lebensentwürfe verfolgen und wenig Gemeinsamkeiten haben.
- Motive: Dieses Kapitel befasst sich mit zentralen Motiven des Romans, wie z.B. der Suche nach Glück, der Enttäuschung, der Entfremdung und den Schwierigkeiten, in einer komplexen Welt seinen Platz zu finden.
Schlüsselwörter
Der "Ostend-Roman" befasst sich mit Themen wie dem Alltag in einem Arbeiterviertel, Entfremdung, Resignation, soziale Konflikte, Politik, Ideologie, Glück und Sinnfindung in einer enttäuschenden Welt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema des "Ostend-Romans" von Manfred Esser?
Der Roman thematisiert den Arbeits- und Familienalltag sowie die sozialen Konflikte von Bewohnern eines Stuttgarter Arbeiterviertels im Sommer 1973.
Welchen zeitlichen Rahmen umfasst die Handlung des Romans?
Die Handlung wirft ein Schlaglicht auf etwa sechzehn Stunden im Leben der Charaktere vor dem Hintergrund der politischen Auseinandersetzungen des Jahres 1973.
Welche Rolle spielt der Erzähler im "Ostend-Roman"?
Der Erzähler schildert die Welt in ihren Nebensächlichkeiten, um Gefühle, Wünsche und Zwänge der Menschen sinnfällig erkennbar zu machen.
Wie werden die handelnden Personen im Buch charakterisiert?
Die Figuren sind charakterlich und sozial höchst unterschiedlich und verfolgen trotz des gemeinsamen Wohnortes verschiedene Lebensentwürfe mit wenigen Gemeinsamkeiten.
Was sind die zentralen Motive der Textanalyse?
Zentrale Motive sind die Suche nach Glück, Entfremdung, Resignation und die Schwierigkeit, in einer komplexen Welt einen Platz zu finden.
Welche gesellschaftlichen Bereiche werden im Roman untersucht?
Die Analyse untersucht die Grenzen zwischen privater und öffentlicher Sphäre sowie die Rolle von Politik und Ideologie in der Alltagswelt.
- Quote paper
- M.A. Martin Eckert (Author), 1996, Textanalyse zum "Ostend-Roman" von Manfred Esser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263702