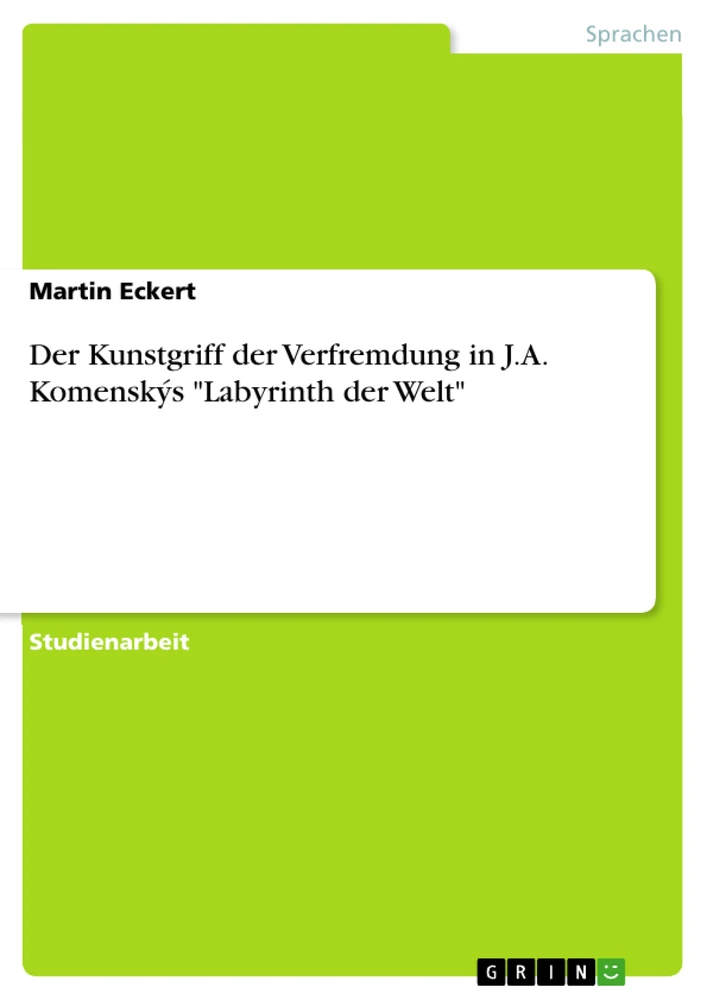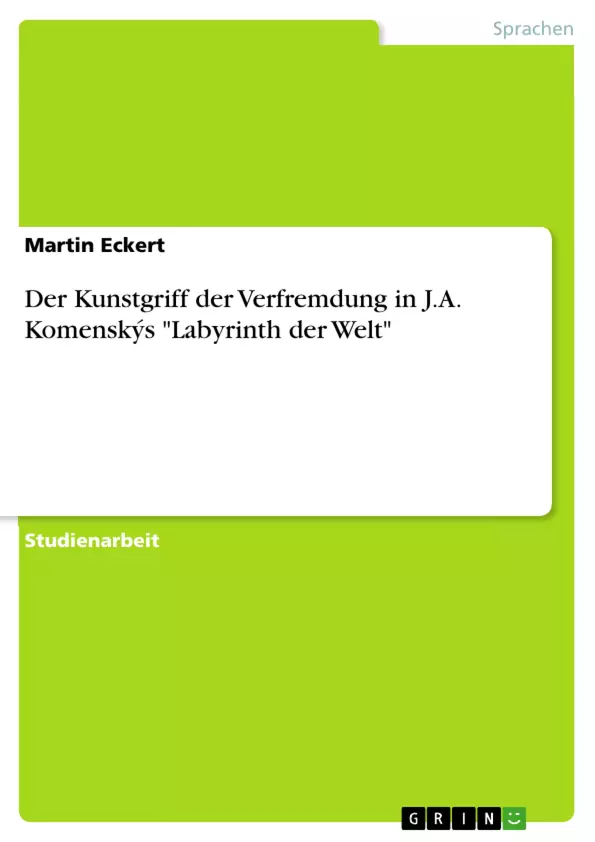Ein Vergleich von J.A. Comenius` 1631 erschienenem Roman "Das Labyrinth der Welt" mit René Descartes' "Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs" (1637) führt über die Anthropologie Arnold Gehlens zur Kunsttheorie von Viktor Sklovskij.
Inhaltsverzeichnis
- Komenský und Descartes - zwei Denker des Barock
- Eine Theorie der Wahrnehmung
- Hand - Auge - Sprache: Wahrnehmung und die Kategorie der Entlastung bei Arnold Gehlen
- Die >Verfremdung< und das ›Neue Sehen‹ bei Viktor Šklovskij
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Jan Amos Komenskýs Roman »Das Labyrinth der Welt« und untersucht, wie der Autor den Kunstgriff der Verfremdung einsetzt, um die Wahrnehmung der Welt neu zu gestalten. Der Text setzt den Roman in den Kontext der Barockzeit und beleuchtet die Parallelen zu René Descartes' »Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs«.
- Die Bedeutung der empirischen Erfahrung und der Vernunft im Barock
- Die Kritik an traditionellen Autoritäten und die Suche nach neuen Wahrheiten
- Die Rolle der Verfremdung als Mittel der Erkenntnis
- Die Bedeutung der Selbstfindung und der individuellen Entscheidung in der Barockzeit
- Die Auseinandersetzung mit dem Problem des Wissens und der Grenzen menschlichen Erkennens
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel stellt Jan Amos Komenský und René Descartes als zentrale Denker des Barock vor und untersucht ihre jeweilige Auseinandersetzung mit der Frage nach der richtigen Methode des Vernunftgebrauchs. Es beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansätzen und betont die Bedeutung von Erfahrung und Vernunft für ihre Erkenntnistheorie.
- Das zweite Kapitel widmet sich der Theorie der Wahrnehmung, die in beiden Werken eine zentrale Rolle spielt. Es analysiert, wie die beiden Autoren die Wahrnehmung als einen aktiven Prozess begreifen, der durch die Sinne und die Vernunft geprägt wird. Die Kapitel behandelt auch die Bedeutung der Sprache und der Kommunikation für die Bildung von Erkenntnis.
- Das dritte Kapitel untersucht die Kategorien der Wahrnehmung und der Entlastung bei Arnold Gehlen und zeigt die Relevanz seiner Theorie für das Verständnis des Kunstgriffes der Verfremdung in Komenskýs Roman.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Verfremdung und dem ›Neuen Sehen‹ bei Viktor Šklovskij. Es zeigt, wie die Verfremdung als künstlerisches Mittel dazu dient, die Wahrnehmung zu verändern und neue Erkenntnisse zu ermöglichen. Es werden zudem Parallelen zu Komenskýs Vorgehen im »Labyrinth der Welt« gezogen.
Schlüsselwörter
Barockliteratur, Jan Amos Komenský, René Descartes, Verfremdung, Wahrnehmung, Vernunft, Erfahrung, Erkenntnis, Weltbild, Selbstfindung, Individualität, >Neues Sehen‹, Viktor Šklovskij.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Labyrinth der Welt" von Komenský?
Es ist ein berühmter tschechischer Roman des Barock (1631), der die Welt als verwirrendes Labyrinth darstellt, in dem der Mensch nach Wahrheit sucht.
Was bedeutet "Verfremdung" in diesem Werk?
Verfremdung ist ein Kunstgriff, um alltägliche Dinge neu und kritisch wahrzunehmen, indem sie aus ihrem gewohnten Kontext gerissen werden.
Wie hängen Komenský und Descartes zusammen?
Beide Denker des Barock suchten nach einer Methode des richtigen Vernunftgebrauchs, wobei Komenský stärker auf literarische Bilder und Descartes auf Logik setzte.
Welche Rolle spielt Viktor Šklovskij in der Analyse?
Šklovskijs Theorie des "Neuen Sehens" durch Verfremdung wird genutzt, um Komenskýs literarische Technik modern-theoretisch zu erklären.
Was kritisiert Komenský in seinem Roman?
Er kritisiert die Eitelkeit der Welt, die Unzulänglichkeit menschlichen Wissens und die Verblendung der Gesellschaft durch traditionelle Autoritäten.
- Arbeit zitieren
- M.A. Martin Eckert (Autor:in), 2004, Der Kunstgriff der Verfremdung in J.A. Komenskýs "Labyrinth der Welt", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263703