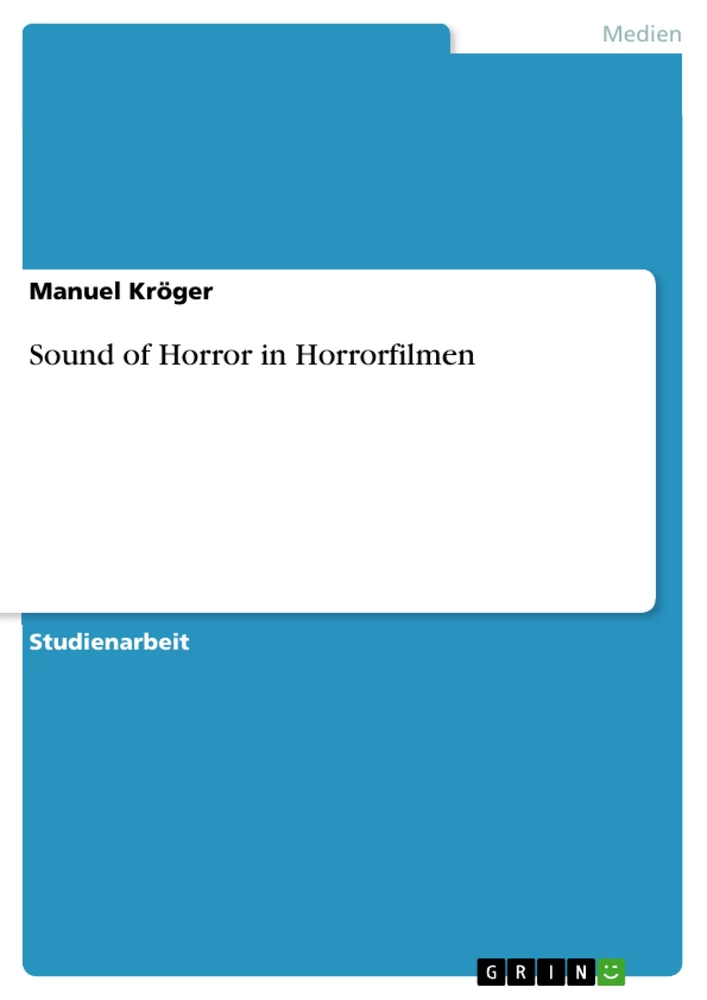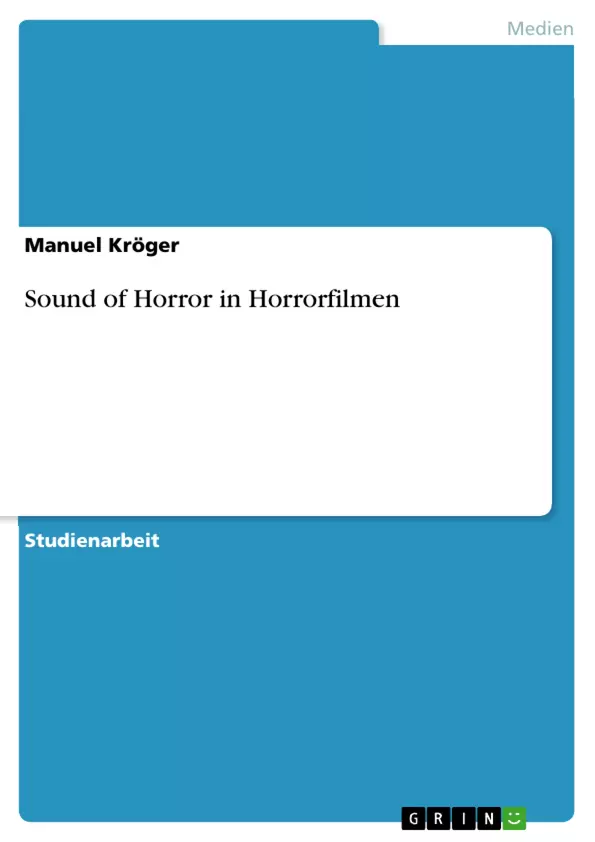Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Sound in Horrorfilmen: braucht der Horrorfilm Sound, was wäre er ohne ihn? Welche Sounds erzeugen Horror und warum? Was ist eigentlich Horror und Angst, wie und wodurch entsteht diese? Diese Abhandlung befasst sich zuerst mit den Grundlegenden psychologischen Fragen, um auf dieser Basis die Wirkung von Horrorfilmen und den Sounds in diesen zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychologie des Horrors
- Was ist und wovor haben wir Angst?
- Was ist der Reiz des Horrorfilms?
- Sound im Film: Sound und Emotionen
- Wie wichtig ist Sound für den Film?
- Soundscapes des Horrors
- Wie erzeugen Soundscapes Horror?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Soundscapes in Horrorfilmen und untersucht sie auf Gemeinsamkeiten, Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten, um herauszufinden, welche Sounds wie und warum Furcht im Zuschauer hervorrufen. Dabei wird zunächst auf die Frage eingegangen, was Horror, Angst und Furcht sind, wie sie entstehen und welcher Reiz dem Horrorfilm innewohnt. Anschließend wird die Rolle des Sounds im Film beleuchtet, mit besonderem Fokus auf die Erzeugung von Emotionen beim Rezipienten. Die Untersuchung bezieht sich dabei hauptsächlich auf den amerikanischen und asiatischen Film, da aus diesen beiden Kulturbereichen die meisten und wichtigsten Horrorfilme stammen.
- Die Psychologie des Horrors und die Entstehung von Angst
- Der Reiz des Horrorfilms und seine Wirkung auf den Zuschauer
- Die Rolle des Sounds im Film und seine Bedeutung für die Emotionen des Rezipienten
- Die Erzeugung von Horror durch Soundscapes
- Untersuchung von Gemeinsamkeiten, Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten in den Soundscapes von Horrorfilmen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Horrorfilm ist ein wichtiger Bestandteil der Unterhaltung geworden, der sowohl stark frequentiert ist und treue Fans besitzt, als auch polarisiert und die Medienästhetik stimuliert. Die Arbeit befasst sich mit den Soundscapes in Horrorfilmen und untersucht sie auf Gemeinsamkeiten, Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten, um herauszufinden, welche Sounds wie und warum Furcht im Zuschauer hervorrufen.
Psychologie des Horrors
Der Horrorfilm bedient sich an Urängsten und negativen Erfahrungen der Kindheit, um beim Zuschauer Angst und Furcht zu erzeugen. Es wird erläutert, wie Angst und Furcht entstehen und welche Rolle das Unheimliche im Horrorfilm spielt.
Sound im Film: Sound und Emotionen
Der Sound im Film ist ein entscheidender Faktor für die Emotionen des Rezipienten. Es wird die Bedeutung des Sounds für die Filmwahrnehmung hervorgehoben und untersucht, wie Soundscapes Emotionen erzeugen.
Soundscapes des Horrors
Die Arbeit untersucht, wie Soundscapes in Horrorfilmen eingesetzt werden, um Furcht zu erzeugen. Es werden Gemeinsamkeiten, Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten in den Soundscapes von Horrorfilmen analysiert.
Schlüsselwörter
Horrorfilm, Soundscapes, Angst, Furcht, Emotionen, Sounddesign, Filmanalyse, Urängste, Unheimlichkeit, Amerikanischer Film, Asiatischer Film.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Sound für Horrorfilme so wichtig?
Sound ist ein entscheidender Faktor für die Erzeugung von Emotionen und Urängsten; er verstärkt das Unheimliche und die Spannung oft stärker als das Bild allein.
Was sind "Soundscapes des Horrors"?
Dies sind akustische Landschaften aus Geräuschen und Musik, die gezielt eingesetzt werden, um Furcht und eine bedrohliche Atmosphäre beim Zuschauer zu schaffen.
Wie entsteht Angst durch Töne?
Horror-Sounds bedienen sich oft an Urängsten oder negativen Kindheitserfahrungen, die psychologische Reaktionen wie Furcht und Unwohlsein auslösen.
Welche kulturellen Unterschiede im Horror-Sound gibt es?
Die Arbeit untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Soundgestaltung zwischen amerikanischen und asiatischen Horrorfilmen.
Was ist der psychologische Reiz des Horrorfilms?
Der Reiz liegt oft in der kontrollierten Erfahrung von Angst und der darauffolgenden Erleichterung, was eine starke emotionale Wirkung auf den Zuschauer hat.
- Arbeit zitieren
- B.A. Manuel Kröger (Autor:in), 2013, Sound of Horror in Horrorfilmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263730