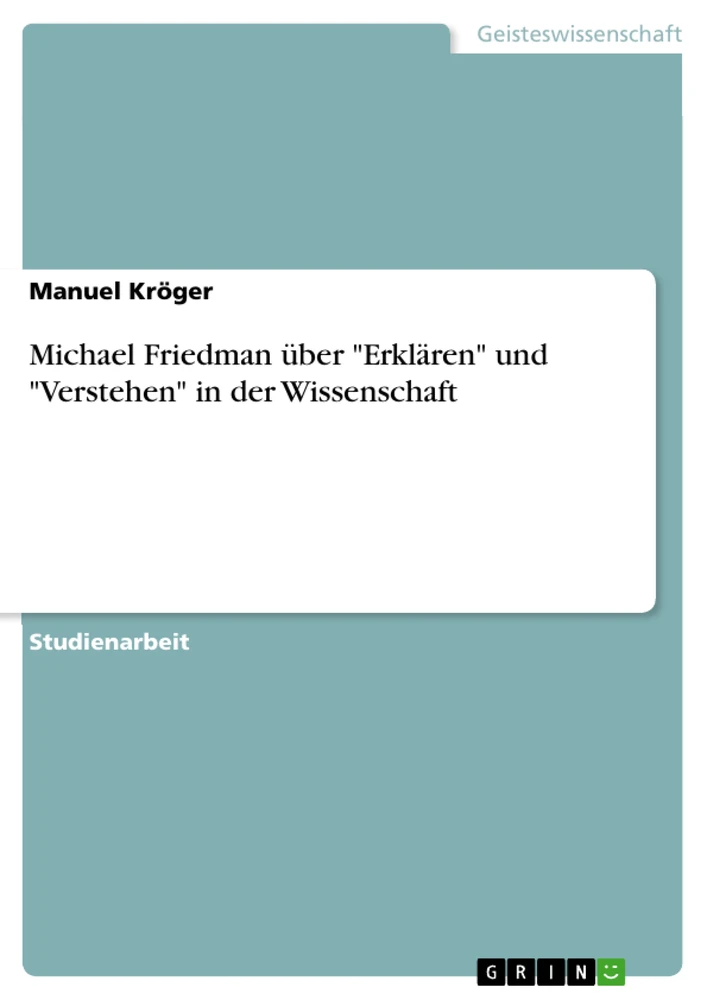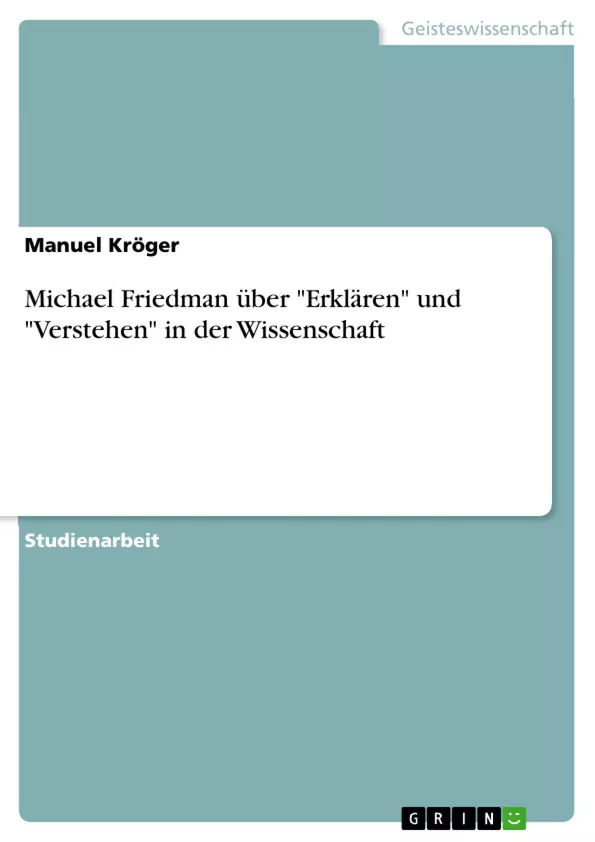Dinge erklären und verstehen zu wollen, ist für uns Menschen ein Grundbedürfnis. Wir sind neugierig und wollen wissen, warum eine Sache ist, wie sie ist. Warum z. B. hat das Haus gebrannt? Der Blitz ist darin eingeschlagen und hat es in Brand gesteckt. Was kann dagegen getan werden? Metall leitet Strom, der Blitz sucht sich immer die höchste Stelle, in die er einschlagen kann, bei Erdung wird die Kraft des Blitzes abgeleitet. Aus diesen Erkenntnissen baute man den Blitzableiter für das Haus. So wurde das Haus davor geschützt, dass der Blitz erneut einschlägt. Also befriedigt das Verstehen und Erklären nicht nur die Neugier, sondern hat auch einen praktischen Nutzen: der Mensch kann gezielt seine Umwelt beeinflussen. So sind unsere primitivsten Werkzeuge, unsere kompliziertesten Computer und unsere Wissenschaften entstanden. Doch wie funktioniert der Prozess des Erklärens und Verstehens? Was für Arten des Erklärens gibt es und wie hängt Erklären und Verstehen zusammen, wie beziehen sich diese beiden Vorgänge aufeinander? Welche Eigenschaften muss eine Erklärung besitzen, um der Wissenschaft zu genügen?
Diesen Fragen ist Friedman nachgegangen. Hier wird sich auf Friedman und seinen Aufsatz Explanation and Scientific Understanding bezogen und dessen Kernpunkte wiedergegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Was bedeutet „Erklären“ und „Verstehen“ und welchen Nutzen haben sie für uns?
- Erklärungsmodelle
- Das D-N-Modell
- Unvertrautes durch Vertrautes erklären
- Der,,'intellectual fashion' view"
- Die drei unabdingbaren Eigenschaften für eine Erklärungstheorie
- Eigenschaft 1: Hinreichende Allgemeingültigkeit
- Eigenschaft 2: Objektivität
- Eigenschaft 3: Verbindung von Erklären und Verstehen
- Definitionen
- Partition
- K-Atomarität
- K-Partition
- K-Kardinalität
- Reduktion
- Globalität
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Aufsatz „Explanation and Scientific Understanding“ von Michael Friedman untersucht verschiedene Erklärungsmodelle und erörtert deren Vor- und Nachteile. Er befasst sich mit dem Ziel, ein gültiges und brauchbares Erklärungsmodell für wissenschaftliche Phänomene zu finden.
- Analyse verschiedener Erklärungsmodelle
- Kritik an bestehenden Modellen
- Suche nach einem umfassenderen Erklärungsansatz
- Bedeutung von Verständnis und Erklären in der Wissenschaft
- Verbindung von Erklären und Verstehen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Was bedeutet „Erklären“ und „Verstehen“ und welchen Nutzen haben sie für uns?
Der erste Abschnitt des Aufsatzes beleuchtet die Grundbedürfnisse des Menschen, Dinge zu erklären und verstehen zu wollen. Er diskutiert die Motivation für diese Suche nach Erklärungen und deren praktischen Nutzen, z.B. die Entwicklung von Werkzeugen und Technologien.
2. Erklärungsmodelle
In diesem Kapitel stellt Friedman drei populäre Erklärungsmodelle vor und analysiert ihre Stärken und Schwächen:
2.1 Das D-N-Modell
Friedman erläutert das D-N-Modell (Deductive-Nomological Model), welches von Hempel und Oppenheim entwickelt wurde. Er stellt fest, dass das Modell zwar Vorhersagen treffen kann, aber nicht zwangsläufig zu einem Verständnis des Ereignisses führt.
2.2 Unvertrautes durch Vertrautes erklären
Dieses Modell beschreibt die gängige Praxis, unbekannte Sachverhalte mit vertrauten Phänomenen zu erklären. Der Autor argumentiert, dass diese Methode nicht zwangsläufig zu einem tieferen Verständnis führt.
2.3 Der,,'intellectual fashion' view"
Friedman präsentiert die Sichtweise, dass die Verwendung von bestimmten Erklärungen von der jeweiligen Epoche und den jeweiligen wissenschaftlichen Idealen abhängt. Er diskutiert die Bedeutung von Voraussagekraft und den Wandel von wissenschaftlichen Theorien.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Konzepte des Textes sind: Erklären, Verstehen, Erklärungsmodelle, Deduktiv-Nomologisches Modell, D-N Modell, Vertrautheits-Modell, intellektuelle Mode, wissenschaftliche Erklärung, wissenschaftliches Verständnis, Voraussagekraft, Erkenntnis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von Michael Friedmans Aufsatz über wissenschaftliches Verstehen?
Friedman untersucht, wie der Prozess des Erklärens und Verstehens in der Wissenschaft funktioniert und welche Kriterien eine Theorie erfüllen muss, um echtes Verständnis zu erzeugen.
Welche Kritik übt Friedman am D-N-Modell (Hempel-Oppenheim)?
Er stellt fest, dass das deduktiv-nomologische Modell zwar präzise Vorhersagen ermöglicht, aber nicht zwangsläufig zu einem tieferen Verständnis des Phänomens führt.
Welche drei Eigenschaften muss eine Erklärungstheorie laut Friedman besitzen?
Eine Erklärungstheorie muss hinreichend allgemeingültig sein, Objektivität besitzen und eine klare Verbindung zwischen Erklären und Verstehen herstellen.
Was bedeutet der „intellectual fashion view“ in der Wissenschaft?
Dies beschreibt die Sichtweise, dass wissenschaftliche Erklärungen oft von den Idealen und dem Zeitgeist der jeweiligen Epoche abhängen.
Warum ist das Erklären und Verstehen für den Menschen so wichtig?
Es befriedigt nicht nur die natürliche Neugier, sondern hat einen praktischen Nutzen: Es ermöglicht dem Menschen, seine Umwelt gezielt zu beeinflussen und Technologien zu entwickeln.
- Quote paper
- B.A. Manuel Kröger (Author), 2012, Michael Friedman über "Erklären" und "Verstehen" in der Wissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263763