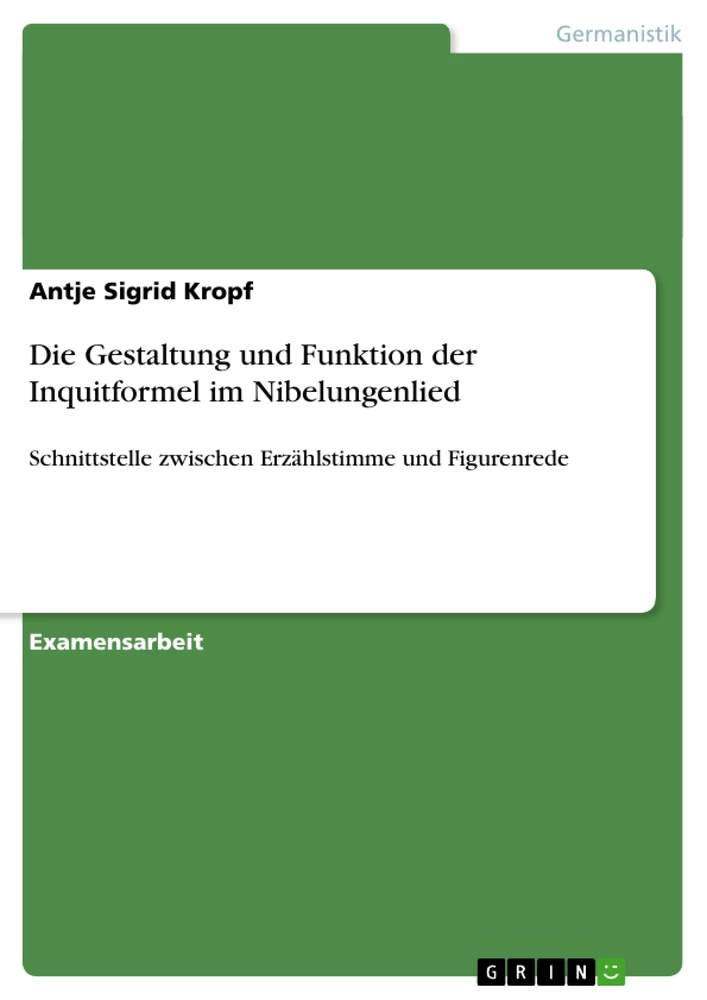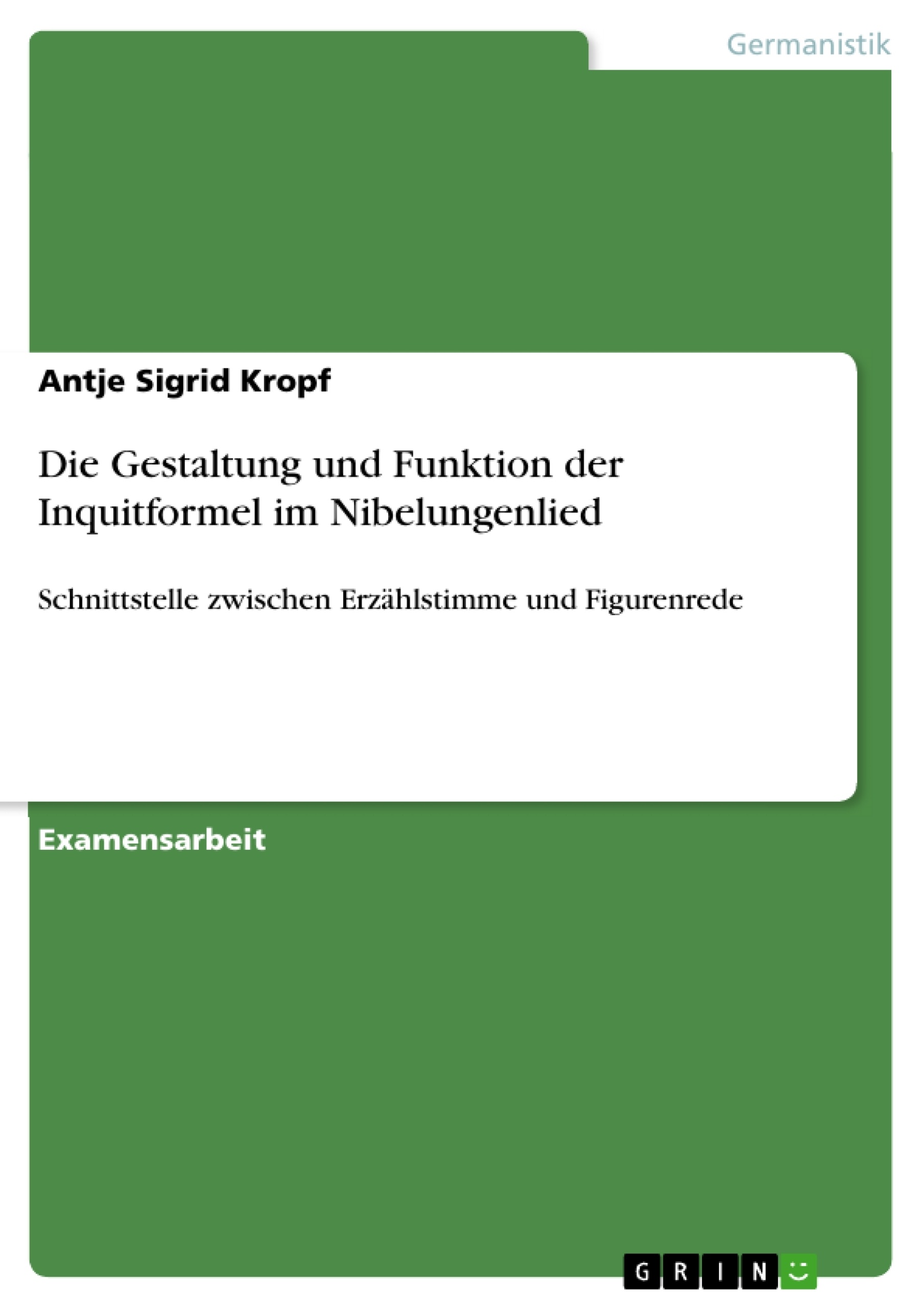Das wachsende Interesse an Erzählstimme und Figurenrede hat deren Bindeglied, die Inquitformel, bisher noch nicht in all ihren Facetten zum Gegenstand der Forschung werden lassen. Ziel der Arbeit ist es daher, sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Analyse der Inquitformeln im Nibelungenlied vorzunehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Erzählen im Nibelungenlied
- Forschungsspektrum
- Erzähltheorie als neuer Forschungsschwerpunkt
- Zwei Forschungsinteressen mit einem gemeinsamen Kern
- Mediävistische Erzähltheorie
- Inszeniertes Erzählen
- Die Inquitformel als Untersuchungsgegenstand
- Auswertung des Textmaterials
- Die Handschriften B und C im Vergleich
- Gestaltung und Funktion der Inquitformel
- Anpassung der erzähltheoretischen Terminologie
- Gestaltungselemente und ihre Funktion
- Position
- Umfang der Inquitformeln
- Länge
- An- und Abvers
- Gestaltung
- Namen, Pronomen und nominale Bezeichnung
- Adverbien und adverbiale Bestimmungen
- Konjunktionen
- Attribute
- Ergänzungen durch Objekte
- Figurencharakterisierung
- Möglichkeiten der Figurencharakterisierung
- Figur oder Charakter
- Figurencharakterisierung an konkreten Beispielen
- Dankwart
- Siegfried
- Kriemhild
- Hagen
- Fazit aus dem Vergleich der Figuren
- Schnittstelle zwischen Erzählstimme und Figurenrede
- Die Rolle der Erzählstimme
- Untersuchung der Redeszene „Ankunft und Begrüßung am Hof“
- Siegfrieds Ankunft am Wormser Hof
- Ankunft der Burgunden am Hof Etzels
- Fazit aus dem Vergleich der Ankunftsszenen
- Schnittstelle mit vielfältigen Funktionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Gestaltung und Funktion der Inquitformel im Nibelungenlied. Sie analysiert quantitative und qualitative Aspekte der Inquitformeln im Text, untersucht ihre Position, ihren Umfang und ihre Gestaltungselemente.
- Analyse der Gestaltungselemente der Inquitformel
- Untersuchung der Funktion der Inquitformel in Bezug auf Figurencharakterisierung
- Bedeutung der Inquitformel als Schnittstelle zwischen Erzählstimme und Figurenrede
- Die Rolle der Inquitformel im Rahmen der mittelalterlichen Erzähltradition
- Die Inquitformel als Mittel der Inszenierung der Redeszenen im Nibelungenlied
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Forschung zum Nibelungenlied und beleuchtet die Entwicklung der Erzähltheorie als neuen Forschungsschwerpunkt. Dabei werden verschiedene Forschungsansätze vorgestellt, die sich mit der Struktur des Werkes auseinandersetzen, darunter die Untersuchung von formelhaften Wendungen und die Analyse der Mikrostruktur der Erzählung.
Kapitel zwei widmet sich der Inquitformel als Untersuchungsgegenstand. Es werden die Auswertung des Textmaterials und der Vergleich der Handschriften B und C behandelt. Zudem wird die Gestaltung und Funktion der Inquitformel analysiert, wobei die Anpassung der erzähltheoretischen Terminologie eine wichtige Rolle spielt.
Kapitel drei analysiert die Gestaltungselemente der Inquitformeln, darunter ihre Position, ihren Umfang, ihre Gestaltung und ihre Funktion. Es werden verschiedene Aspekte wie die Länge, die An- und Abvers, die Verwendung von Namen, Pronomen und nominalen Bezeichnungen, sowie Adverbien, Konjunktionen und Attribute untersucht.
Kapitel vier befasst sich mit der Figurencharakterisierung im Nibelungenlied und beleuchtet verschiedene Möglichkeiten der Figurencharakterisierung. Es wird untersucht, inwiefern die Inquitformel dazu beitragen kann, Figuren zu charakterisieren. Anhand konkreter Beispiele wie Dankwart, Siegfried, Kriemhild und Hagen wird die Funktionsweise der Inquitformel in diesem Zusammenhang näher betrachtet.
Das fünfte Kapitel untersucht die Inquitformel als Schnittstelle zwischen Erzählstimme und Figurenrede. Es wird die Rolle der Erzählstimme und die Gestaltung von Redeszenen analysiert, anhand von Beispielen wie Siegfrieds Ankunft am Wormser Hof und der Ankunft der Burgunden am Hof Etzels.
Schlüsselwörter
Nibelungenlied, Inquitformel, Erzähltheorie, Figurenrede, Erzählstimme, Redeszene, Gestaltungselemente, Figurencharakterisierung, Handschriften, mittelhochdeutsche Literatur, Mediävistik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Inquitformel?
Eine Inquitformel ist ein Bindeglied zwischen Erzählstimme und Figurenrede, zum Beispiel Wendungen wie „er sprach“ oder „sie sagte“, die eine direkte Rede einleiten.
Welche Funktion hat die Inquitformel im Nibelungenlied?
Sie dient nicht nur der Redeeinleitung, sondern auch der Figurencharakterisierung und der Inszenierung von Redeszenen innerhalb der mittelalterlichen Erzähltradition.
Wie unterscheiden sich die Handschriften B und C des Nibelungenliedes?
Die Arbeit vergleicht quantitativ und qualitativ, wie Inquitformeln in den verschiedenen Handschriften gestaltet sind, was Rückschlüsse auf unterschiedliche Erzählstile zulässt.
Können Inquitformeln Charaktere wie Siegfried oder Hagen beschreiben?
Ja, durch die Wahl der Adverbien, Attribute und Bezeichnungen innerhalb der Formel kann der Erzähler die soziale Stellung oder die aktuelle Stimmung der sprechenden Figur unterstreichen.
Was bedeutet „inszeniertes Erzählen“ in diesem Kontext?
Es beschreibt die bewusste Gestaltung von Szenen (wie Ankunftsszenen am Hof), in denen die Redeeinleitung dazu genutzt wird, die dramatische Wirkung und die Interaktion der Figuren hervorzuheben.
- Quote paper
- Antje Sigrid Kropf (Author), 2012, Die Gestaltung und Funktion der Inquitformel im Nibelungenlied, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263771