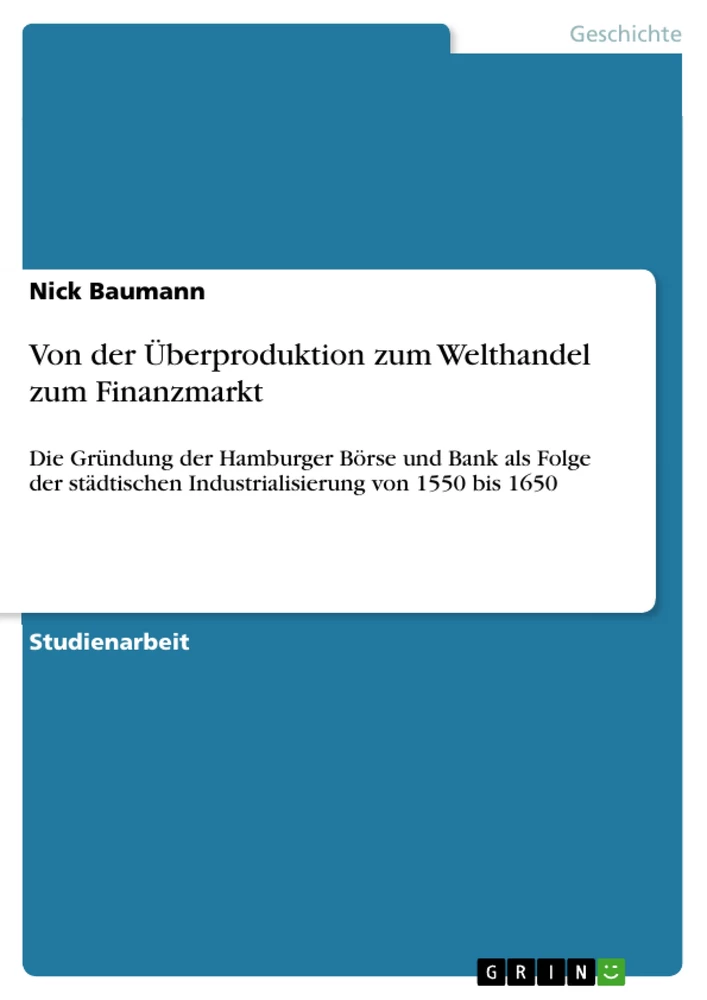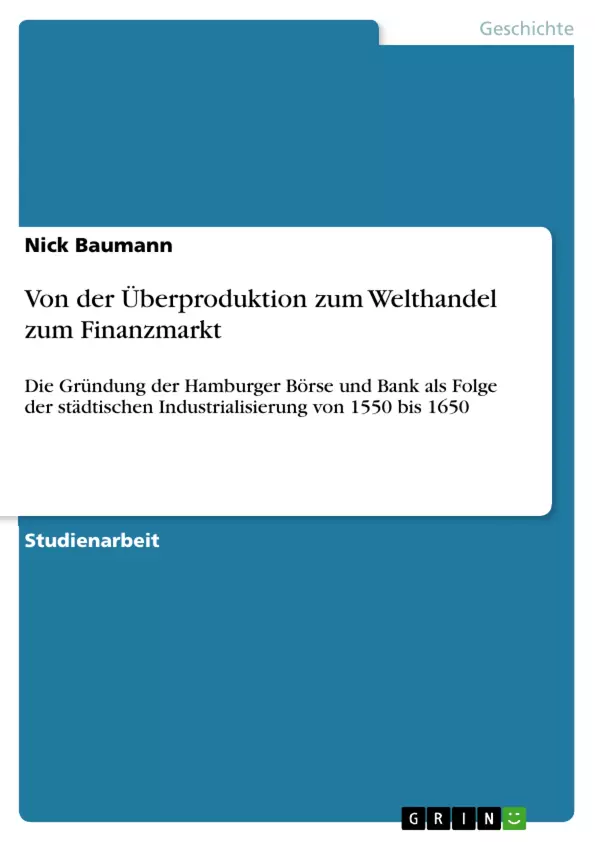Die neueren Wirtschaftstheorien verstehen den Finanzmarkt als Bedingung für die Produktion. Wachsende Produktionsanlagen, moderne Maschinen sowie hohe Personalkosten bedingen u.a. die Aufnahme und Investition von Kapital. Dieses Kapital wird vom Finanzmarkt bereitgestellt. Die Vermarktung der jeweiligen Produkte findet in dieser Abfolge zuletzt statt und dient dem Kapitalrückfluss - vornehmlich zur Deckung des Fremdkapitals.Daraus leitet sich ab, dass sich Finanzmärkte erst mit zunehmender Größe der Betriebe, komplexer Arbeitsorganisation und der Maschinisierung der Produktion ausbilden konnten. Eine solche wirtschaftliche Entwicklung wird meist mit der Industriellen Revolution und der 1769 patentierten Dampfmaschine von James Watt oder der „Spinning Jenny“ von James Hargreaves verknüpft. Doch ähnlich wie Alexander G. Bell nicht gleich das iPhone patentierte, so hatte auch die industrielle Revolution technologische Vorläufer. Im Bereich des Textilgewerbes lassen sich erste Mechanisierungen anhand der Seidenzwirnmühle bereits zum Ende des 13. Jahrhunderts ausmachen1. Ebenfalls lässt sich die Gründung der Hamburger Börse auf das Jahr 1558 und die Gründung der Hamburger Bank als Girobank auf das Jahr 1619 datieren. Somit sind zeitliche Zusammenhänge zwischen der Gründung von Finanzintermediären und neuen Technologien zunächst nicht offensichtlich. Dennoch bleibt
die Frage, inwieweit eine Kausalverknüpfung zwischen der Industrialisierung eines Staates und dem Ausbilden eines Finanzmarktes besteht. In diesem Kontext bleibt auch zu klären,warum gerade in Hamburg schon früh Institutionen wie die Börse und Bank gegründet wurden.
In dieser Arbeit wird dabei der Ausgestaltung des Handelswesens eine zentrale Rolle zugesprochen. Als Ausgangspunkt der Argumentation sollen hier organisatorische, mechanische und verfahrenstechnische Neuerungen angeführt werden, welche zur regionalen Überproduktion und Spezialisierung führten. Dabei wird auch ein Vergleich zu den zuvor bestehenden Produktionsverhältnissen angestrebt, um einen zeitgemäßen gesamtwirtschaftlichen Kontext herzustellen. Im zweiten Abschnitt soll dann der Handel fokussiert werden. Die Produkte, welche im städtischen Rahmen nicht konsumiert werden konnten, wurden exportiert. Somit wurden aus Gütern handelbare Waren. Dies führte zu einer Belebung des Welthandels, welcher zudem durch den Handel mit Kolonien gestärkt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Wirtschaftsgesinnung des Mittelalters
- Wirtschaftlicher Wandel
- Umbruch in der Landwirtschaft
- Gewerbliche Organisationsformen
- Handwerk und Zunft
- Die Heimarbeit
- Das Verlagssystem
- Die Manufaktur
- Technische Neuerungen im Gewerbe
- Aufstieg des Handels
- Der Hamburger Handel
- Zahlungsformen
- Der Hamburger Finanzmarkt
- Die Börse
- Die Hamburger Bank
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung der Hamburger Börse und Bank im Kontext der städtischen Industrialisierung vom 16. bis zum 17. Jahrhundert. Der Fokus liegt darauf, die Kausalverknüpfung zwischen der Industrialisierung und der Entwicklung von Finanzmärkten zu beleuchten, insbesondere im Fall Hamburgs.
- Der Wandel vom Nahrungsprinzip hin zu einer Frühform der Marktwirtschaft
- Die Rolle der regionalen Überproduktion und Spezialisierung im Aufstieg des Handels
- Die Bedeutung von Zahlungsformen und des bargeldlosen Zahlungsverkehrs für die Entwicklung des Finanzmarktes
- Die Funktionen und Bedeutung der Hamburger Börse und Bank als Finanzinstitutionen
- Die Einordnung der Hamburger Entwicklungen in den deutschen und europäischen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt die Thematik der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung des Finanzmarktes für die Produktion. Der zweite Abschnitt beleuchtet die mittelalterliche Wirtschaftsgesinnung, die durch das Nahrungsprinzip geprägt war. Hierbei wird die Bedeutung von Zünften und feudalen Abhängigkeitsverhältnissen hervorgehoben.
Im dritten Abschnitt werden die Veränderungen in der Wirtschaft im Übergang vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit dargestellt. Es werden die Folgen der Agrarkrise, die Entstehung der Marktwirtschaft und die Entwicklung von Spezialisierung und Arbeitsteilung beleuchtet.
Der vierte Abschnitt konzentriert sich auf den Aufstieg des Handels, insbesondere auf den Hamburger Handel, und die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen. Dieser Abschnitt befasst sich zudem mit den Zahlungsformen und dem Einfluss des bargeldlosen Zahlungsverkehrs.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Industrialisierung, Hamburg, Börse, Bank, Finanzmarkt, Handel, Zahlungsformen, Protoindustrialisierung, Marktwirtschaft, Spezialisierung, Arbeitsteilung.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die Hamburger Börse gegründet?
Die Hamburger Börse wurde im Jahr 1558 gegründet, was sie zu einer der ältesten Finanzinstitutionen macht.
Welche Rolle spielte die Hamburger Bank ab 1619?
Sie wurde als Girobank gegründet und ermöglichte den bargeldlosen Zahlungsverkehr, was für den aufstrebenden Welthandel essenziell war.
Wie hängen Industrialisierung und Finanzmärkte zusammen?
Wachsende Produktionsanlagen und Maschinisierung erforderten Kapitalinvestitionen, die durch die Entwicklung von Finanzmärkten bereitgestellt wurden.
Was ist das "Nahrungsprinzip" des Mittelalters?
Es beschreibt eine Wirtschaftsweise, die primär auf die Deckung des Eigenbedarfs und den lokalen Unterhalt ausgerichtet war, statt auf Gewinnmaximierung.
Was führte zur regionalen Überproduktion in Hamburg?
Organisatorische, mechanische und verfahrenstechnische Neuerungen im Gewerbe ermöglichten eine Spezialisierung und höhere Erträge.
Welche gewerblichen Organisationsformen entwickelten sich?
Die Arbeit beschreibt den Wandel von Zünften über die Heimarbeit und das Verlagssystem bis hin zur Manufaktur.
- Arbeit zitieren
- B.Sc. Nick Baumann (Autor:in), 2013, Von der Überproduktion zum Welthandel zum Finanzmarkt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263828