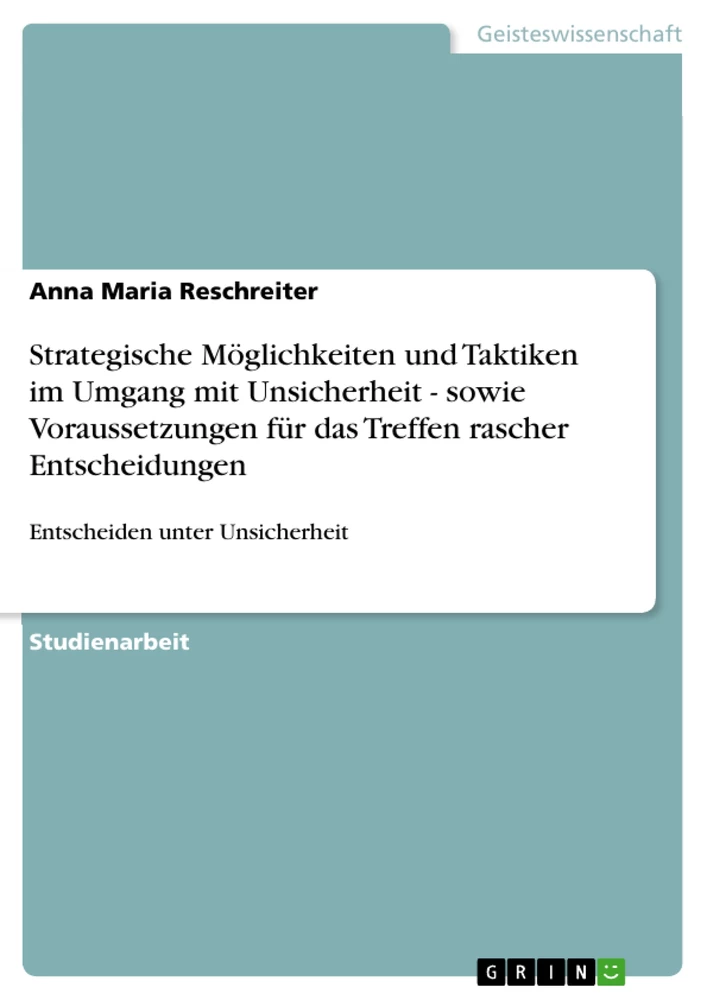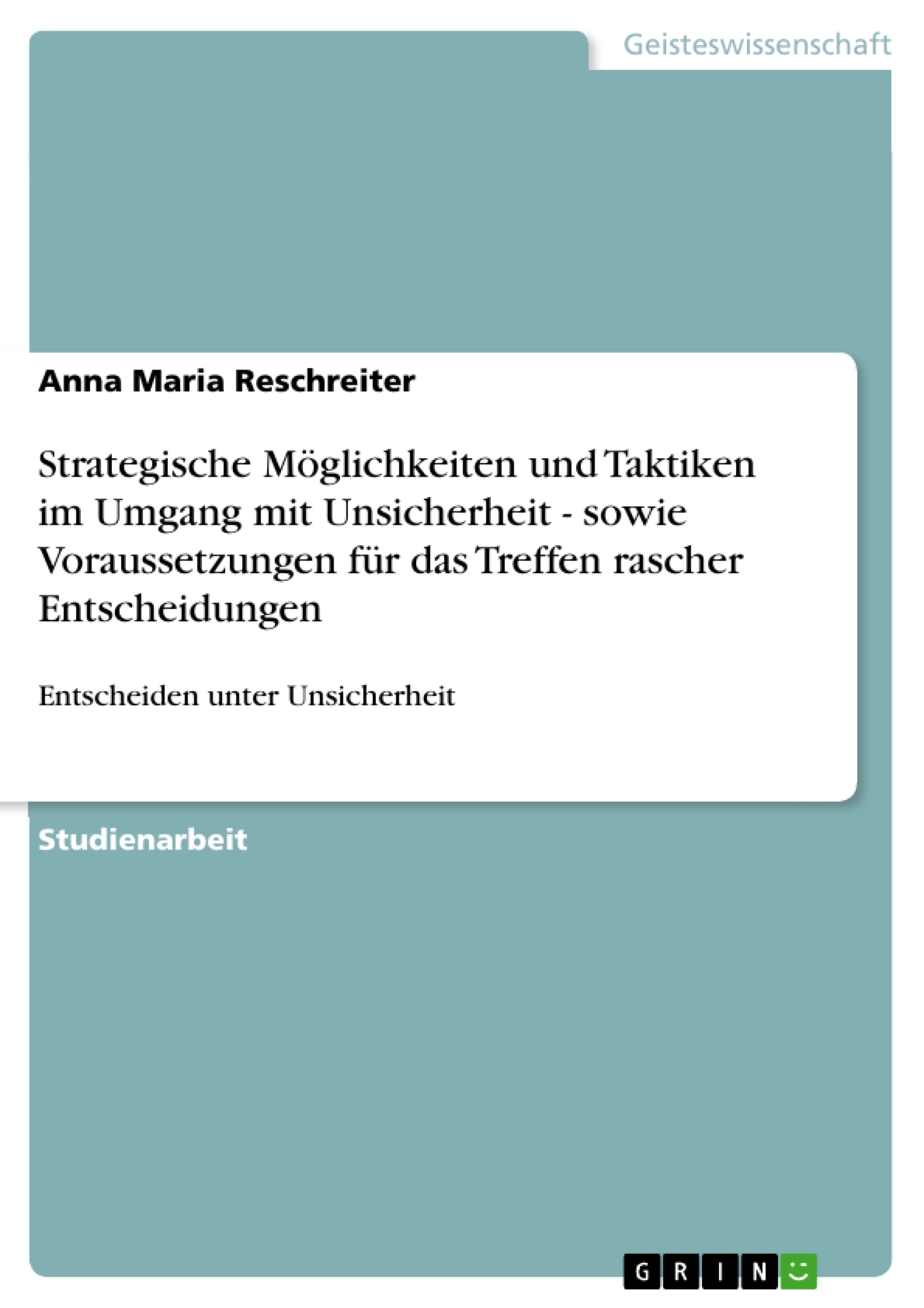„Menschen treffen Entscheidungen mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der sie reden – sie tun es wissentlich oder unwissentlich in einem fort.“ (Kahnemann & Tversky (2011, S. 545). Entscheidungen sind jedoch nicht gleich Entscheidungen (Braun, 2010). So existieren verschiedene Kategorien, in welche die unterschiedlichen Arten von Entscheidungen eingebettet sind (Kirchler, 2011). Eine in der Entscheidungstheorie überaus intensiv analysierte Kategorie, welche ebenso die Kernthematik der vorliegenden Ausarbeitung darstellt, ist die der Entscheidungen unter Unsicherheit (Raab & Unger, 1999).
Die Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, auf Basis eines theoretischen Bezugsrahmens strategische Möglichkeiten und Taktiken bei der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit zu erörtern sowie die Voraussetzung für das Treffen rascher Entscheidungen zu erarbeiten.
Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gliedert sich in vier Hauptschritte, die jeweils einem Kapitel entsprechen. Nachdem der Leser in das Thema der Arbeit eingeführt wurde, erfolgt im zweiten Kapitel die Ausarbeitung eines theoretischen Bezugsrahmens, indem die für die Arbeit grundlegenden Begrifflichkeiten erläutert werden. Darauf aufbauend wird im dritten Kapitel auf die in der Entscheidungstheorie bedeutende Thematik des Treffens von Entscheidungen unter Unsicherheit eingegangen, wobei zunächst auf die grundlegenden Intentionen der Entscheidungstheorie eingegangen sowie das Rahmenmodell des Entscheidungsprozesses vorgesellt wird und anschließend zum einen die strategischen Möglichkeiten und zum anderen die Taktiken bei der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit aufgezeigt werden. Darüber hinaus werden die Voraussetzungen für das Treffen rascher Entscheidungen dargelegt. Abgeschlossen wird die Arbeit im vierten Kapitel mittels eines Fazits.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Zielsetzung der Arbeit
- 1.2. Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretischer Bezugsrahmen
- 2.1. Der Begriff der Entscheidung
- 2.2. Der Begriff der Unsicherheit
- 3. Entscheidungstheorie und Treffen von Entscheidungen
- 3.1. Entscheidungen unter Unsicherheit
- 3.1.1. Strategische Möglichkeiten bei der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit
- 3.1.2. Taktiken bei der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit
- 3.2. Voraussetzungen für das Treffen rascher Entscheidungen
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht strategische Möglichkeiten und Taktiken im Umgang mit Entscheidungen unter Unsicherheit und beleuchtet die Voraussetzungen für schnelles Entscheiden. Sie basiert auf einem theoretischen Bezugsrahmen, der die Kernbegriffe erläutert.
- Der Begriff der Entscheidung und seine verschiedenen Facetten
- Das Konzept der Unsicherheit in Entscheidungssituationen
- Strategische Ansätze zur Entscheidungsfindung unter Unsicherheit
- Taktiken für effektives Entscheiden unter Unsicherheit
- Voraussetzungen für schnelles und effizientes Entscheiden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein, definiert die Zielsetzung – die Erörterung strategischer Möglichkeiten und Taktiken bei Entscheidungen unter Unsicherheit sowie die Erarbeitung der Voraussetzungen für schnelles Entscheiden – und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Es betont die Bedeutung von Entscheidungen unter Unsicherheit als Kernthema der Entscheidungstheorie und verweist auf die Komplexität verschiedener Entscheidungskategorien.
2. Theoretischer Bezugsrahmen: Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament der Arbeit. Es erläutert den Begriff "Entscheidung" anhand verschiedener Definitionen aus der Literatur, wobei die Vielschichtigkeit des Begriffs und unterschiedliche Forschungsansätze hervorgehoben werden. Die zentralen Elemente einer Entscheidung (Optionen, Konsequenzen, Ereignisse) werden definiert, und Einflussfaktoren auf den Schwierigkeitsgrad von Entscheidungen (Offenheit, Zwischenschritte) werden diskutiert. Weiterhin wird der Begriff "Unsicherheit" im Kontext von Entscheidungsprozessen präzisiert, um ein solides Verständnis für die folgenden Kapitel zu schaffen.
3. Entscheidungstheorie und Treffen von Entscheidungen: Das Kernkapitel befasst sich mit Entscheidungen unter Unsicherheit. Es wird auf die grundlegenden Intentionen der Entscheidungstheorie eingegangen und ein Rahmenmodell des Entscheidungsprozesses vorgestellt. Im Detail werden strategische Möglichkeiten und Taktiken zur Entscheidungsfindung unter Unsicherheit analysiert und beschrieben. Schließlich werden die Voraussetzungen für schnelles Entscheiden im Kontext von Unsicherheit erörtert.
Schlüsselwörter
Entscheidung, Unsicherheit, Entscheidungstheorie, strategische Möglichkeiten, Taktiken, schnelle Entscheidungen, Entscheidungsfindung, theoretischer Bezugsrahmen, Konsequenzen, Optionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Strategien und Taktiken bei Entscheidungen unter Unsicherheit
Was ist der Gegenstand der Arbeit?
Die Arbeit untersucht strategische Möglichkeiten und Taktiken im Umgang mit Entscheidungen unter Unsicherheit und beleuchtet die Voraussetzungen für schnelles Entscheiden. Sie basiert auf einem theoretischen Bezugsrahmen, der die Kernbegriffe „Entscheidung“ und „Unsicherheit“ erläutert.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Den Begriff der Entscheidung und seine Facetten, das Konzept der Unsicherheit in Entscheidungssituationen, strategische Ansätze zur Entscheidungsfindung unter Unsicherheit, Taktiken für effektives Entscheiden unter Unsicherheit sowie die Voraussetzungen für schnelles und effizientes Entscheiden.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Bezugsrahmen, ein Kernkapitel zur Entscheidungstheorie und Treffen von Entscheidungen sowie ein Fazit. Die Einleitung definiert die Zielsetzung und beschreibt den Aufbau. Der theoretische Bezugsrahmen erläutert die Kernbegriffe. Das Kernkapitel analysiert strategische Möglichkeiten und Taktiken bei Entscheidungen unter Unsicherheit und erörtert die Voraussetzungen für schnelles Entscheiden.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema ein, definiert die Zielsetzung (Erörterung strategischer Möglichkeiten und Taktiken bei Entscheidungen unter Unsicherheit sowie die Erarbeitung der Voraussetzungen für schnelles Entscheiden) und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie betont die Bedeutung von Entscheidungen unter Unsicherheit und verweist auf die Komplexität verschiedener Entscheidungskategorien.
Was beinhaltet der theoretische Bezugsrahmen?
Der theoretische Bezugsrahmen erläutert den Begriff "Entscheidung" anhand verschiedener Definitionen aus der Literatur, wobei die Vielschichtigkeit des Begriffs und unterschiedliche Forschungsansätze hervorgehoben werden. Zentrale Elemente einer Entscheidung (Optionen, Konsequenzen, Ereignisse) werden definiert, und Einflussfaktoren auf den Schwierigkeitsgrad von Entscheidungen (Offenheit, Zwischenschritte) werden diskutiert. Der Begriff "Unsicherheit" im Kontext von Entscheidungsprozessen wird präzisiert.
Worauf konzentriert sich das Kernkapitel (Kapitel 3)?
Das Kernkapitel befasst sich mit Entscheidungen unter Unsicherheit. Es geht auf die grundlegenden Intentionen der Entscheidungstheorie ein und stellt ein Rahmenmodell des Entscheidungsprozesses vor. Strategische Möglichkeiten und Taktiken zur Entscheidungsfindung unter Unsicherheit werden analysiert und beschrieben. Die Voraussetzungen für schnelles Entscheiden im Kontext von Unsicherheit werden erörtert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Entscheidung, Unsicherheit, Entscheidungstheorie, strategische Möglichkeiten, Taktiken, schnelle Entscheidungen, Entscheidungsfindung, theoretischer Bezugsrahmen, Konsequenzen, Optionen.
Welche Art von Entscheidungen steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Der Fokus liegt auf Entscheidungen unter Unsicherheit. Die Arbeit untersucht, wie man strategisch und taktisch mit solchen Situationen umgeht und wie schnelles Entscheiden in diesem Kontext ermöglicht werden kann.
- Citation du texte
- Anna Maria Reschreiter (Auteur), 2013, Strategische Möglichkeiten und Taktiken im Umgang mit Unsicherheit - sowie Voraussetzungen für das Treffen rascher Entscheidungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263834