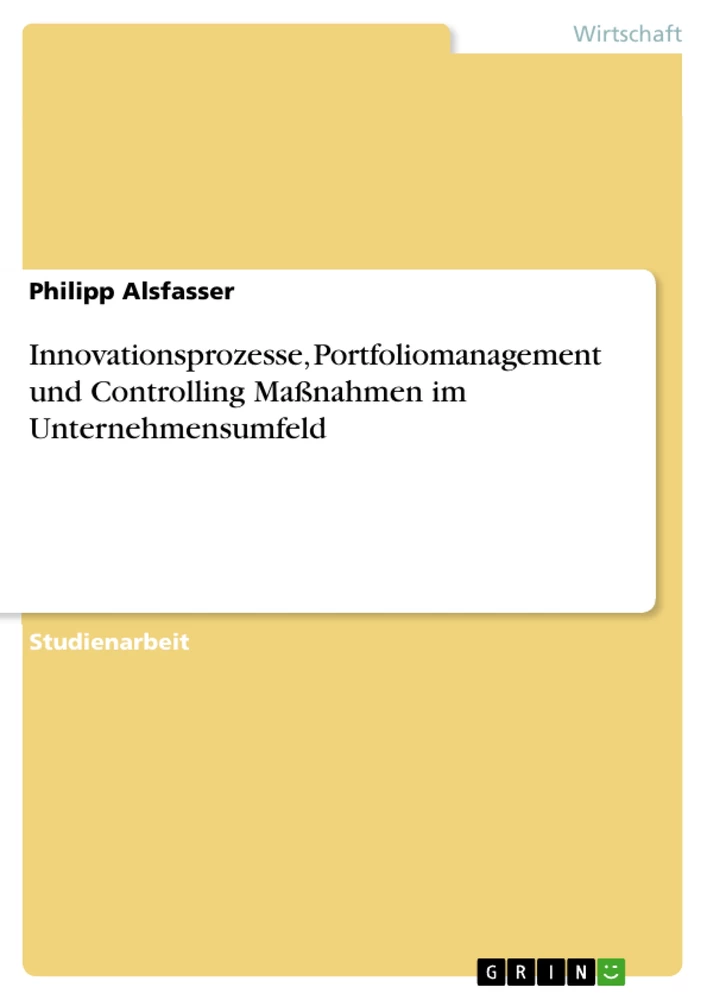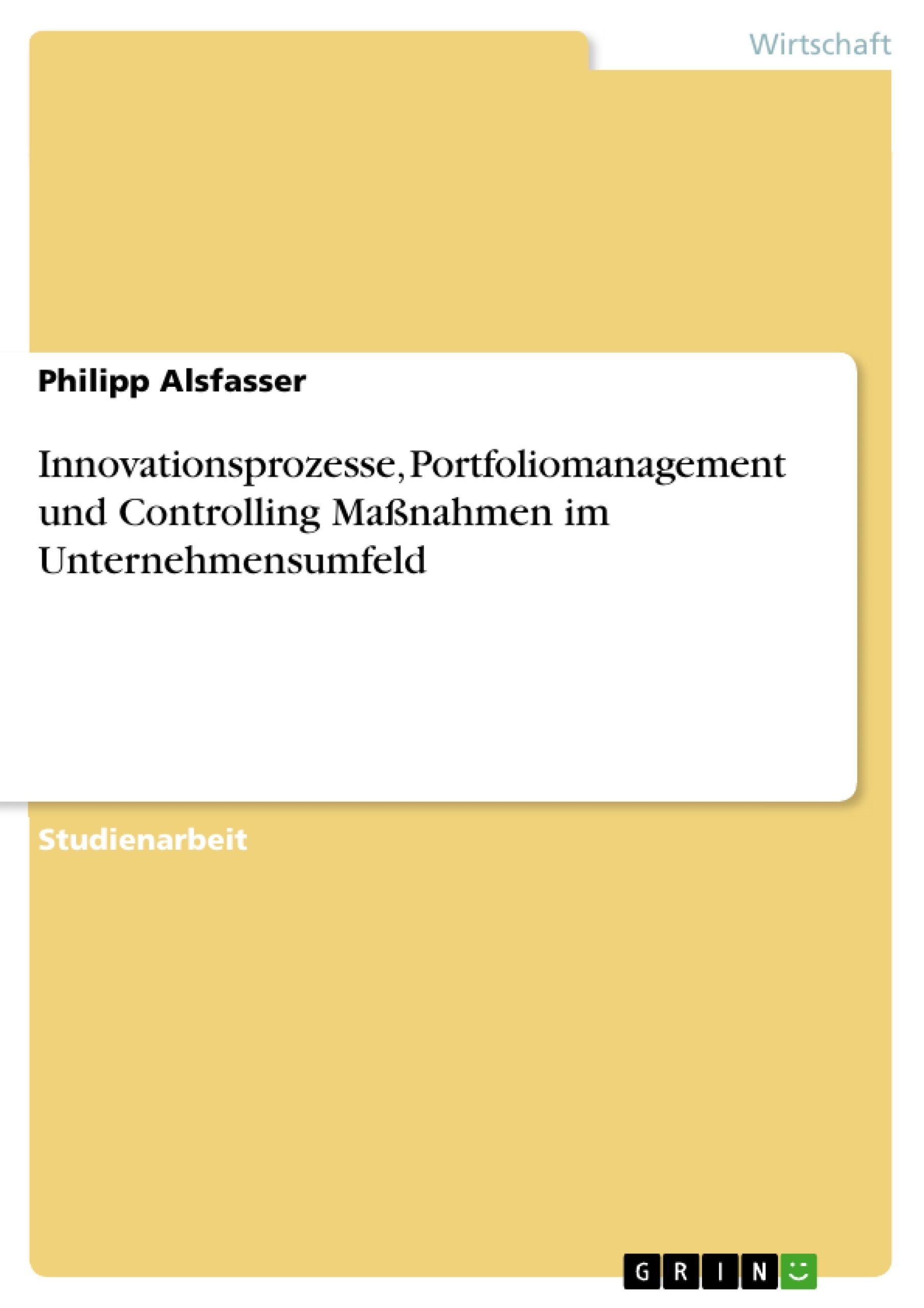Die langfristige Sicherung der Überlebensfähigkeit ist das strategische Ziel eines jeden Unternehmens. Die Bewältigung dieser Herausforderung wird jedoch aufgrund der ständigen und unvorhersehbaren Veränderungen des Umfeldes, sowie der zunehmenden Globalisierung und des starken chinesischen und asiatischen Wachstums immer schwieriger. Bereits im Jahr 1858 entwickelte Charles Darwin die Evolutionstheorie „Survival of the fittest.“ Der Kernpunkt dieser These sagt aus, dass nur derjenige überleben kann, welcher geeignete Wege findet, sich den Umweltbedingungen anzupassen und dabei besser und schneller agiert als andere Individuen. Dies scheint auch für Unternehmen von wichtiger Bedeutung zu sein. Daher müssen in den Unternehmen ständig Lernprozesse vorangetrieben werden, die letztendlich zu einer Anpassung an die neuen Gegebenheiten führen. Zudem müssen innovative Ideen auf dem Markt präsentiert werden, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu erreichen. Dabei geht Deutschland mit gutem Beispiel voran. Laut einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist „die deutsche Innovationskraft spitze…Bezüglich der Innovationsstärke seiner Unternehmen nimmt Deutschland sowohl im Vergleich mit den Partnerstaaten der EU als auch im Vergleich mit asiatischen Industrieländern wie Japan oder Südkorea eine Spitzenstellung ein.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1 Innovation
- 2.1.1 Produktinnovationen
- 2.1.2 Prozessinnovation
- 2.1.3 Sozialinnovation
- 2.2 Innovationsprozess
- 2.1 Innovation
- 3. Entstehung von Innovationsprozessen
- 3.1 Entdecken von Innovationspotenzial - der Startimpuls
- 3.1.1 Benchmarking
- 3.1.2 Produktportfoliomanagement nach BCG
- 3.1.3 Erkennen schwacher Signale
- 3.2 Ideengewinnung
- 3.1 Entdecken von Innovationspotenzial - der Startimpuls
- 4. Planung von Innovationsprozessen
- 4.1 Output bezogene Grundparameter
- 4.1.1 Ergebnisvorgabe
- 4.1.2 Terminvorgabe
- 4.2 Input bezogene Grundparameter
- 4.2.1 Personalplanung
- 4.2.2 Kapazitätsplanung
- 4.2.3 Kostenplanung
- 4.1 Output bezogene Grundparameter
- 5. Steuerung und Kontrolle von Innovationsprozessen
- 5.1 Kontrolle und Steuerung als Regelkreis
- 5.2 Kontrollmethoden
- 5.2.1 Ergebniskontrolle
- 5.2.2 Terminkontrolle
- 5.2.3 Kostenkontrolle
- 6. Wirtschaftlichkeit von Innovationsprojekten
- 6.1 Begriffsdefinition
- 6.2 Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung von Investitionen
- 6.2.1 Amortisationsrechnung
- 6.2.2 Kapitalwertmethode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht Innovationsprozesse im Unternehmensumfeld, fokussiert auf deren Planung, Steuerung und Kontrolle sowie die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der relevanten Aspekte zu vermitteln und methodische Ansätze zur erfolgreichen Umsetzung von Innovationsprojekten aufzuzeigen.
- Definition und Typologisierung von Innovationen
- Planungsparameter von Innovationsprozessen (Ressourcen, Zeit, Ergebnisse)
- Methoden der Steuerung und Kontrolle von Innovationsprojekten
- Wirtschaftlichkeitsanalyse von Innovationsprojekten
- Bedeutung von Innovationen für die langfristige Unternehmenssicherung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von Innovationen für das langfristige Überleben von Unternehmen angesichts des dynamischen globalen Umfelds. Sie verweist auf Darwins Evolutionstheorie als Metapher für unternehmerisches Handeln und unterstreicht die führende Rolle Deutschlands im Bereich Innovation, basierend auf Daten des ZEW.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen zentraler Begriffe wie Innovation (Produkt-, Prozess- und Sozialinnovation) und Innovationsprozess. Es legt die Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel und stellt verschiedene Innovationstypen gegenüber.
3. Entstehung von Innovationsprozessen: Hier wird die Entstehung von Innovationsprozessen detailliert beschrieben, beginnend mit der Identifizierung von Innovationspotenzialen durch Methoden wie Benchmarking und der Analyse des Produktportfolios (z.B. BCG-Matrix). Die Wichtigkeit der frühzeitigen Erkennung schwacher Signale und effektive Methoden der Ideengewinnung werden hervorgehoben.
4. Planung von Innovationsprozessen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die systematische Planung von Innovationsprozessen. Es unterscheidet zwischen output- und input-bezogenen Parametern. Output-bezogene Parameter wie Ergebnis- und Terminvorgaben werden ebenso detailliert beleuchtet wie input-bezogene Aspekte wie Personal-, Kapazitäts- und Kostenplanung, die für den Erfolg eines Innovationsprojekts essentiell sind.
5. Steuerung und Kontrolle von Innovationsprozessen: Das Kapitel behandelt die Steuerung und Kontrolle von Innovationsprozessen als Regelkreis. Es werden verschiedene Kontrollmethoden (Ergebnis-, Termin- und Kostenkontrolle) vorgestellt und deren Anwendung im Kontext von Innovationsprojekten erläutert. Der Fokus liegt auf der frühzeitigen Erkennung von Abweichungen und der Einleitung von Korrekturmaßnahmen.
6. Wirtschaftlichkeit von Innovationsprojekten: Hier wird die Wirtschaftlichkeit von Innovationsprojekten analysiert. Nach einer Begriffsdefinition werden gängige Verfahren der Wirtschaftlichkeitsrechnung von Investitionen (Amortisationsrechnung und Kapitalwertmethode) vorgestellt und deren Anwendung auf Innovationsprojekte erläutert. Die Kapitel verdeutlicht, wie die Rentabilität von Innovationen bewertet werden kann.
Schlüsselwörter
Innovationsprozesse, Portfoliomanagement, Controlling, Wirtschaftlichkeit, Produktinnovation, Prozessinnovation, Sozialinnovation, Benchmarking, BCG-Matrix, Planung, Steuerung, Kontrolle, Ergebniskontrolle, Terminkontrolle, Kostenkontrolle, Amortisationsrechnung, Kapitalwertmethode, Unternehmenserfolg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Innovationsprozesse im Unternehmensumfeld"
Was ist der Inhalt dieser Studienarbeit?
Die Studienarbeit befasst sich umfassend mit Innovationsprozessen in Unternehmen. Sie untersucht deren Planung, Steuerung, Kontrolle und die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Der Fokus liegt auf der Vermittlung eines fundierten Verständnisses der relevanten Aspekte und der Darstellung methodischer Ansätze für die erfolgreiche Umsetzung von Innovationsprojekten.
Welche Themen werden in der Studienarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Kernthemen: Definition und Typologisierung von Innovationen (Produkt-, Prozess- und Sozialinnovationen), Planungsparameter (Ressourcen, Zeit, Ergebnisse), Methoden der Steuerung und Kontrolle von Innovationsprojekten, Wirtschaftlichkeitsanalyse von Innovationsprojekten und die Bedeutung von Innovationen für die langfristige Unternehmenssicherung. Es werden konkrete Methoden wie Benchmarking und die BCG-Matrix erläutert.
Wie ist die Studienarbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, die die Bedeutung von Innovationen hervorhebt; ein Kapitel zu Begriffsdefinitionen (Innovation, Innovationsprozess); ein Kapitel zur Entstehung von Innovationsprozessen (inkl. Ideengewinnung und Innovationspotenzialerkennung); ein Kapitel zur Planung von Innovationsprozessen (Output- und Input-Parameter); ein Kapitel zur Steuerung und Kontrolle von Innovationsprozessen (Regelkreis, Kontrollmethoden); und abschließend ein Kapitel zur Wirtschaftlichkeit von Innovationsprojekten (Amortisationsrechnung, Kapitalwertmethode).
Welche Methoden der Planung und Steuerung von Innovationsprozessen werden beschrieben?
Die Studienarbeit beschreibt die Planung von Innovationsprozessen anhand von Output-bezogenen Parametern (Ergebnis- und Terminvorgaben) und Input-bezogenen Parametern (Personal-, Kapazitäts- und Kostenplanung). Zur Steuerung und Kontrolle werden Methoden wie Ergebniskontrolle, Terminkontrolle und Kostenkontrolle im Rahmen eines Regelkreises vorgestellt. Die frühzeitige Erkennung von Abweichungen und die Einleitung von Korrekturmaßnahmen spielen eine zentrale Rolle.
Wie wird die Wirtschaftlichkeit von Innovationsprojekten bewertet?
Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit erfolgt anhand gängiger Verfahren der Investitionsrechnung, nämlich der Amortisationsrechnung und der Kapitalwertmethode. Diese Methoden werden im Detail erläutert und ihre Anwendung auf Innovationsprojekte gezeigt.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Studienarbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Innovationsprozesse, Portfoliomanagement, Controlling, Wirtschaftlichkeit, Produktinnovation, Prozessinnovation, Sozialinnovation, Benchmarking, BCG-Matrix, Planung, Steuerung, Kontrolle, Ergebniskontrolle, Terminkontrolle, Kostenkontrolle, Amortisationsrechnung, Kapitalwertmethode und Unternehmenserfolg.
Welche Rolle spielt das Benchmarking in der Studienarbeit?
Benchmarking wird als Methode zur Identifizierung von Innovationspotenzialen im Kapitel zur Entstehung von Innovationsprozessen vorgestellt. Es dient der Analyse und dem Vergleich mit Wettbewerbern, um Chancen und Verbesserungspotenziale zu erkennen.
Welche Bedeutung hat die BCG-Matrix in diesem Kontext?
Die BCG-Matrix wird als Werkzeug des Produktportfoliomanagements erwähnt und dient der Analyse des bestehenden Produktportfolios, um Innovationspotenziale zu identifizieren und strategische Entscheidungen zu treffen.
Welche Arten von Innovationen werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Produktinnovationen, Prozessinnovationen und Sozialinnovationen.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Wirtschaftsingenieur (FH) Philipp Alsfasser (Autor:in), 2007, Innovationsprozesse, Portfoliomanagement und Controlling Maßnahmen im Unternehmensumfeld, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263944