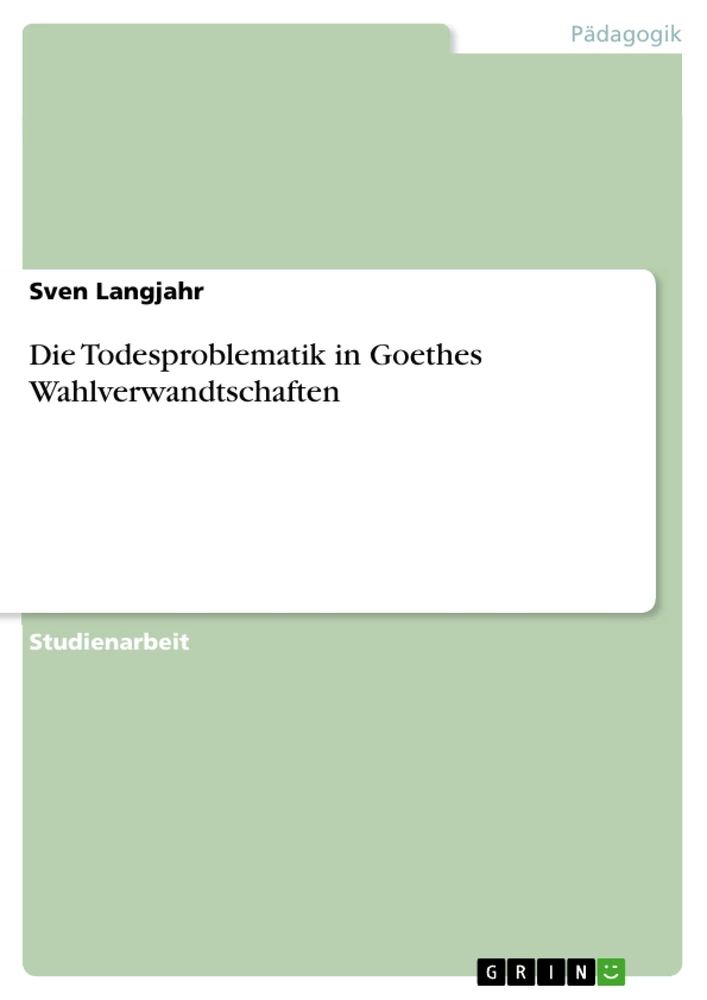Als Novelleneinlage für „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ geplant, wuchs Goethes Werk „Die Wahlverwandtschaften“ zu einem eigenständigen Roman heran.1 Nach dessen Veröffentlichung erwähnte Goethe 1827 gegenüber Eckermann, dass sein Roman „mehr, als irgend jemand bei einmaligem Lesen aufzunehmen imstande wäre“2, beinhaltet. Diese Aussage lässt die Komplexität und den großen Interpretationsgehalt des Werkes erahnen. Des Weiteren sagte Goethe über „Die Wahlverwandtschaften“: „Ich habe viel hineingelegt, manches hinein versteckt. Möge auch Ihnen dies offenbare Geheimnis zur Freude gereichen.“3 „Die Wahlverwandtschaften“ bieten also für Philologen eine breitgefächerte Auswahl an literarischen Motiven und Rätseln, welche von der Darstellung der Frauenbilder bis hin zur Namen- und Buchstabensymbolik reichen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1. Forschungsüberblick
1.2. Methode und genaue Vorgehensweise
2. Die Todesproblematik in den „Wahlverwandtschaften“
2.1. Die Wahlverwandtschaften-Metapher
2.2. Todessymbole in den Wahlverwandtschaften
2.3. Das Auftreten des Todes in den Wahlverwandtschaften
2.3.1. Der Tod des Geistlichen
2.3.2. Der Tod des Kindes
2.3.3. Der Tod von Ottilie
2.3.4. Der Tod von Eduard
3. Schluss
3.1. Ausblick
4. Literaturverzeichnis
4.1. Primärliteratur
4.2. Sekundärliteratur
5. Eigenständigkeitserklärung
- Arbeit zitieren
- Sven Langjahr (Autor:in), 2013, Die Todesproblematik in Goethes Wahlverwandtschaften, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264026