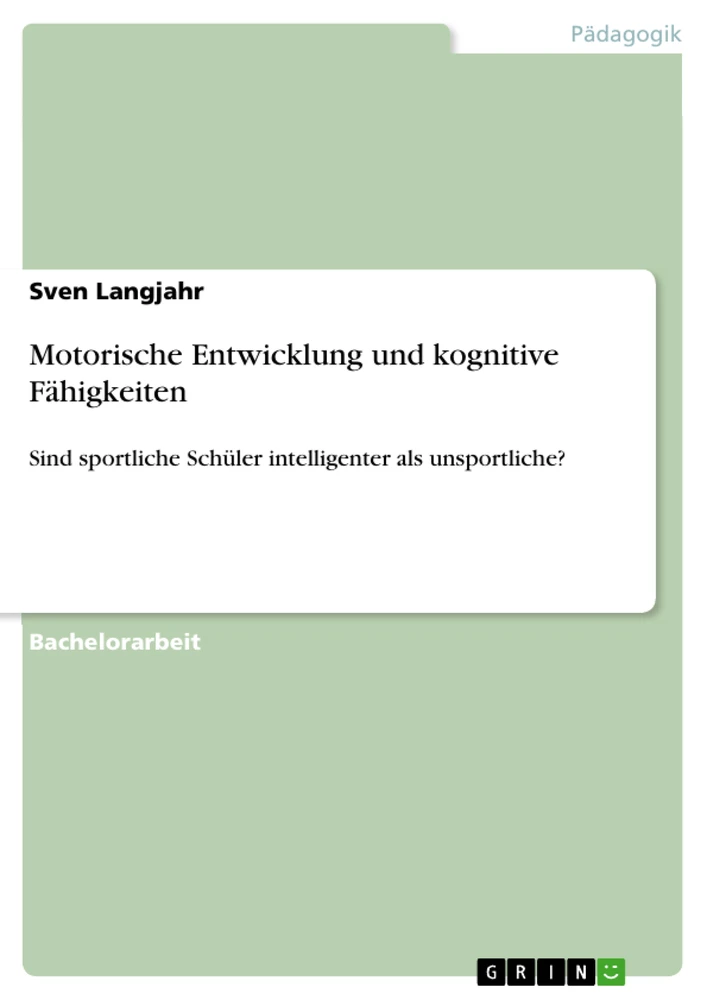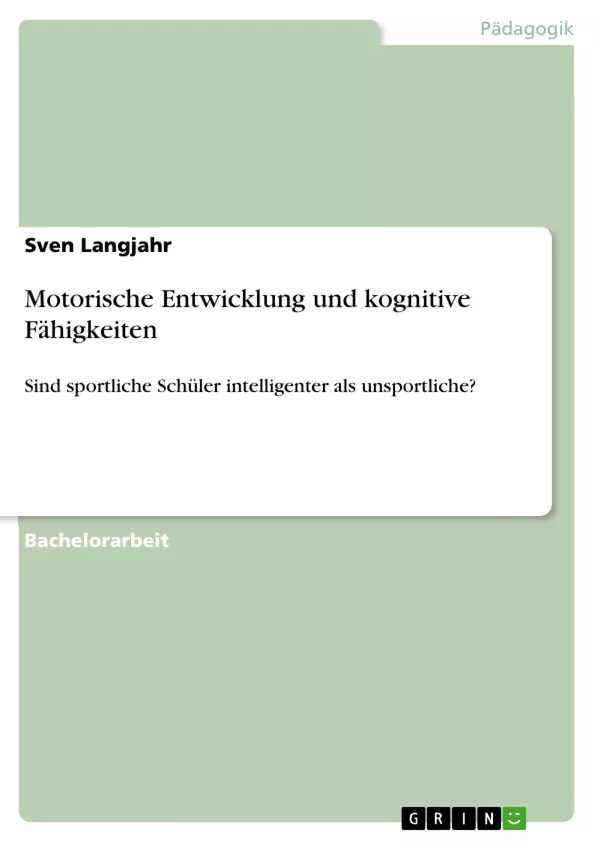Sich bewegen, Laufen, Fahrradfahren oder Gartenarbeit sind Beispiele für Tätigkeiten die unter den Begriff körperliche Aktivität fallen. Durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes, die stetige technologische Weiterentwicklung, das steigende Wachstum von Büroarbeitsplätzen und einer Gesellschaft, die enorm auf das Fortbewegungsmittel Auto fixiert ist, verliert die körperliche Aktivität heutzutage im täglichen Leben der Menschen immer mehr an Bedeutung (World Health Organization, 2008). Dies betrifft vor allem auch unsere Kinder, denn wie aktuelle Studien zeigen, sind heutzutage viele Kinder zu wenig körperlich aktiv (Reilly, 2010; Tucker, 2008). Daraus resultiert eine steigende Anzahl an übergewichtigen Kindern und Jugendlichen (Ojiambo et al., 2011). Durch die Einführung der Ganztagesschulen und den vergleichsweise geringen Sportangeboten an deutschen Schulen, kann das Schülerleben heutzutage mit einem Bürojob verglichen werden. Die mangelnde Bewegung im alltäglichen Leben, bei Kindern sowie auch Erwachsenen, hat enorme negative Auswirkungen auf die gesundheitliche Verfassung. Körperliche Inaktivität steht an vierter Stelle der durch chronische Krankheiten verursachten Sterberate. Über 3 Millionen Tote jährlich durch Herzerkrankungen, , Diabetes und Krebs wären vermeidbar durch mehr Körperliche Aktivität (World Health Organization, 2008). Weitere Folgen der Inaktivität können z.B. Entwicklungsstörungen im grobmotorischen Bereich sein, die vor allem bei Kindern sehr häufig auftreten (Lubans, Morgan, Cliff, Barnett& Okely, 2010). Des Weiteren hat Körperliche Inaktivität für Kinder aber nicht nur gesundheitliche Folgen, da Studien auch einen Zusammenhang mit kognitiven Fähigkeiten zeigen, welche abhängig vom Aktivitätsgrad mehr oder weniger stark ausgebildet sind (Hillman, Buck, Themanson, Pontifex & Castelli, 2009). Dabei sind die kognitiven Funktionen für eine gute Leistung in Schul- und Arbeitsalltag von großer Bedeutung (Diamond, Barnett, Thomas & Munro, 2007). Deshalb gilt die Förderung des Aktivitätsgrades bei Kindern und auch Erwachsenen in der heutigen Zeit als eine enorm wichtige gesellschafts- wie auch gesundheitspolitische Aufgabe.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Ziele der Arbeit
- 2 Aktueller Stand der Forschung
- 2.1 Motorische Entwicklung
- 2.2 Exekutive Funktionen
- 2.3 Motorische Fertigkeiten
- 2.3.1 Das Werfen
- 2.3.1.1 Der einhändige Schlagwurf
- 2.3.1.2 Alters- und Geschlechtsspezifische Unterschiede beim Werfen
- 2.3.2 Das Fangen
- 2.3.2.1 Die Fangbewegung
- 3 Methoden
- 3.1 Stichprobe
- 3.2 Hypothesen
- 3.3 Untersuchungsmethoden
- 3.3.1 Untersuchung der motorischen Fertigkeiten
- 3.3.2 Untersuchung der kognitiven Fähigkeiten
- 3.3.3 Untersuchung der anthropometrischen Merkmale
- 3.4 Ablauf der Untersuchung
- 3.5 Statistik
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Anthropometrische Merkmale der Stichprobe
- 4.2 Statistische Daten des Werfens
- 4.3 Statistische Daten des Fangens
- 4.4 Statistische Daten des Flanker-Task-Tests
- 4.5 Korrelationsergebnisse der motorischen Fertigkeiten Fangen und Werfen und des Flanker-Task-Tests
- 5 Diskussion
- 5.1 Methodendiskussion
- 5.2 Ergebnisdiskussion
- 6 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Entwicklung motorischer Fertigkeiten und kognitiven Fähigkeiten im Grundschulalter. Ziel ist es, den Einfluss der motorischen Entwicklung auf kognitive Leistungen zu beleuchten und mögliche Korrelationen aufzuzeigen. Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die motorischen Fertigkeiten Werfen und Fangen sowie auf die kognitiven Fähigkeiten, die im Flanker-Task-Test gemessen werden.
- Entwicklung motorischer Fertigkeiten im Grundschulalter
- Zusammenhang zwischen motorischen Fertigkeiten und kognitiven Fähigkeiten
- Analyse des Einflusses von Werfen und Fangen auf kognitive Leistungen
- Untersuchung geschlechtsspezifischer Unterschiede
- Auswertung der Ergebnisse mittels statistischer Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein, indem es die Problemstellung des Zusammenhangs zwischen motorischer und kognitiver Entwicklung im Grundschulalter beschreibt und die Ziele der Arbeit definiert. Es wird die Relevanz der Untersuchung für die pädagogische Praxis hervorgehoben und der methodische Ansatz skizziert. Die Einleitung legt den Fokus auf die Forschungslücke und die Bedeutung der Untersuchung der Interdependenz zwischen motorischen und kognitiven Fähigkeiten in dieser Altersgruppe.
2 Aktueller Stand der Forschung: Dieser Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu motorischer Entwicklung, exekutiven Funktionen und den spezifischen motorischen Fertigkeiten Werfen und Fangen. Er beleuchtet die Entwicklungsverläufe dieser Fähigkeiten im Grundschulalter und diskutiert bereits existierende Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen motorischer und kognitiver Entwicklung. Die Zusammenfassung der relevanten Literatur liefert die theoretische Grundlage für die eigene empirische Untersuchung. Es werden verschiedene Studien und Theorien vorgestellt, die den Zusammenhang zwischen motorischer und kognitiver Entwicklung belegen und diskutieren.
3 Methoden: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der empirischen Untersuchung. Es werden die Stichprobe, die Hypothesen, die Untersuchungsmethoden (einschließlich der Erhebungsinstrumente für motorische und kognitive Fähigkeiten sowie anthropometrische Merkmale), der Ablauf der Untersuchung und die verwendeten statistischen Verfahren erläutert. Die Beschreibung gewährleistet die Reproduzierbarkeit der Studie und die Transparenz des methodischen Vorgehens. Die Auswahl der Methoden wird begründet und die methodischen Stärken und Grenzen der Studie diskutiert.
4 Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der empirischen Untersuchung präsentiert. Die Darstellung erfolgt systematisch und übersichtlich, beginnend mit der Beschreibung der anthropometrischen Merkmale der Stichprobe. Anschließend werden die statistischen Daten zum Werfen, Fangen und den Ergebnissen des Flanker-Task-Tests detailliert dargestellt und mit Tabellen und Abbildungen illustriert. Die Ergebnisse werden prägnant und nachvollziehbar präsentiert, um eine klare Interpretation zu ermöglichen.
5 Diskussion: Die Diskussion analysiert und interpretiert die Ergebnisse der Untersuchung im Kontext des aktuellen Forschungsstandes. Sie beleuchtet mögliche Gründe für die gefundenen Zusammenhänge und diskutiert die methodischen Stärken und Schwächen der Studie. Es werden Implikationen für die Praxis und weitere Forschungsfragen aufgeworfen. Die Diskussion setzt die Ergebnisse in einen breiteren Kontext, indem sie sie mit den theoretischen Überlegungen aus Kapitel 2 in Beziehung setzt und die Grenzen der Studie reflektiert.
Schlüsselwörter
Motorische Entwicklung, kognitive Fähigkeiten, Exekutive Funktionen, Werfen, Fangen, Grundschulalter, Korrelation, Flanker-Task-Test, anthropometrische Merkmale, empirische Untersuchung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Zusammenhang zwischen motorischen Fertigkeiten und kognitiven Fähigkeiten im Grundschulalter
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Entwicklung motorischer Fertigkeiten und kognitiven Fähigkeiten bei Grundschulkindern. Der Fokus liegt dabei auf den motorischen Fertigkeiten Werfen und Fangen sowie den kognitiven Fähigkeiten, die im Flanker-Task-Test gemessen werden.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit möchte den Einfluss der motorischen Entwicklung auf kognitive Leistungen beleuchten und mögliche Korrelationen zwischen motorischen Fertigkeiten (Werfen und Fangen) und kognitiven Fähigkeiten (gemessen mit dem Flanker-Task-Test) aufzeigen. Geschlechtsspezifische Unterschiede werden ebenfalls untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung motorischer Fertigkeiten im Grundschulalter, den Zusammenhang zwischen motorischen und kognitiven Fähigkeiten, die Analyse des Einflusses von Werfen und Fangen auf kognitive Leistungen, die Untersuchung geschlechtsspezifischer Unterschiede und die Auswertung der Ergebnisse mittels statistischer Methoden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung (Problemstellung, Ziele), Aktueller Stand der Forschung (motorische Entwicklung, exekutive Funktionen, Werfen, Fangen), Methoden (Stichprobe, Hypothesen, Untersuchungsmethoden, Statistik), Ergebnisse (anthropometrische Merkmale, statistische Daten zu Werfen, Fangen und Flanker-Task-Test, Korrelationsergebnisse), Diskussion (Methodendiskussion, Ergebnisdiskussion) und Zusammenfassung und Ausblick.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Untersuchungsmethode. Es wird eine Stichprobe von Grundschulkindern untersucht. Die motorischen Fertigkeiten Werfen und Fangen sowie die kognitiven Fähigkeiten (Flanker-Task-Test) und anthropometrische Merkmale werden erhoben. Die Daten werden mittels statistischer Verfahren ausgewertet.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Ergebnisse umfassen die anthropometrischen Merkmale der Stichprobe, statistische Daten zum Werfen und Fangen, die Ergebnisse des Flanker-Task-Tests und Korrelationsergebnisse zwischen den motorischen Fertigkeiten und dem Flanker-Task-Test. Diese Ergebnisse werden in Tabellen und Abbildungen dargestellt.
Wie werden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert?
Die Ergebnisse werden im Kontext des aktuellen Forschungsstandes diskutiert. Mögliche Gründe für die gefundenen Zusammenhänge werden analysiert, methodische Stärken und Schwächen der Studie werden beleuchtet, und Implikationen für die Praxis sowie weitere Forschungsfragen werden aufgeworfen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Motorische Entwicklung, kognitive Fähigkeiten, Exekutive Funktionen, Werfen, Fangen, Grundschulalter, Korrelation, Flanker-Task-Test, anthropometrische Merkmale, empirische Untersuchung.
- Arbeit zitieren
- Bachelor of Arts Sven Langjahr (Autor:in), 2012, Motorische Entwicklung und kognitive Fähigkeiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264039