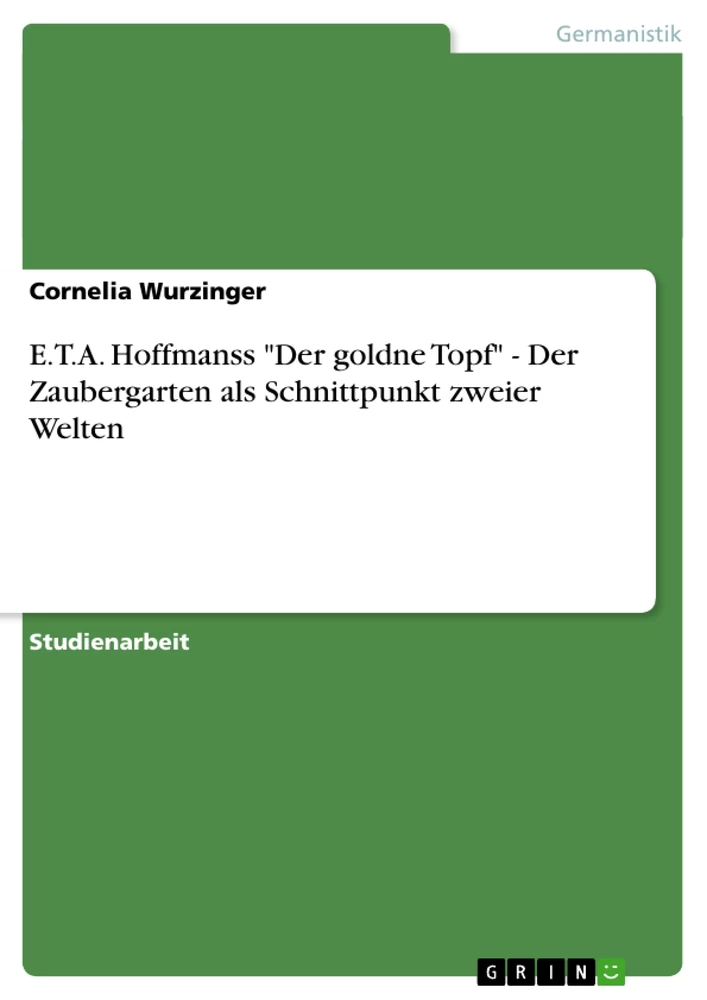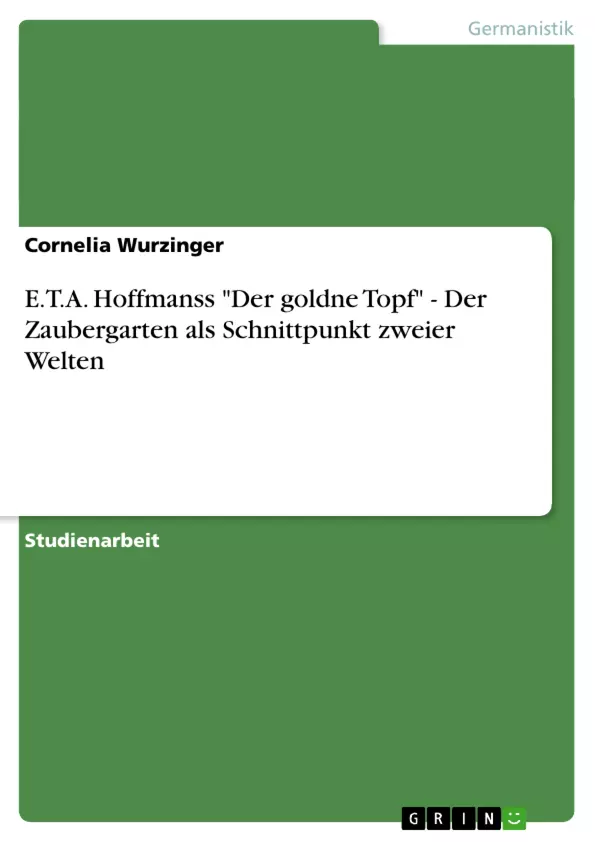Ausgehend von Hoffmanns Konzept der zwei Welten, die seine Geschichten wie auch die einzelnen Figuren auszeichnen soll der (Zauber)garten des Archivarius Lindhorst als Ort der Wandlung, des Transfers zwischen diesen Welten betrachtet werden.
Um eine Welt der Verzauberung, eine Aura des Geheimnisvollen zu erschaffen, bedient sich Hoffmann mehrerer Mittel: Einerseits weckt der Garten Ahnungen an den Orient und Indien – beides noch relativ unerforschte Gebiete der Welt - und andererseits verliert sich der Leser wie auch Anselmus im Motiv der Arabeske, das in den Schriften des Archivarius auftaucht.
Der Garten wird also zu einem Raum gemacht, in dem die Naturgesetze, die Logik außer Kraft gesetzt sind und fungiert als Ort, der Sehnsüchte nach einem Paradies, einem eigenen kleinen Garten Eden im Betrachter weckt. Anhand der Vorstellung von Atlantis hat mich die Rezeption der Kultur Indiens in der Romantik interessiert, die meiner Meinung nach Hoffmann inspiriert haben könnte, einige Aspekte davon in sein Werk einfließen zu lassen. Ähnlich wie die märchenhaften Elemente dient dies zur Illusionssteigerung in der Geschichte und im Endeffekt wird die Metamorphose im Garten dadurch möglich gemacht.
Die Duplizität der Welt ist ein Motiv, das sich wie ein roter Faden durch alle Werke E. T. A. Hoffmanns zieht. Die Spaltung der Welt oder einer Figur in sich selbst, das Doppelgängermotiv oder Brillen, die den Blick auf die Welt verändern und Spiegelungen sind Erscheinungen dieser Konzeption und treten als entscheidende Motive immer wieder auf. Die dadurch entstehenden zwei Sphären oder Welten sind auch Charakteristika des Märchens, das ohne diesen Kontrast zwischen Realität oder Normalität und phantastischen Erscheinungen nicht existieren könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die doppelte Welt – Kontrast und Illusion als Elemente des Märchens
- Der (Zauber)Garten - Wandelbarer und wunderbarer Ort als Schnittpunkt zweier Welten
- Atlantis Wunderland
- Indien Atlantis der Romantiker
- Lilie, Lotus, blaue Blume
- Die Welt als Buch, dessen Schrift eine Geheimschrift bleibt.
- Exkurs: Hard boiled wonderland und das Ende der Welt. Haruki Murakami, ein Erbe Hoffmanns?
- Resumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den (Zauber)garten des Archivarius Lindhorst in E.T.A. Hoffmanns "Der goldne Topf" als Ort der Wandlung und des Transfers zwischen zwei Welten zu betrachten. Hierbei wird der Fokus auf die Verbindung von Realem und Phantastischem gelegt, sowie die Rolle des Gartens als Symbol für Transformation und Sehnsucht.
- Die doppelte Welt in Hoffmanns Werk
- Der (Zauber)garten als Ort der Transformation
- Der Einfluss des Orients und Indiens auf Hoffmanns Konzept
- Das Motiv der Arabeske und die Illusionssteigerung
- Die Rolle des Spiegels als Symbol für Verzerrung und Verfremdung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung legt den Fokus auf die Duplizität der Welt in Hoffmanns Werken und erklärt, wie der (Zauber)garten in "Der goldne Topf" als Schnittpunkt zweier Welten fungiert. Es werden die Elemente des Märchens, wie Kontrast und Illusion, erläutert und die Bedeutung des Gartens als Ort der Verzauberung hervorgehoben. Die Verbindung von Realität und Fantasie, die im Garten stattfindet, wird durch Anspielungen auf den Orient und Indien verstärkt.
Atlantis Wunderland
Dieses Kapitel analysiert die Verbindung zwischen Atlantis und Indien in der Romantik. Die Autorin argumentiert, dass Hoffmanns Werk von der Rezeption Indiens in der Romantik inspiriert sein könnte und beleuchtet die Rolle der Illusionssteigerung durch märchenhafte Elemente. Der Garten wird als Ort der Metamorphose dargestellt, der durch die Verbindung mit dem Orient und Indien eine besondere Aura erhält.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter für die Analyse des (Zauber)gartens in "Der goldne Topf" sind: Doppelte Welt, Kontrast, Illusion, Transformation, Orient, Indien, Arabeske, Spiegel, Verzerrung, Verfremdung, Metamorphose.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hat der Zaubergarten in E.T.A. Hoffmanns "Der goldne Topf"?
Der Garten des Archivarius Lindhorst fungiert als Schnittpunkt zweier Welten und als Ort der Wandlung, an dem Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind.
Wie wird die "Duplizität der Welt" bei Hoffmann dargestellt?
Hoffmann nutzt Motive wie Doppelgänger, Spiegelungen und Brillen, um den Kontrast zwischen bürgerlicher Realität und phantastischer Wunderwelt aufzuzeigen.
Welchen Einfluss hatte die Indien-Rezeption der Romantik auf das Werk?
Indien galt in der Romantik als "Atlantis", ein Sehnsuchtsort. Hoffmann integriert orientalische und indische Motive, um die Aura des Geheimnisvollen zu verstärken.
Was symbolisiert das Motiv der Arabeske?
Die Arabeske steht für die Verschlingung von Realität und Phantasie und dient als visuelles Mittel zur Illusionssteigerung im Text.
Inwiefern ist Haruki Murakami ein Erbe Hoffmanns?
Die Arbeit zieht Parallelen zwischen Hoffmanns Welten und Murakamis "Hard-boiled Wonderland", indem beide Autoren die Grenze zwischen Parallelwelten thematisieren.
- Quote paper
- Cornelia Wurzinger (Author), 2004, E.T.A. Hoffmanss "Der goldne Topf" - Der Zaubergarten als Schnittpunkt zweier Welten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26411