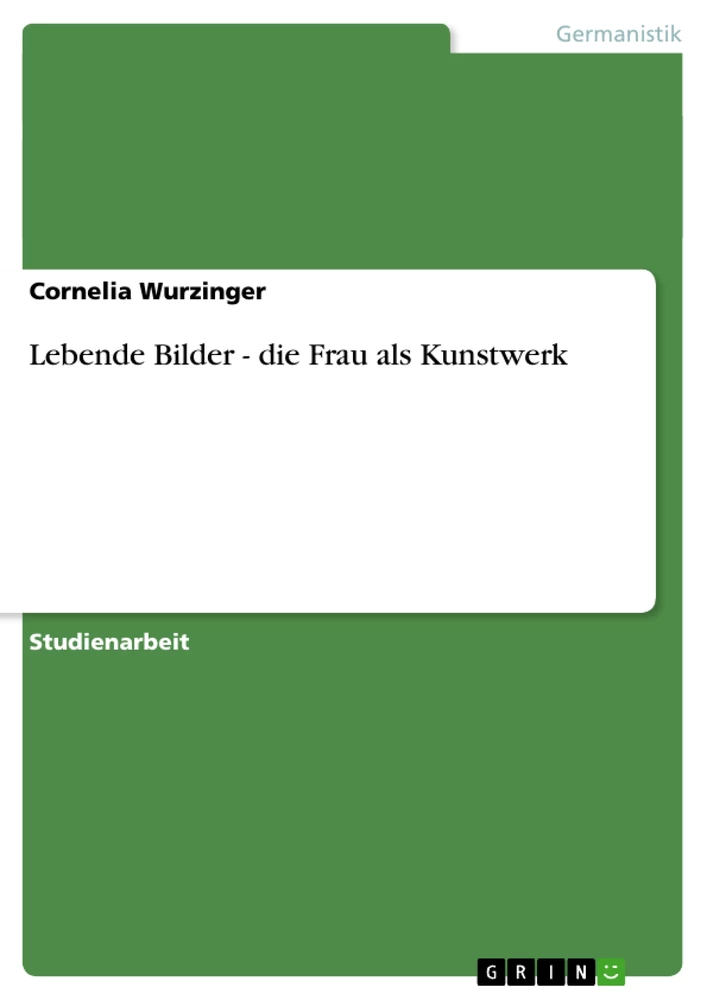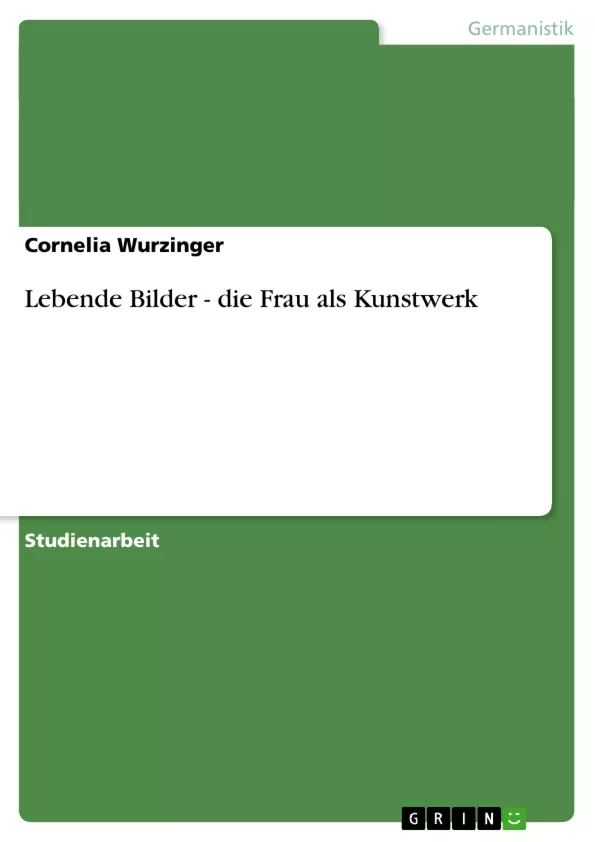„Irgendwann im 18. Jahrhundert wurde die Weiblichkeit neu entdeckt – als das
Andere, das Gegenstück zur Männlichkeit.1
Die alteuropäische Ständegesellschaft wurde durch die moderne
Industriegesellschaft abgelöst, was als Ursache für die „Entstehung einer radikalen
Dissoziation der Geschlechter“ gilt.2
Die Frau sollte das „stabile Zentrum für eine Welt bilden, die aus den Fugen zu
geraten drohte“3, sie hatte die Aufgabe, als „Gegenpol zur öffentlichen
Geschäftigkeit eine empfindsame Gefühlsfähigkeit“4 zu entwickeln.
Das bedeutet, dass diese neue Form der Weiblichkeit von den Bedürfnissen der
Männer geprägt war und im Prinzip auch daraus entstanden ist.
Die Frau als „Garant“ für eine bessere, eine noch „heile“ Welt: „Durch ihre neu
entdeckten Tugenden – die Keuschheit, die Schicklichkeit, die Empfindsamkeit,
das Taktgefühl, die Verschönerungsgabe, die Anmut und die Schönheit – bestand
die Aufgabe der Frau darin, all jene Werte am Leben zu erhalten, die mit der
bürgerlichen Arbeit nicht vereinbar sind. In diesem neuen bürgerlichen Entwurf
wird die Frau zur Gattin und Hausfrau, die das Heim des Mannes liebevoll
verschönert, zur Mutter, die in ihrer Fürsorge für ihre Familie und in ihrer
Funktion als Erzieherin ihrer Kinder aufgeht.“5
Hier fallen weiters die Begriffe der „Selbstverleugnung“ und „Selbstlosigkeit“, die
für die ideale Frau des 18. Jahrhunderts charakteristisch sind. Diese Attribute lassen
natürlich sofort an das Fräulein von Sternheim denken, die genau auf diese Rolle
angelegt ist.
„Die Frau wird sodenn entworfen als Trägerin eines idealen Geschlechts. Ihr wird
die echte Würde des Menschen, die bessere Moralität, die größere Güte des Herzens,
die warme aufrichtige Freundschaft angedichtet.“6
1 Bronfen, Elisabeth: Die schöne Seele, S. 372
2 Schaps, Regina: Hysterie und Weiblichkeit, S. 120
3 Die schöne Seele, S. 372
4 Die schöne Seele, S. 372
5 Die schöne Seele, S. 372
6 Die schöne Seele, S,. 373
Inhaltsverzeichnis
- Der neue Weiblichkeitsentwurf
- Hysterie als Bilderkrankheit
- Attitüde und lebende Bilder
- Mignon, Psyche, Kindsbraut
- Bildproduktionen
- Heilige, Märtyrerin, Madame Leidens
- Die Frau als Bild und Projektionsfläche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit dem weiblichen Selbstbild und dessen Darstellung in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts. Er analysiert, wie sich die Frau als Kunstwerk im Kontext der neuen Weiblichkeitsentwürfe entfaltet und welche Rolle die Hysterie in diesem Prozess spielt.
- Der neue Weiblichkeitsentwurf im 18. und 19. Jahrhundert und seine Auswirkungen auf die Frau
- Die Rolle der Hysterie als Krankheit und als Fluchtmöglichkeit für Frauen
- Die Bedeutung des Körpers als Projektionsfläche und Schaustück
- Die Inszenierung des weiblichen Körpers als „lebendiges Bild“ und „Kunstwerk“
- Die Frau als Objekt männlicher Projektionen und Fantasien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erörtert den neuen Weiblichkeitsentwurf, der im 18. Jahrhundert entstand. Die Frau wurde zum „stabile[n] Zentrum für eine Welt, die aus den Fugen zu geraten drohte“ und zum „Gegenpol zur Geschäftigkeit“ mit ihrer „empfindsame[n] Gefühlsfähigkeit“. Die Autorin zeigt auf, dass diese neue Form der Weiblichkeit von den Bedürfnissen der Männer geprägt war und in der Rolle der Gattin, Hausfrau und Mutter gipfelte.
Das zweite Kapitel widmet sich der Hysterie als „Bilderkrankheit“, die als Fluchtmöglichkeit für Frauen aus den ihnen zugedachten Rollen diente. Die Frau konnte durch hysterische Anfälle ihre angestauten Gefühle entweichen lassen und eine Rolle einnehmen, die im Gegensatz zu ihrer von der Gesellschaft legitimierten Rolle stand. Bettine von Arnim wird als Beispiel für eine Frau angeführt, die sich selbst in eine Rolle inszeniert und zu Mignon oder Psyche wird.
Das dritte Kapitel beleuchtet das Konzept der „Attitüde und lebenden Bilder“, das im 18. Jahrhundert aufkam und in der Kunstform des „in Szene setzen[s]“ des Körpers gipfelte. Der weibliche Körper wurde zur Schau gestellt und als Objekt wissenschaftlicher Experimente betrachtet. Hier wird auf die Arbeit von Jean Martin Charcot verwiesen, der in der Anstalt Salpêtrière Theateraufführungen mit hysterischen Patientinnen inszenierte.
Schlüsselwörter
Weiblichkeitsentwurf, Hysterie, Bilderkrankheit, Attitüde, lebende Bilder, Frau als Kunstwerk, Körper als Projektionsfläche, Männliche Projektionen, Inszenierung, Selbstverleugnung, Selbstlosigkeit.
- Quote paper
- Cornelia Wurzinger (Author), 2001, Lebende Bilder - die Frau als Kunstwerk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26412