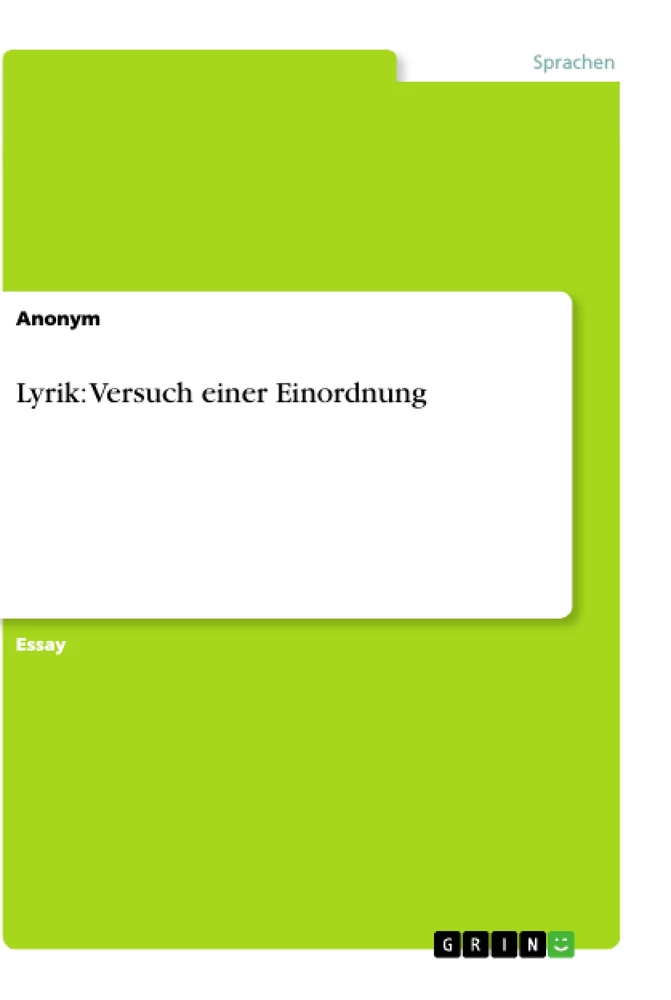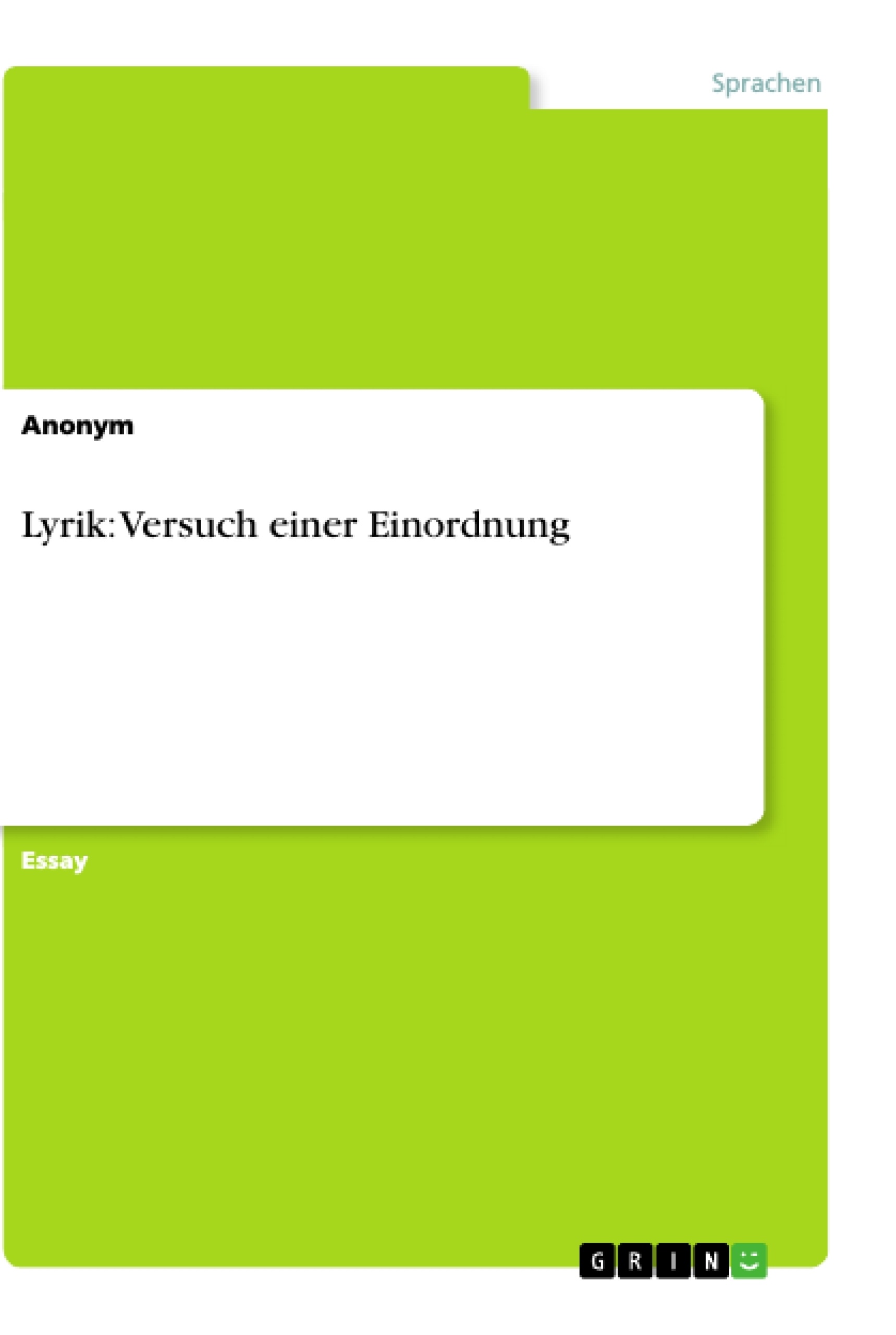Jeder Text über die Lyrik beginnt mit Benennung der Tatsache, dass Lyrik sich jeglicher klaren Definition zu entziehen scheint. „Über kaum ein literarisches Gebiet herrscht heute mehr Verwirrung als über die Lyrik.“ Geht man von der klassischen Dreiteilung der Gattungen aus, so behandelt „[...] das Lyrische [...] nicht eine Handlung wie das Epische oder Dramatische, sondern einen Gedanken“. Das könnte möglicherweise ein erster Anhaltspunkt über die Schwierigkeit der Begriffsbestimmung der Dichtung sein. Denn eine Handlung kann einfacher sichtbar gemacht werden, als ein Gedanke. Stellt man die Lyrik in eine Reihe neben andere Gattungen, so scheint sie zunächst durch ihre Gedichtform aufzufallen, genauso wie das Drama mit einer Dialogform in Verbindung gesetzt wird. Was passiert nun, wenn es zu einer Ablösung der Form kommt und nur noch der nackte Inhalt des Lyrischen eine Rolle spielt? Wird dann der Gedanke, den die Lyrik ausspricht doch zu einer Handlung? Steht die Lyrik den anderen beiden Gattungen doch näher, als es im ersten Moment erscheint? Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, den Lyrik- Begriff durch die Überprüfung einzelner gattungsspezifischer Merkmale, näher abzugrenzen.
Thema: Lyrik
Jeder Text über die Lyrik beginnt mit Benennung der Tatsache, dass Lyrik sich jeglicher klaren Definition zu entziehen scheint. „Über kaum ein literarisches Gebiet herrscht heute mehr Verwirrung als über die Lyrik.“[1] Geht man von der klassischen Dreiteilung der Gattungen aus, so behandelt „[...] das Lyrische [...] nicht eine Handlung wie das Epische oder Dramatische, sondern einen Gedanken“[2]. Das könnte möglicherweise ein erster Anhaltspunkt über die Schwierigkeit der Begriffsbestimmung der Dichtung sein. Denn eine Handlung kann einfacher sichtbar gemacht werden, als ein Gedanke. Stellt man die Lyrik in eine Reihe neben andere Gattungen, so scheint sie zunächst durch ihre Gedichtform aufzufallen, genauso wie das Drama mit einer Dialogform in Verbindung gesetzt wird. Was passiert nun, wenn es zu einer Ablösung der Form kommt und nur noch der nackte Inhalt des Lyrischen eine Rolle spielt? Wird dann der Gedanke, den die Lyrik ausspricht doch zu einer Handlung? Steht die Lyrik den anderen beiden Gattungen doch näher, als es im ersten Moment erscheint? Im Folgenden soll der Versuch gemacht werden, den Lyrik- Begriff durch die Überprüfung einzelner gattungsspezifischer Merkmale, näher abzugrenzen.
Auch Prof. Dr. Rudolf Helmstetter zeigt in seinem Text „Lyrische Verfahren: Lyrik, Gedicht und poetische Sprache“ zunächst die Unsinnigkeit einer allgemeinen Eingrenzung von Lyrik. Weder die Erwartungshaltung, das ein lyrischer Text ein gewisses Gefühl zum Ausdruck bringen muss, noch die Beschränkung der Lyrik auf das Schriftliche können die Gattung näher eingrenzen. Lyrik findet sich also nicht nur in Gedichten, sondern z.B. auch in Songtexten wieder.[3] Vorrangig ist dabei nicht das lyrisches Ich, das sich selbst reflektiert, sondern die Rede beziehungsweise die Rhetorik, mit der etwas (vielleicht ein Gedanke?) zum Ausdruck gebracht wird.
Die poetische Rede und Sprache spielt also in der Lyrik eine entscheidende Rolle. Helmstetter geht von Theorien aus, die besagen, dass die Poesie nur das hervorhebt und zum Ausdruck bringt, was im alltäglichen Sprachgebrauch bereits vorhanden ist. Das heißt, die Botschaft, die die Dichtkunst hervorbringt, soll auch schon in einer reim- und verslosen Sprache versteckt sein. Allerdings kann erst die Gedichtform eine „ erwartete Ordnung der Bedeutung der Worte bringen“[4]. An dieser Stelle könnte ein Vergleich zum Problem des Übersetzens gezogen werden. Viele Übersetzer wollen zunächst den Inhalt eines (Ur-) Textes von der Form ablösen und dann in eine Neue gießen. Die Übermittlung des Inhalts sollte also dementsprechend von der Übermittlung der Form gestaltet und beeinflusst werden. Die Gegenposition sträubt sich aber gegen jegliche Ablösung, denn die „unterscheidbare aber untrennbare Einheit von Botschaft und Mitteilung“[5] muss erhalten bleiben.
Aber mit welchen Mitteln kann die Sprache der Lyrik ordnen, was in der natürlichen Sprachwelt durcheinander geraten ist? Hierzu lassen sich vier Elemente beschreiben, die die lyrische Sprache beinhaltet: die Phonetik, die Stilistik, die Tropik und die Komposition.[6]
Die Phonetik, die sogenannte Lautlehre lässt sich in zwei Elemente gliedern, die separat keine Wirkung erzielen würden: Klang und Rhythmus. Am Anfang steht der Klang, bestehend aus Vokalen und Konsonanten, die zusammengenommen, Laute hervorbringen. Mehrere Laute beziehungsweise Lautabfolgen ergeben wiederum den Rhythmus.[7] In der Lyrik entspricht der Rhythmus dem Versmaß (Metrum). Dieses wird wiederum in verschiedene Laut- und Reimgruppen unterteilt, die hier nicht weiter aufgeführt werden sollen.
Die Stilistik, die Lehre von der Gestaltung eines Ausdrucks (in der Sprache) enthält unterschiedliche Stilrichtungen, die von Hochsprache bis Hip-Hop-Jargon reichen. Je nach der Funktion der Rede werden verschiedene Kategorien eröffnet, um eine bestimmte Wirkung auf das Publikum zu erzielen. Dabei spielt der Unterschied zwischen geschriebener und gesprochener Sprache keine Rolle. Für die Lyrik ergibt sich daraus ein Gedichtstil, der aber auch verschiedene Sprachstile vereinen kann. Auch rhetorische Figuren und Tropen können ein Teil der Stilistik sein.[8] Diese haben aber sehr unterschiedliche Funktionen und sollen im folgenden Abschnitt genauer analysiert werden.
Die Tropik umfasst sprachliche Bilder (Tropen) und die bereits erwähnten rhetorischen Figuren. Diese beiden Kategorien der Stilmittel müssen differenziert werden. Sprachliche Bilder ordnen sich eher der Lyrik und Poetik unter, rhetorische Figuren augenscheinlich der Rhetorik. Während die Redekunst überzeugend nach außen hin auftritt, agiert die Dichtkunst nach innen gerichtet reflexiv.[9] Nitzberg vergleicht das sprachliche Mittel der Tropik mit Stilistik und Phonetik und nimmt an, dass Tropen nur einen literarischen Wert besitzen, während die anderen Mittel auch in der Normalsprache verwendet werden. Dieser Überlegung kann jedoch das Argument entgegengebracht werden, dass sprachliche Bilder in der Alltagssprache gar nicht bewusst wahrgenommen werden. Wenn die poetische Sprache eine Botschaft, die bereits vorhanden ist, nur hervorhebt, so kann die alltägliche Sprache oder Form (beziehungsweise ein bestimmter Stil) auch sprachliche Mittel enthalten, die erst aus der Botschaft geboren werden.
[...]
[1] Alexander Nitzberg, Lyrik Baukasten: wie man ein Gedicht macht, DuMont- Literatur- und Kunst- Verlag, Köln 2006, S. 7
[2] Gérard Genette, Einführung in den Architext, Stuttgart, Legueil, 1990, S. 39
[3] vgl. Rudolf Helmstetter, Lyrische Verfahren: Lyrik, Gedicht und Poetische Sprache, in: Wolfgang Struck (Hrsg.), Einführung in die Literaturwissenschaft, Verlag J.B. Metzler, Stuttgart/Weimar, 1995
[4] Rudolf Helmstetter, Lyrische Verfahren: Lyrik, Gedicht und Poetische Sprache, S. 29
[5] ebd., S. 31
[6] siehe Alexander Nitzberg, Lyrik Baukasten: wie man ein Gedicht macht
[7] vgl. ebd., S. 21
[8] vgl. S. 23/24
[9] vgl. Alexander Nitzberg, Lyrik Baukasten: wie man ein Gedicht macht, S. 14/28
Häufig gestellte Fragen
Warum lässt sich Lyrik so schwer definieren?
Lyrik entzieht sich oft klaren Grenzen, da sie im Gegensatz zu Epik oder Dramatik primär Gedanken und Gefühle statt einer äußeren Handlung ausdrückt.
Welche Elemente prägen die lyrische Sprache?
Wesentliche Elemente sind die Phonetik (Klang und Rhythmus), die Stilistik, die Tropik (sprachliche Bilder) und die Komposition.
Was ist der Unterschied zwischen Klang und Rhythmus?
Der Klang entsteht aus Vokalen und Konsonanten. Die Abfolge dieser Laute ergibt den Rhythmus, der in der Lyrik oft durch das Versmaß (Metrum) bestimmt wird.
Was sind Tropen in der Lyrik?
Tropen sind sprachliche Bilder, die Wörter in einem übertragenen Sinne verwenden, um eine tiefere Bedeutungsebene zu erzeugen.
Gibt es Lyrik nur in Gedichtform?
Nein, lyrische Verfahren finden sich auch in Songtexten oder poetischer Prosa wieder; entscheidend ist die rhetorische Gestaltung des Ausdrucks.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2011, Lyrik: Versuch einer Einordnung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264160