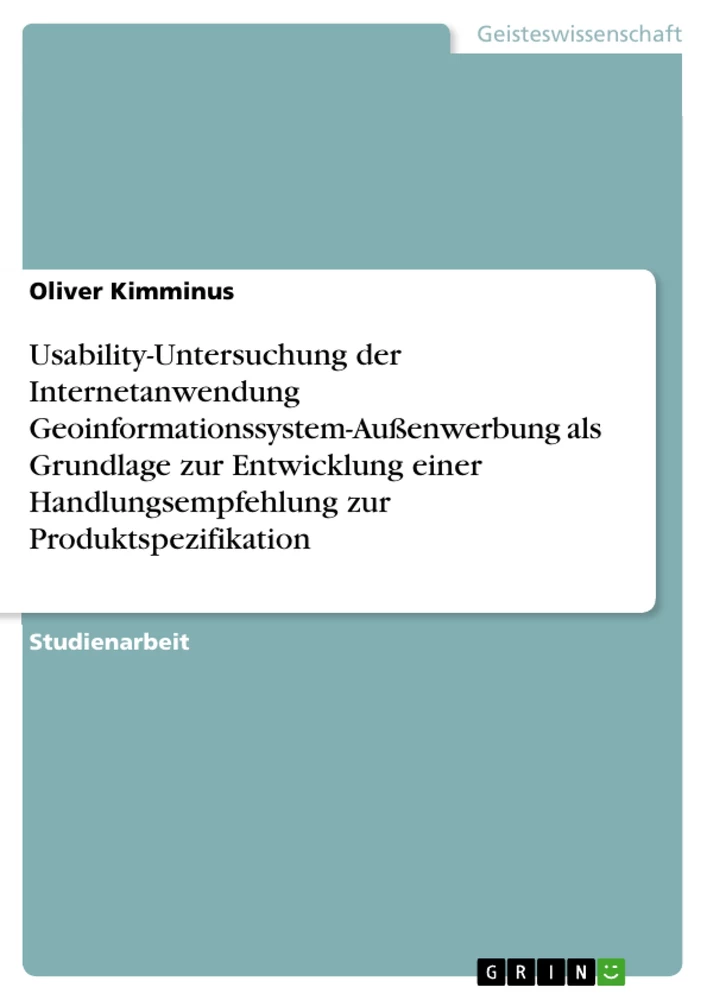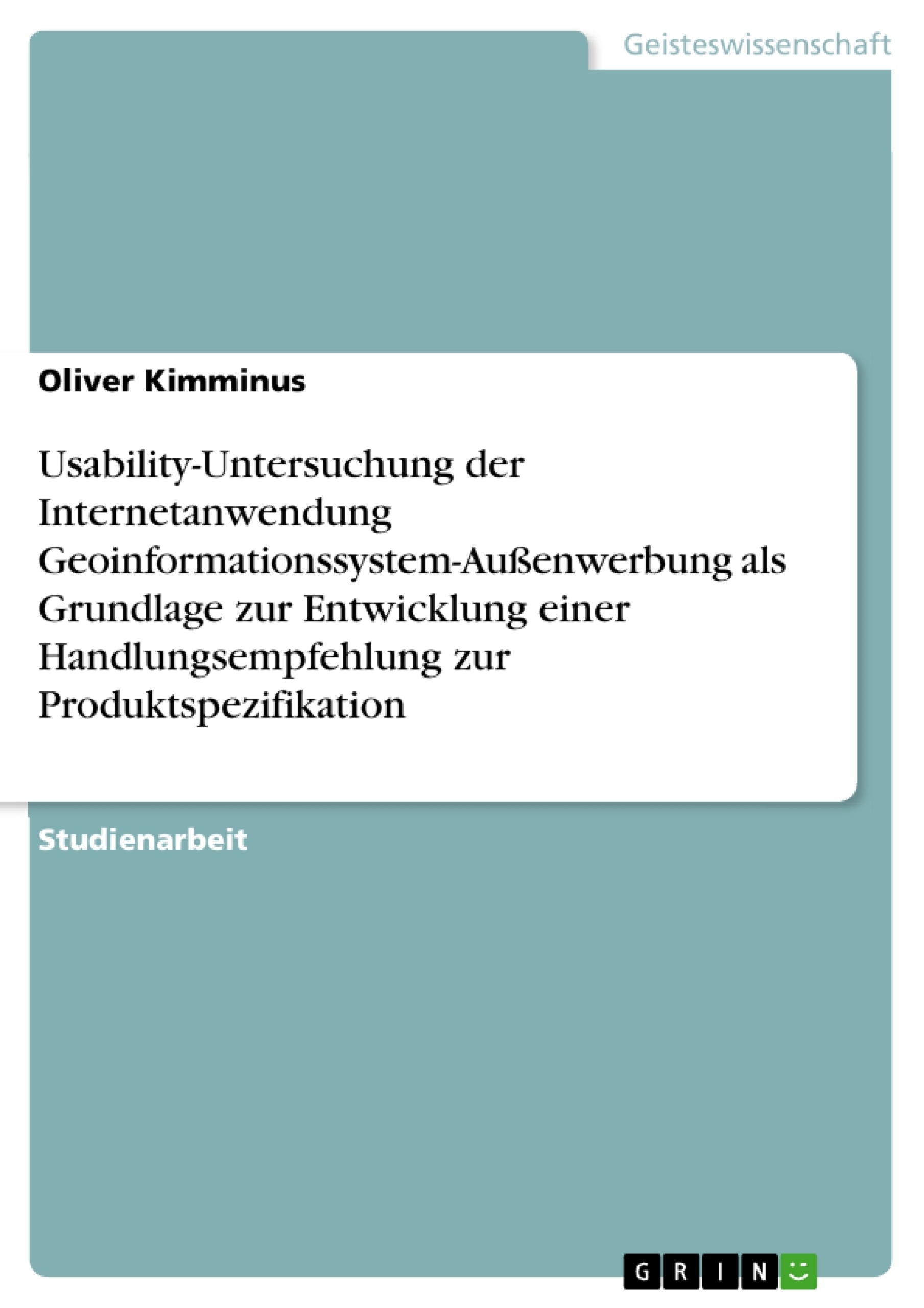Die Citylight Media GmbH & Co. KG ist ein inhabergeführtes Werbeträgerunternehmen. Zweck der Firma ist der Aufbau und die Vermarktung von großflächigen Plakatflächen der Außenwerbung. Um die Auslastung ihrer Werbeflächen zu steigern, entwickelte die Firma eine Internetanwendung. Mit Hilfe dieser Anwendung kann ein Werbetreibender über das Internet auf alle bundesweit zur Verfügung stehenden Werbeträger der Außenwerbung zugreifen, sie selektieren und für Plakatwerbung anmieten.
Die Anwendung heißt: Geoinformationssystem Außenwerbung,kurz: GISA.
Citylight Media hat Probleme bei der Vermarktung des GISA ausgemacht: Zum einen gehen nach wie vor viel zu wenig Buchungen ein, zum anderen können Nutzer nicht an die Anwendung gebunden werden. Es zeigt sich, dass ein angemeldeter Nutzer die Anwendung in den meisten Fällen nicht erneut nutzt. Daher soll die Gebrauchstauglichkeit (Usability) getestet, Probleme erkannt und analysiert werden, worauf diese Probleme zurückzuführen sind.
Erwartet wird weiterhin eine Handlungsempfehlung zur Optimierung der Anwendung. Mit dieser Hausarbeit wird der Frage nach der Gebrauchstauglichkeit nachgegangen und eine Usability-Untersuchung durchgeführt.
Als Untersuchungsverfahren kommen Benutzertests zum Einsatz, die mit ausgewählten Testpersonen durchgeführt und im Weiteren besprochen werden.
Zum besseren Verständnis des Themas ist es wichtig, den Begriff Usability zu verstehen. Im nächsten Kapitel wird dieser Begriff zunächst beschrieben, worauf im Weiteren die für die Untersuchung generell möglichen Methoden erläutert und die Entscheidung für eine Methode beschrieben wird. Die Auswertung der Untersuchung erfolgt im Anschluss und führt zur Erarbeitung der Handlungsempfehlung.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Theoretische Grundlagen zum Begriff der Usability
2.1 Gestaltungsprinzipien als Grundlage von Usability
2.1.1 Das Mentale Modell nach Norman
2.1.2 Prinzipien des benutzerfreundlichen Designs
2.2 Methoden zur Überprüfung der Usability
3 Fragestellung
4 Vorstellung der Internetanwendung Geoinformationssystem Außenwerbung
4.1 Zielgruppe
4.2 Struktur der Anwendung
5 Untersuchung der Usability des Geoinformationssystem Außenwerbung
5.1 Testaufgaben zur Feststellung der Usability
5.2 Befragung zur Feststellung der Usability
5.3 Auswahl der Testpersonen
5.4 Fragebogen-Design
5.5 Ausführungsmetriken
5.5.1 Metriken der Testaufgaben
5.5.2 Metriken zur Auswertung der System-Usability-Scale (SUS)
6 Ergebnisse der Untersuchung
6.1 Soziodemografische Ergebnisse
6.2 Ergebnisse der Testaufgaben
6.3 Ergebnisse der SUS-Befragung
7 Entwicklung der Handlungsempfehlung
8 Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was ist GISA?
GISA steht für Geoinformationssystem Außenwerbung, eine Internetanwendung zur Auswahl und Buchung von Plakatwerbeflächen bundesweit.
Was bedeutet Usability (Gebrauchstauglichkeit)?
Usability beschreibt, wie effektiv, effizient und zufriedenstellend Nutzer eine Anwendung bedienen können, um ihre Ziele zu erreichen.
Was ist die System-Usability-Scale (SUS)?
Die SUS ist eine standardisierte Metrik zur Messung der subjektiv wahrgenommenen Benutzerfreundlichkeit eines Systems durch Fragebögen.
Wie wurde die Usability von GISA untersucht?
Die Untersuchung erfolgte durch Benutzertests mit ausgewählten Testpersonen, die spezifische Testaufgaben lösen mussten, sowie anschließende Befragungen.
Was ist ein „Mentales Modell“ nach Norman?
Es beschreibt die Vorstellung des Nutzers davon, wie ein System funktioniert; eine gute Usability wird erreicht, wenn das Systemdesign dem mentalen Modell des Nutzers entspricht.
- Quote paper
- Oliver Kimminus (Author), 2013, Usability-Untersuchung der Internetanwendung Geoinformationssystem-Außenwerbung als Grundlage zur Entwicklung einer Handlungsempfehlung zur Produktspezifikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264298