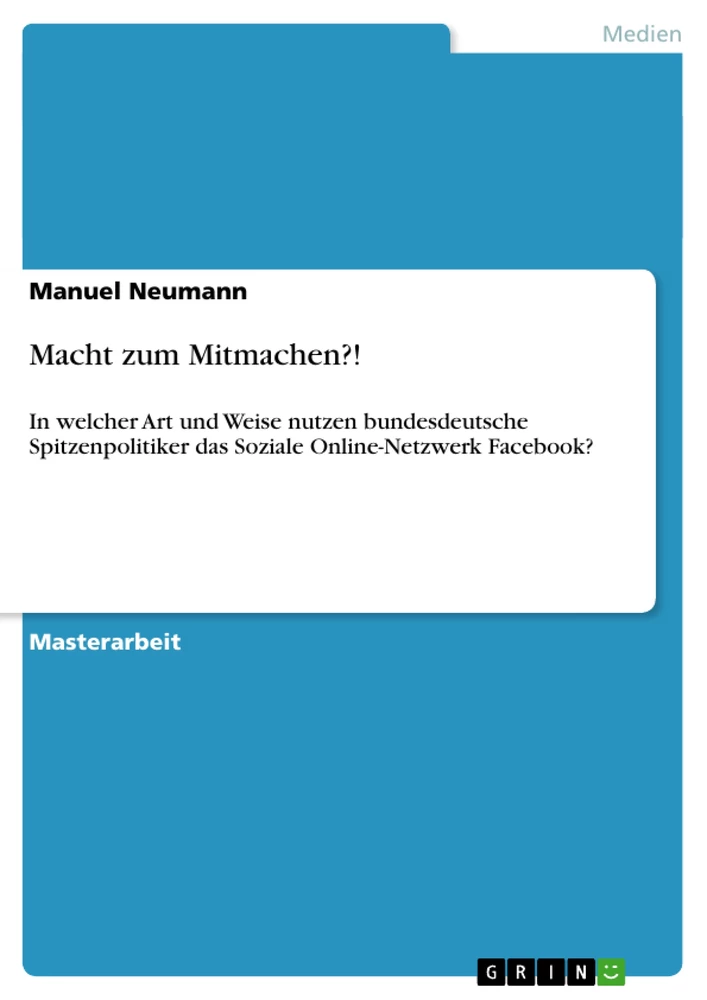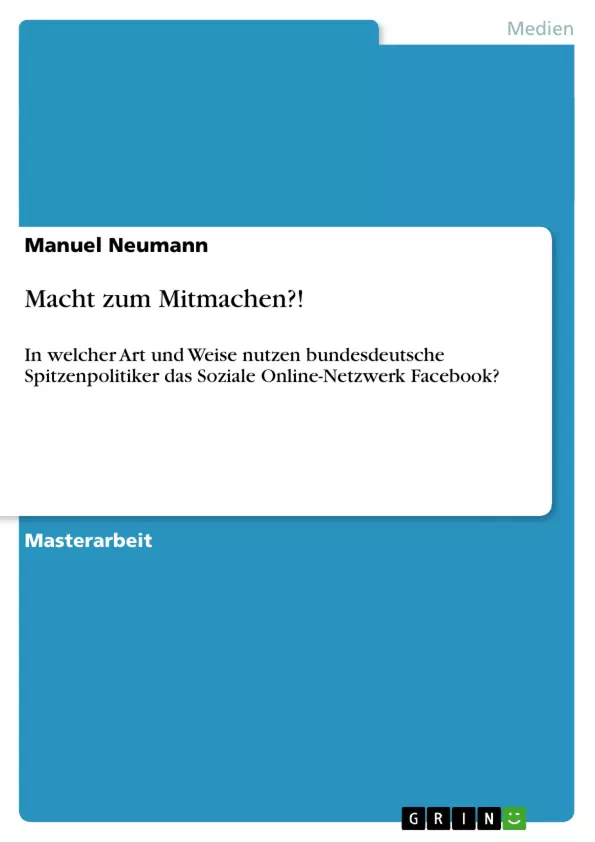Elf Tage nach der Anmeldung dieser Master-Arbeit, am 25. Januar 2013, zählte das Soziale
Netzwerk Facebook alleine in Deutschland 25.350.560 angemeldete Mitglieder. Gemessen an
der Einwohnerzahl, nämlich 81.946.000, entspricht dies einem Anteil von fast 31 Prozent der
Gesamtbevölkerung. Sicher erleben Social-Media-Angebote besonders in den letzten Jahren
einen Boom, dessen Nachhaltigkeit erst die Zukunft zeigen wird. Trotzdem belegen diese
Zahlen die immense Bedeutung, die die Netzwerke in der Gesellschaft jetzt schon bekommen
haben. Facebook hat sich in Deutschland unter diesen Angeboten mittlerweile als Marktführer
herauskristallisiert. War das Netzwerk in den ersten Jahren vor allem für junge Leute im
Allgemeinen und Studierende im Speziellen interessant, findet man mittlerweile Vertreter aller
sozialen Schichten und Altersgruppen auf Facebook, wenngleich der Anteil der unter 30-
Jährigen nach wie vor überwiegt. Im Internet ist damit „etwas entstanden, was nicht mehr nur
die Abbildung bereits vorhandener Dinge ‚im Netz‘ ist, sondern zunehmend eine eigene
Qualität bekommt.“
Fernab aller Quoten, wie viele Facebook-Nutzer wahlberechtigt sind, ist alleine eine solche
Masse für die Politik hochinteressant. Denn so viele potenzielle Wähler sind an keinem
anderen Ort anzutreffen. Ob virtuell oder reell – an welchem Ort nehmen mehr als 20
Millionen mögliche Wähler ein Plakat wahr? Welches Medienerzeugnis kommt auf so viele
Betrachter? Bereits der Wahlkampf Barack Obamas 2008, über den mittlerweile eine Vielzahl
wissenschaftlicher Texte publiziert wurde, zeigte die große Bedeutung des Internets für die
Politik. Das Facebook-Bild des gerade wieder gewählten Obama, der seine Ehefrau umarmt, ist
vier Jahre später das am meisten geteilte Foto der Plattform überhaupt. Die Möglichkeiten, die
sich aus dem interaktiven Charakter von Facebook und der Masse der Nutzer für Politiker und
Parteien ergeben, sind groß. „Information und Unterhaltung finden online statt.“
Von der eigenen Imagepflege, über die Möglichkeit zum direkten Bürgerdialog bis hin zur
direkten Vermittlung der politischen Ziele. Politiker und Parteien sind bei der Kommunikation
via Facebook nicht von der Gatekeeper-Funktion der Massenmedien abhängig, die bis zur
Verbreitung des Internet letztlich dafür verantwortlich waren, was massenhaft verbreitet wird...
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Vorstellung des Forschungsgegenstandes
1.2 Begrifflichkeiten
2. Theoretischer Hintergrund
2.1 Politische Kommunikation allgemein
2.2 Politische Kommunikation im Internet
2.2.1 Das Modell der deliberativen Demokratie im Kontext von Facebook
2.2.2 Wandel der Kommunikation = Mehr Demokratie
2.3 Die spezifischen Merkmale von Facebook
2.3.1 Geschichte und Traditionen
2.3.2 Funktionen
2.3.3 Nutzungsmotive
2.3.4 Ansprüche
2.3.5 Spezifische Möglichkeiten für Spitzenpolitiker
2.4 Macht zum Mitmachen? - Fazit der Theorie
3. Forschungsstand
4. Methodisches Vorgehen
4.1 Auswahl der Methode
4.2 Spezifikum Online-Analyse
5. Eingrenzung und Präzisierung der Forschungsfrage
5.1 Konkretisierung
5.2 Bestandsaufnahme
5.3 Die Leitfragen
5.3.1 Dimension 1: Quantitative Nutzung und Resonanz
5.3.2 Authentizität
5.3.3 Dimension 3: Selbstdarstellung
5.3.4 Dimension 4: Politikdidaktik
5.3.5 Dimension 5: Diskursivität
5.3.6 Sprachliche Gestaltung
6. Beantwortung der Forschungsfragen und Analyse
6.1 Quantitative Nutzung und Resonanz
6.1.1 Zwischenfazit 1: Quantitative Nutzung und Resonanz
6.2 Dimension 2: Authentizität
6.2.1 Zwischenfazit 2: Authentizität
6.3 Dimension 3: Selbstdarstellung
6.3.1 Zwischenfazit 3: Selbstdarstellung
6.4 Dimension 4: Politikdidaktik
6.4.1 Zwischenfazit 4: Politikdidaktik
6.5 Dimension 5: Diskursivität
6.5.1 Zwischenfazit 5: Diskursivität
6.6 Dimension 6: Sprachliche Gestaltung
6.6.1 Zwischenfazit 6: Sprachliche Gestaltung
7. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
1. Einleitung
Elf Tage nach der Anmeldung dieser Master-Arbeit, am 25. Januar 2013, zählte das Soziale Netzwerk Facebook alleine in Deutschland 25.350.560 angemeldete Mitglieder. Gemessen an der Einwohnerzahl, nämlich 81.946.0001, entspricht dies einem Anteil von fast 31 Prozent der Gesamtbevölkerung. Sicher erleben Social-Media-Angebote besonders in den letzten Jahren einen Boom, dessen Nachhaltigkeit erst die Zukunft zeigen wird. Trotzdem belegen diese Zahlen die immense Bedeutung, die die Netzwerke in der Gesellschaft jetzt schon bekommen haben. Facebook hat sich in Deutschland unter diesen Angeboten mittlerweile als Marktführer herauskristallisiert. War das Netzwerk in den ersten Jahren vor allem für junge Leute im Allgemeinen und Studierende im Speziellen interessant, findet man mittlerweile Vertreter aller sozialen Schichten und Altersgruppen auf Facebook, wenngleich der Anteil der unter 30- Jährigen nach wie vor überwiegt. Im Internet ist damit „etwas entstanden, was nicht mehr nur die Abbildung bereits vorhandener Dinge ‚im Netz‘ ist, sondern zunehmend eine eigene Qualität bekommt.“2
Fernab aller Quoten, wie viele Facebook-Nutzer wahlberechtigt sind, ist alleine eine solche Masse für die Politik hochinteressant. Denn so viele potenzielle Wähler sind an keinem anderen Ort anzutreffen. Ob virtuell oder reell - an welchem Ort nehmen mehr als 20 Millionen mögliche Wähler ein Plakat wahr? Welches Medienerzeugnis kommt auf so viele Betrachter? Bereits der Wahlkampf Barack Obamas 2008, über den mittlerweile eine Vielzahl wissenschaftlicher Texte publiziert wurde, zeigte die große Bedeutung des Internets für die Politik. Das Facebook-Bild des gerade wieder gewählten Obama, der seine Ehefrau umarmt, ist vier Jahre später das am meisten geteilte Foto der Plattform überhaupt. Die Möglichkeiten, die sich aus dem interaktiven Charakter von Facebook und der Masse der Nutzer für Politiker und Parteien ergeben, sind groß. „Information und Unterhaltung finden online statt.“3
Von der eigenen Imagepflege, über die Möglichkeit zum direkten Bürgerdialog bis hin zur direkten Vermittlung der politischen Ziele. Politiker und Parteien sind bei der Kommunikation via Facebook nicht von der Gatekeeper-Funktion der Massenmedien abhängig, die bis zur Verbreitung des Internet letztlich dafür verantwortlich waren, was massenhaft verbreitet wird und was nicht. Facebook ist für den jeweiligen Kommunikator das eigene Massenmedium.
Darüber hinaus kann es als Fühler für gesellschaftliche Themen genutzt werden, die noch keinen Eingang in die (massenmedial publizierte) Politik gefunden haben, aber für das Wahlvolk möglicherweise von Interesse sind.
Mit der Vielzahl der Potenziale einher gehen aber auch besondere Anforderungen, etwa die Einhaltung kultureller Praxen der Facebook-Kommunikation und die Erfüllung der Erwartungen der Nutzer. Inwiefern die Potenziale von Facebook genutzt werden, welcher Politiker die kulturelle Praxis am besten für sich zu nutzen weiß und die hohen Ansprüche an eine gelungene Kommunikation über das soziale Netzwerk in welcher Form erfüllen kann oder nicht, wird Gegenstand dieser Arbeit sein. Als Politische Kommunikation wird dabei alles definiert, was ein politischer Akteur veröffentlicht.
Zunächst wird der Forschungsgegenstand mit den zu untersuchenden politischen Seiten auf Facebook kurz erläutert. Auf Basis der Theorie zur allgemeinen politischen Kommunikation und im Besonderen der politischen Kommunikation im Internet, sowie dem Forschungsstand zu diesem wissenschaftlich jungen Thema, werden intersubjektiv vergleichbare Fragen ermittelt. Dies geschieht auf Basis der zuvor aus der Theorie hergeleiteten Potenziale der FacebookKommunikation. Die Fragen werden mittels der Methode der Inhaltsanalyse beantwortet. Das abschließende Kapitel beinhaltet das Fazit mit den komprimierten Kernergebnissen der Studie sowie einen Ausblick auf die mögliche weitere Forschung.
In der vorliegenden Arbeit werden die Seiten von hochrangigen deutschen Politikern der Bundestagsparteien untersucht. Sie besitzen aufgrund ihres Status einen Prominenz-Faktor, der mit einer Aura der Distanz zum Wählervolk verbunden ist. Außerdem nehmen sie in ihren Ämtern schlicht bedeutende Rollen in der Politik oder ihrer Partei ein. Wie insbesondere die politische Elite sich auf ein neues Medium einlässt, in welcher Form Interaktivität gepflegt wird und wie sich die Beziehung zum Nutzer darstellt, sind Fragen, die Teil der Forschung auf den folgenden Seiten sein werden.
1.1 Vorstellung des Forschungsgegenstandes
Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit sind die offiziellen Facebook-Seiten von Spitzenpolitikern der Bundestagsparteien, die entweder aufgrund ihres Amts oder qua ihrer Beliebtheit bei Facebook (manchmal, aber nicht immer geht das einher), gemessen an der Anzahl der Likes, eine gewisse Prominenz besitzen. Hierbei geht es nicht um private Profile einzelner Personen, sondern um die Fanseiten beziehungsweise öffentlichen Fanprofile. Ein Facebook-Nutzer kann diese verfolgen, indem er auf der Seite auf „Gefällt mir“ klickt (Im englischen Original: Like).
Um der Studie eine angemessene systematische Vergleichbarkeit zu verleihen und weil der Begriff Spitzenpolitiker durchaus einen schwammigen Charakter hat, wurden für die Auswahl der Seiten manifeste Kriterien und Voraussetzungen aufgestellt. Ausgewählt wurden Politiker aller Bundestagsparteien, wobei die CDU und die CSU als zwei separate Parteien angesehen werden. Von den sechs Parteien CDU, CSU, SPD, FDP, Die Grünen und Die Linke werden jeweils Seiten von zwei populären politischen Vertretern untersucht. Eingangskriterien dafür sind eine aktive Seite, bei dem nicht nur der „Gefällt mir“-Button geklickt werden kann, sondern auf der auch kommuniziert wird (nicht gegeben zum Beispiel bei Rainer Brüderle), eine aktuelle Seite, auf dem regelmäßig etwas geteilt wird (nicht gegeben zum Beispiel bei Edmund Stoiber, in dessen Namen noch nie etwas gepostet wurde und wo die Vermutung naheliegt, dass es sich dabei um eine Seite handelt, die von Dritten erstellt wurde) und eine offizielle Fanseite des jeweiligen Politikers, also eine, aus der erkennbar hervorgeht, dass es sich bei den kommunizierten Inhalten um offizielle Mitteilungen handelt, die vom Politiker selbst oder in dessen Auftrag publiziert werden. Die letzte Voraussetzung ist ein bundespolitischer Einfluss des jeweiligen Politikers, was besonders im Fall der CSU zu Grauzonen führt. Erfüllt Christian Lindner von der FDP als Vorsitzender des nordrhein-westfälischen Landesverbandes seiner Partei dieses Kriterium eindeutig nicht, stellte sich die Situation bei dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer etwas anders dar. Dieser ist in seinem politischen Amt zwar ein Landespolitiker, aber in seiner Position als Vorsitzender der CSU hat er auch Einfluss auf bundespolitische Entscheidungen, zumal die CSU Teil der Bundesregierung ist.
Die ersten sechs Politiker der Parteien entnehmen ihre Prominenz aus den Ämtern, die sie inne haben. Jeweils aus den Reihen der Parteivorsitzenden und der Vorsitzenden der jeweiligen Bundestagsfraktion wurde der Politiker ausgewählt, dessen Seite mehr „Gefällt mir“-Angaben (Likes) besitzt. Stichtag für die Zahlen der Likes war der Tag der Anmeldung dieser Arbeit, Montag, der 14. Januar 2013. Nach diesem Indikator finden die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU, 219.925 Likes), Horst Seehofer (CSU, 17.012 Likes), Philipp Rösler (FDP, 6.869 Likes) und Cem Oezdemir (Die Grünen, 21.397 Likes)4 sowie die Fraktionsvorsitzenden Frank- Walter Steinmeier (SPD, 16.903 Likes) und Gregor Gysi (Die Linke, 9.647 Likes) Eingang in die Untersuchung.
Der Pool der weiteren sechs Politiker der Parteien setzt sich aus denen zusammen, deren Facebook-Seiten die meisten Likes zählen. Dies sind Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU, 5.687 Likes), die Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär (CSU, 2.067 Likes), Peer Steinbrück (SPD, 16.922 Likes), Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP, 13.716 Likes), Claudia Roth (Die Grünen, 16.763 Likes) und Katja Kipping (Die Linke, 8.178 Likes).
Insbesondere beim zweiten Pool, aber auch für die ersten sechs Politiker gilt es zu untersuchen, ob ihre hohe Popularität bei Facebook nicht nur auf ihre allgemeine Bekanntheit, sondern auch auf die Art und Weise der Kommunikation in dem Sozialen Netzwerk zurückzuführen ist. Grundlegend lautet die Fragestellung der vorliegenden Arbeit:
In welcher Art und Weise nutzen bundesdeutsche
Spitzenpolitiker das soziale Online-Netzwerk Facebook?
Die offiziellen Facebook-Seiten werden nach aus der Theorie erarbeiteten Fragen analysiert und die Kommunikation auf den betreffenden Fan-Profilen untersucht.
Da sich gerade in Bezug auf Social-Media-Angebote und Facebook-Seiten mittlerweile eine eigene Sprache herausgebildet hat, wie bis hierhin bereits in Ansätzen erkennbar ist, ist es sinnvoll, für diese Arbeit einige Begrifflichkeiten zu klären, Definitionen darzulegen und Erklärungen zu Formulierungen zu geben, um Eindeutigkeit herzustellen und Missverständnissen vorzubeugen.
1.2 Begrifflichkeiten
Geschlechtsformen
Um den Lesefluss nicht zu verkomplizieren, wird beim Plural von Personen die männliche Form gebraucht und darauf verzichtet, auch die weibliche Form dazu zu nennen. Dies soll das weibliche Geschlecht in keiner Form herabwürdigen oder diskreditieren, sondern dient einzig der Einfachheit und Übersichtlichkeit beim Lesen.
Likes
Dieser Begriff bezeichnet die Anzahl der Menschen, die mit der jeweiligen Facebook-Seite vernetzt sind, also auf dieser Seite den „Gefällt mir“-Button geklickt haben. Wenn man sich mit einer Seite vernetzt, taucht dies auch im eigenen Profil auf, ist also zumindest für den Personenkreis sichtbar, dem man Einblick auf seine Facebook-Seite erlaubt. Darüber hinaus hat man als Liker einer Seite die Möglichkeit, dass neue Statusmitteilungen auf dem Fanprofil in den eigenen Neuigkeiten auf der Startseite angezeigt werden. Um eigene Beiträge auf Fan- Seiten zu hinterlassen, ist es allerdings nicht zwingend notwendig, mit einem Profil vernetzt zu sein. Der jeweilige Administrator der Facebook-Seite kann einstellen, wer auf seiner Pinnwand Mitteilungen hinterlassen kann. Es können theoretisch alle Facebook-Nutzer, nur mit der Seite vernetzte oder gar keine externen Besucher sein. Nutzer, die sich mit einem Profil vernetzt haben und somit die Neuigkeiten auf diesem Profil verfolgen, werden auch als Follower bezeichnet. Dieser Begriff stammt ursprünglich aus dem sozialen Netzwerk Twitter. Genauso kann ein Nutzer einen veröffentlichen Status im vorliegenden Fall eines Politikers oder eines anderen Besuchers auf der Seite liken oder nur einen einzelnen Kommentar zu einer Statusmitteilung. In der Regel ist es auch für die Freunde dessen, der eine Statusmitteilung geliket hat in deren Neuigkeiten sichtbar.
Status
Der Status ist die Mitteilung, die ein Kommunikator auf seiner eigenen Seite teilt. Wenn also von einem (Status-)Update die Rede ist, hat der jeweilige Inhaber oder Administrator einer Seite eine neue Statusmitteilung veröffentlicht.
Teilen
Hiermit bezeichnet man das Publizieren von Mitteilungen auf Facebook. Veröffentlicht man eine Statusmitteilung, so teilt man diese.
2. Theoretischer Hintergrund
In diesem Teil werden zu Beginn kurz die Grundlagen der allgemeinen politischen Kommunikation dargestellt. Hierbei geht es um die Politikvermittlung, Interessensgenerierung und die Ziele politischer Akteure und Parteien. Im zweiten Abschnitt wird die politische Kommunikation im Internet in Bezug zu Habermas‘ Modell der deliberativen Demokratie in der Öffentlichkeit hergestellt, das ein Grund für die Annahme ist, dass auf Facebook eine bessere, stringentere und greifbarere Form der politischen Kommunikation möglich ist. Ferner werden die Chancen und Herausforderungen der Politik durch die spezifischen Parameter neuer Medien und sozialer Netzwerke behandelt. Aus diesen theoretischen Ausführungen, die in einem Zwischenfazit am Ende des Kapitels noch einmal zusammengefasst und transferiert werden, leiten sich die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit ab.
2.1 Politische Kommunikation allgemein
„Kommunikation ist das zentrale Strukturelement demokratischer Systeme. Bereits in der antiken Form von Demokratie begegnen uns öffentliche Kommunikationen zur politischen Diskussion und Entscheidungsfindung auf der Agora.“5
Wenn die Macht vom Volk kommen soll, muss sich das Volk eine Meinung bilden. Diese fußt auf Informationen über politische Sachverhalte und immer mehr auch über die Personen, die diese Sachverhalte vertreten, also politische Akteure oder Parteien. Nach Otfried Jarren und Patrick Donges gibt es ein „intermediäres System“, das zwischen der Lebenswelt der Bürger und dem politischen System vermittelt.6 Dieses intermediäre System ist der öffentliche, grundsätzlich frei zugängliche Raum; zu etwaigen Schranken der Freizugänglichkeit wie etwa den Massenmedien wird später noch zu kommen sein. In diesem Raum findet die Interessengenerierung statt, die auf drei Kernfunktionen basiert, nämlich der Generierung, der Aggregation sowie der Artikulation von Interessen. Diese Interessen, so Jarren und Donges, „sind in der Lebenswelt der (…) Bürger nicht einfach da, sondern (müssen) stimuliert, geweckt oder einfach auch erzeugt (…)“ werden.7
Als Vermittler in diesem Raum fungieren allerdings nicht nur politische Akteure oder Parteien, sondern vielmehr auch Interessenverbände, Bürgerinitiativen und nicht zuletzt die Massenmedien. Dennoch nehmen die Parteien durch ihre verankerte Stellung im parlamentarisch-politischen System eine übergeordnete Rolle ein. Letztendlich besetzen sie die politischen Ämter und haben auf die Informationen, die daran gebunden sind, Zugriff. Die Herausforderung, die damit einhergeht, ist aber, dass die Parteien nicht den Bezug zu der Lebenswelt der Bürger, die sie wählen sollen, verlieren. Dementsprechend verläuft die Kommunikation im intermediären System durchaus zweiseitig, denn die Vermittlung zwischen der „gesellschaftlichen Vielfalt und der staatlichen Einheit“8 ist ein Balanceakt.9 So ist es von elementarer Wichtigkeit, dass Politiker und Parteien den Dialog zur Bevölkerung suchen und sich dabei auf Augenhöhe bewegen, „(…) die Anliegen der Bürger müssen durch Gespräche mit ihm erkannt werden, überhaupt muss der Bürger ernst genommen werden.“10
Aus rein systemtheoretischer Perspektive wird „Kommunikation eingesetzt bei der Erhebung von Informationen, dem Speichern, Verarbeiten und Austausch von Daten für die administrative Politikvorbereitung sowie für den Vollzug von Programmen und schließlich für die Mitteilung der Entscheidungen an die Bürger“.11 Dieser Ansatz greift jedoch zu kurz. Nicht zuletzt zeigen die Rücktritte vieler politischer Akteure aus ihren Ämtern, die oft nicht in ihrer Arbeit begründet liegen, eine Tendenz zur Personalisierung des politischen Diskurses. Für den damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff wurde ein Privatkredit zum Stolperstein, bei den Bundesministern Karl-Theodor zu Guttenberg und Annette Schavan fanden die Demissionen in ihren - teilweise lange zurück liegenden - fehlerhaften Dissertationen ihren Ursprung. Länger zurück liegen die Rücktritte des einstigen bayerischen Ministerpräsidenten Max Streibl (1993) und seines niedersächsischen Pendants Gerhard Glogowski (1999) wegen kostenloser Urlaubsreisen.
Die Personalisierung in der Politik ist keineswegs ein neues Phänomen12, doch sie nimmt in einer immer pluralistischeren und sich scheinbar stets zu verkomplizierenden Gesellschaft weiter zu, so dass die Präsentation und das Positionieren der eigenen Person immer wichtiger werden. Einzelne Personen simplifizieren komplexe Sachverhalte, brechen sie auf sich herunter und stellen damit eine greifbarere Komponente des politischen Tagesgeschäftes dar, „die Komplexität politischer und gesellschaftlicher Problemlagen, die Orientierung und gesellschaftliche Integration anhand klar definierter Handlungs- oder Zielkonflikte legt eine Orientierung an Personen nahe, Personen, die dies in allem für eine politische Linie stehen.“13 Es ist also zu konstatieren, dass sowohl Informations-, also de facto, Politikvermittlung zu den Kernkriterien der Politischen Kommunikation gehört als auch Personalisierungsstrategien. Pointierte übergeordnete Definitionen fallen schwer und können allein aufgrund der Allgemeinheit der Begriffe „Politik“ und „Kommunikation“ selbst auch nur in einem weiten generellen Rahmen gehalten werden. Sarcinelli zitiert Doris Graber damit, dass Politische Kommunikation die „Produktion, Mitteilung und Verbreitung von Kommunikationsbotschaften, die das Potential haben, substantiell - direkt oder indirekt - Effekte auf den politischen Prozess auszuüben“14 ist. Es besitzen auch persönliche Informationen zu politischen Akteuren eben dieses Potential.
Bisher ist jede Form der Politischen Kommunikation in allen aktuellen Erklärungsansätzen untrennbar von den traditionellen Massenmedien. Zwar wird dies auch weiterhin so sein, doch mit der Popularisierung des Internet als neuem Massenmedium und noch mehr mit dem Web 2.0 stellen sich für politische Akteure neue Möglichkeiten dar. Alle Formen ihrer Kommunikation, gleich ob Eigeninszenierung, Interessens- oder Informationsvermittlung, erreichten ein breites Publikum bis dato nur mittels der traditionellen Massenmedien, die die jeweiligen kommunikativen Inhalte zunächst auf Publikumsrelevanz filterten und sie medial aufbereiteten.15 Auf Seiten wie Facebook können Parteien und Politiker diesen medialen Filter umgehen und sich gleichzeitig beim Agenda-Setting der Gatekeeper-Funktion der Medien entziehen.
2.2 Politische Kommunikation im Internet
2.2.1 Das Modell der deliberativen Demokratie im Kontext von Facebook
Das normative Modell der Deliberation in einer Demokratie von Jürgen Habermas fußt auf dessen eigener Theorie des kommunikativen Handelns. Im Zentrum derselben steht die öffentliche Debatte, die allen politischen Entscheidungen vorausgeht und in dieselben mündet. Politische Entscheidungen sind also Ausdruck und Manifestierung der öffentlichen Meinung. Dem Modell zufolge limitiert die Gatekeeper-Rolle der Massenmedien dieses Prinzip. Soziale Netzwerke im Internet dagegen bilden einen idealen Nährboden für die Grundannahmen der deliberativen Demokratie, die eine mündige Öffentlichkeit voraussetzt. Vertreter dieser
Theorie sehen in der Popularisierung von Web-Angeboten wie Facebook die Möglichkeit, dass die systematischen Parameter viele Potenziale für die Demokratie besitzen, sie den Diskurs verbessern und die politische Mobilisierung unterstützen.
Die Deliberation findet nach Habermas in einem öffentlichen System statt, zu dem alle Bürger und politischen Akteure Zugang haben. Habermas bezeichnet diese als Lebenswelt.16 Grundsätzlich ist das Ziel, dass in einer Demokratie möglichst viele Menschen an diesem Diskurs beteiligt sind. Aus der Perspektive der Bevölkerung ist also ein freier, möglichst unkomplizierter Zugang wichtig; gleichzeitig ist es ein Ziel der Politik, zu mobilisieren. Im Sinne dieses Modells ist allein durch die hohe Anzahl von Bürgern in einem Staat keine Basisdemokratie, die auf dem direkten Austausch einzelner Individuen, Gruppen und Entscheidungsträgern basiert, möglich. Vielmehr handelt es sich durch die Allmacht der Massenmedien de facto nicht um eine Öffentlichkeit, sondern um eine Medienöffentlichkeit, da Meinungen aus dem Wissen und dem Austausch über Sachverhalte gebildet werden und die Massenmedien die Wissensvermittler sind. Massenmedien beschränken also die Deliberation und verletzen die demokratisch nötige Transparenz innerhalb des öffentlichen Systems. Facebook als partizipatorisches Element im Medium Internet bietet an dieser Stelle eine Lösung von den Ketten der massenmedialen Gatekeeper und hat das Potenzial, individuelle Mitteilungen zu unterstützen, zielgerichtete Fragen des Publikums beim Kommunikator abzurufen sowie eine many-to-many-Kommunikation, eine umfassende Reichweite und eine Gleichberechtigung herzustellen.17
Warum die traditionellen Massenmedien die Entstehung einer deliberativen Öffentlichkeit innerhalb einer demokratischen Gesellschaft behindern und warum das Web 2.0 ein besseres Mittel zu politischen Kommunikation im Sinne des Modells ist, zeigen die Kriterien für die öffentliche Deliberation. Was Habermas „Unabgeschlossenheit des Publikums“18 nennt, bedeutet nicht, dass es keine Grenzen hinsichtlich Themen und „Meinungen (die nicht kommunikabel sind)“ gibt.19 Vielmehr ist damit gemeint, dass „was immer in einer Öffentlichkeit getan wird, (…) in eine unübersehbare Umwelt (diffundiert). (…) Öffentlichkeit (besitzt) (…) keine klare Mitgliedschaft (und) prinzipiell jeder kann (…) Publikum sein.“20 Normativ ist die Teilnahme am Diskurs jedem offen und darf nicht durch Schranken begrenzt werden. Genau dieses Merkmal ist bei der Teilhabe via Internet praktisch gegeben.21 Denn um sich bei Facebook anzumelden, bedarf es keinerlei Erfüllung etwaiger Kriterien. Vielmehr ist der Zugang zu in diesem Fall Politiker-Seiten offen und die Partizipation von Besuchern einer Seite sogar gewollt und ein Teil der Seite selbst, zum Beispiel über die Kommentarfunktion. Eine Facebook-Seite, auf der ein Kommunikator etwas mitteilt und auch die Kommentare und Likes nur vom jeweiligen Kommunikator selbst erledigt würden, würde das System Facebook geradezu ad absurdum führen.
Eine weitere Komponente der deliberativen Öffentlichkeit ist die absolute Gleichheit aller am Diskurs Beteiligten, dementsprechend die Hinwegsetzung über soziohierarchische Strukturen, Schichten und spezialisierte Expertenrollen.22 Der Aspekt der Kommunikation auf Augenhöhe ist ein wichtiger Teil der kulturellen Praxis auf Facebook. Das Internet ist eine weitgehend hegemonialfreie Zone, da hier alle die gleichen Gesprächs- und Partizipationsrechte besitzen. Auf Facebook besitzt - anders als bei realen Begegnungen - ein Hartz IV-Empfänger den gleichen Status wie ein schwerreicher Manager, denn es gibt keine Profile höherer oder niedriger Klassen. Auch in diesem Punkt zeigt sich eine systematisch durchaus gewollte Egalität, da niemand strukturell die Möglichkeit hat, sich ein besseres oder schlechteres Profil anzulegen. Informationen dazu können jeweils nur aus dem kommunizierten Inhalt innerhalb des einheitlichen Profils kommen, allerdings ist an dieser Stelle niemand gezwungen, etwaige negative Informationen über Einkommen, sozialen Stand oder Privates zu teilen. Einschränkend und kritisch muss dabei jedoch bedacht werden, dass die vorhandene Struktur es Nutzern ermöglicht, Rollen zu spielen. Ferner können Formulierungen und Sprachduktus in eigenen Beiträgen zumindest Rückschlüsse auf die Bildung zulassen. Allerdings ist zumindest letzteres keine spezifische Einschränkung durch Facebook sondern ein grundsätzlich kritisch zu beurteilender Umstand der Merkmale deliberativer Demokratie, in der der Diskurs lediglich und allein über das Medium Sprache verlaufen soll, metapersonale Merkmale wie Geld, Prestige oder Macht also keine Relevanz besitzen.23 Gleiches gilt auch für Wahlerfolge oder Parlamentsmandate politischer Parteien. Allgemein sind alle Mitglieder bei Facebook gleich. Wahlkampfmittel zum Beispiel richten sich nicht nach den Zahlen der letzten Wahl und brauchen sich auch gar nicht daran zu orientieren, denn Präsenz und Aufmerksamkeit sind auf Facebook grundsätzlich kostenlos. Die SPD hat keine besseren Voraussetzungen als die Linkspartei, die CDU hat nicht mehr Möglichkeiten als die Piraten. Dies führt zu einer Egalität im Netzwerk und stellt an die politischen Akteure gleichsam besondere Anforderungen. Auf Facebook kann eine Partei oder ein politischer Vertreter nämlich nicht mit bloßer Aufmerksamkeit punkten, sondern vor allem mit Geschick, den richtigen Inhalten und vor allem der Akzeptanz der strukturellen Gegebenheiten. Kommunikation via Facebook bedeutet Kommunikation auf Augenhöhe. Unter anderem daran muss sich ein Kommunikator halten, wenn es eine erfolgreiche politische Kommunikation über das Netzwerk sein soll. Dass allein dies zumindest zu Achtungserfolgen führen kann, zeigt der (kurzfristige) Erfolg der Piratenpartei, die hauptsächlich mit einem Thema, weitestgehend formuliert Recht und Freiheit in Neuen Medien, und einer damit verbundenen geschickten Kommunikation über soziale Netzwerke zu beachtlichen Stimmenanteilen kamen.
Eine „ideale Sprechsituation“24, die Kennzeichen des Modells und Kriterium für den Diskurs ist, finden Diskursteilnehmer ebenso im Internet vor. Während ihnen in traditionellen Massenmedien in der Regel ohnehin nur die Adressatenrolle bleibt und sie hier eine Kommunikatorrolle einnehmen können, kann dies im Web 2.0 auch zeit-, raum- und ressourcenunabhängig geschehen. Da sich öffentliche Meinung auf öffentliches Wissen stützt, ist die ebenfalls jederzeit mögliche unbeschränkte Informationsbeschaffung im Internet generell ein weiterer Vorteil für das neue Medium.
Das letzte wichtige Merkmal für die deliberative Öffentlichkeit ist die Annahme, dass der Diskurs zu einem gesellschaftlich bedeutsamen Thema theoretisch unbegrenzt weitergeführt beziehungsweise zu jedem Zeitpunkt wieder aufgenommen werden kann.25 Auch hierfür bietet die erwähnte zeitliche und räumliche Unabhängigkeit den idealen Boden. Facebookspezifisch kann sogar davon gesprochen werden, dass praktisch unendlich viele Ressourcen für die Interpretationen zu Problematiken vorhanden sind, weil praktisch unendlich viele Statusmitteilungen und unendlich viele Kommentare zu einem Thema möglich sind.
Kritische Theorien zu den Voraussetzungen des Internet zur Entstehung einer deliberativen Öffentlichkeit basieren insbesondere auf der These, dass im Internet eben nicht die Gesamtöffentlichkeit abgebildet ist, sondern lediglich Teile davon, die wiederum zu sogenannten Teilöffentlichkeiten werden. In diese Kategorie passen wiederum Begriffe wie „Netzgemeinde“, „Internetgemeinde“ oder „digitale Welt“. „Dieser Fragmentierungs-These entgegnen die Anhänger des Modells, sie übersehe, dass sich gesellschaftliche Fragmentierung auch in der Medienöffentlichkeit durch zunehmende Individualisierung der Nutzer und der Angebote vollzogen habe.“26 Die zunehmende Pluralisierung innerhalb der Gesellschaft ist mittlerweile vielfach belegt. Insofern muss die Frage gestellt werden, ob es die sogenannte Gesamtöffentlichkeit überhaupt noch irgendwo gibt, falls es sie je gegeben hat. Darüber hinaus spricht die Entwicklung eine klare Sprache. Das Zeitalter des Internet ist gerade einmal etwas mehr als 20 Jahre alt und befindet sich noch immer in einer starken Wachstumsphase. Die Kommunikation über das Internet ist ein Prozess der immer bedeutsamer wird, weil die Nutzerzahlen immer höher gehen. Gemäß der ARD/ZDF- Onlinestudie ist ein Rückgang des Trends nicht zu erwarten.27 Im Gegenteil, glaubt man den Zahlen, so dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis eine Vollversorgung der deutschen Haushalte mit einem Internetzugang erreicht ist. Die Entwicklung geht sogar noch weiter und umfasst seit einigen Jahren das mobile Internet.
Natürlich sind diese Statistiken nicht auch gleichbedeutend damit, dass jeder Nutzer auch bei Facebook angemeldet ist. Aber auch hier zeigte sich zuletzt, dass sich wie erwähnt die Nutzerschaft nicht mehr nur noch auf Studenten zwischen 19 und 25 Jahren begrenzt, sondern längst ein gesamtgesellschaftlicher Zugang zu konstatieren ist.
Das Modell der deliberativen Demokratie zugrunde gelegt, lässt sich festhalten, dass Facebook zumindest das strukturelle Potenzial besitzt, den Zugang zum politischen Diskurs zu vermehren und zu erhöhen und damit einhergehend der Prozess der politischen Entscheidungsfindung im Sinne von Habermas‘ Modell verbessert wird. Ferner zeigen die hohen Nutzerzahlen und Beispiele aus der Realität (Piratenpartei), dass die Annahme der umfangreichen politischen Mobilisierung von Facebook-Nutzern nicht nur rein theoretisch ist.
Inwiefern die politischen Kommunikatoren diese Potenziale auszuschöpfen wissen, welche Methoden dabei deutlich werden, wie diese kategorisiert werden können und ob es sich dabei um eine gelungene Politische Kommunikation handelt, werden die folgenden Kapitel, insbesondere der Forschungsteil zeigen.
Die immens hohen Erwartungen an das Internet für die politische Kultur ziehen normativ- demokratietheoretisch sogar noch weitere Kreise. Hierbei geht es nicht nur um die Mobilisierung neuer Wähler, sondern darum, ob die anfangs vor allem bei Jugendlichen beliebten sozialen Netzwerke im Internet möglicherweise Politik- und Parteienverdrossenheit entgegenwirken könnten. Einige grundlegendere Forschungen befassten sich angesichts der riesigen in diesem Kapitel begründeten partizipatorischen Potenziale mit der Frage, ob mit dem Kommunikationswandel von Massenmedien hin zu den neuen Medien Internet und dem Web 2.0 sogar eine neue Demokratiequalität entstehen kann bzw. schon entstanden ist. Wie der Kommunikationswandel aussieht und auf welche theoretischen Überlegungen sich die genannten Annahmen stützen und ob sie sich bestätigen, dementieren oder in irgendeiner Weise relativieren lassen, soll im folgenden Kapitel kurz dargelegt werden.
2.2.2 Wandel der Kommunikation = Mehr Demokratie
In den neunziger Jahren kam mit dem Internet ein neues Medium auf. Die Veränderungen in der Medienwelt lösten geradezu eine mediale Revolution aus. Diese wurde durch die Popularisierung von Social-Web-Angeboten (Web 2.0), die sich durch Partizipationsmöglichkeiten der Nutzer auszeichnen, noch verstärkt. Das wirkt sich auch auf die Inhalte politischer Kommunikation aus. So waren politische Akteure vor dem Internet dazu gezwungen, Themen zu kommunizieren, die medial aufbereitet werden konnten und für die sich die Massenmedien interessierten. Es entstand eine Abhängigkeit der Politik von den Massenmedien, die sich in der Dependenzthese niederschlägt.28 Gerd Strohmeier bringt diesen Umstand mit dem Satz „Ereignisse sind nicht ‚einfach nur da‘, sondern werden meist von politischen Akteuren gezielt mit Blick auf die Medienberichterstattung lanciert“29 auf den Punkt.
Nun hat sich diese Situation nicht gänzlich in Luft aufgelöst. Die Massenmedien, insbesondere das Fernsehen, sind nach wie vor präsent. Außerdem hat die Praxis gezeigt, dass es hier ein Zusammenspiel zwischen beiden Medien gibt. Wer in den traditionellen Massenmedien präsent ist, besitzt gute Chancen, auch im Internet mehr Klicks zu generieren.30 Doch für das Internet gelten plötzlich andere Gesetze. Hier werden auch große Bevölkerungszahlen erreicht, aber die Kommunikation verläuft anders, nämlich direkter und ohne Zwischenschaltung anderer Stellen, so dass sie geradezu als persönlich gelten darf. Politiker können auf Facebook in den Neuigkeiten einzelner Nutzer auftauchen und so am Tag zahlreiche „digitale Hausbesuche“31 unternehmen, während sie dabei nicht an einem Wahlkampfstand stehen oder in einer Fernsehsendung auftreten müssen.
Die Politische Kommunikation kommt im Internet mit neuen kulturellen Praxen in Berührung. Im Web 2.0 wird ein (direkter) Austausch möglich. Plötzlich ist „die Partizipation auch ohne (die traditionellen) Massenmedien möglich“.32 Dass das Internet dabei längst selbst zu einem Massenmedium geworden ist und sich immer weiter verbreitet, belegen Statistiken. Nach der ARD/ZDF-Onlinestudie 2012 sind 75,9 Prozent der Menschen in Deutschland regelmäßig im Internet.33 Die Zahl der Nutzer der Web 2.0-Anwendungen ist besonders bemerkenswert, wenn man sie in Bezug zur Wahlbeteiligung nach Altersgruppen setzt. Diese lag für die unter 24-Jährigen bei unterdurchschnittlichen 59 Prozent.34 Exakt diese Altersgruppen aber nutzen Web 2.0-Angebote mit 85 (14- bis 19-Jährige) beziehungsweise 67 Prozent (20- bis 29-Jährige) am meisten, was zeigt dass sich hier ein riesiges Potential eröffnet, der Bevölkerungsgruppe, die bisweilen als Kerngruppe der Politikverdrossenheit angesehen wird, in deren Alltagswelt zu begegnen.35
Mit der Popularisierung der Web 2.0-Anwendungen und speziell den steigenden Mitgliederzahlen des Netzwerkes Facebook ergeben sich für die Politik also alleine rein quantitativ unendlich viele Möglichkeiten, potentielle Wähler zu mobilisieren.
Es gibt viele Theorien, die sich insbesondere aus dem Partizipationsprinzip des Web 2.0 einen Demokratieschub erhoffen, da der Bürger nicht nur „alle vier bis fünf Jahre Einfluss via Stimmabgabe ausüben (kann), sondern permanent. (…) Demonstrationen mag es auch in Zukunft geben, doch das eigentliche Schwungrad sind politisch ambitionierte und gut organisierte Netzwerke.“36 Hiernach verlagert sich der öffentliche Druck, unter dem politische Entscheidungen erst zustande kommen, also von der Straße in die digitale Welt. Dieser kann dort sogar bei Themen Menschenmassen aktivieren, bei denen auf der Straße eine Demonstration im eigentlichen Sinne höchstwahrscheinlich nicht zustande gekommen wäre. Es ist schwer vorstellbar, dass Vertreter der wissenschaftlichen Elite und Studenten zusammenkommen, und mit Doppelhaltern vor dem Bundesverteidigungsministerium die Absetzung von Karl-Theodor zu Guttenberg fordern. Stattdessen gab es schon in diesem Fall einen sogenannten Wiki - eine weitere Web 2.0-Anwendung -, auf dem immer mehr plagiierte Stellen in der Doktorarbeit des Ministers gefunden wurden und der so den Druck stetig erhöhte. Mittels „neuartig organisierter Mitsprache der Bürger“ bieten Soziale Netze im
Internet ferner die Möglichkeit „Politik und Staat (…) zu legitimieren und Politik- und Demokratieverdrossenheit entgegenzuwirken.“37 Sicher kann ein neues Mitspracherecht ein neues Demokratieverständnis bewirken und stärken. Doch auch im Internet muss der einzelne Kommunikator, das Gefühl haben, gehört oder gelesen zu werden. Der Theorie nach könnten Mitmach-Angebote sogar zu einer Rückbewegung zur antiken griechischen Basisdemokratie führen. Aus den Möglichkeiten leitet sich die Forderung nach Mitsprache ab, der einzelne Bürger „wird Druck auf die politischen Handelnden aufbauen und ihnen gleichzeitig konstruktiv die Hand reichen. Verfügt der Bürger erst einmal über diese Gestaltungsmacht, wird er schwerlich darauf verzichten wollen.“38
Doch das Internet kann nicht nur aufgrund der Partizipationsgelegenheiten zu einem Plus an Demokratie führen. Auch die Informationsvermittlung als „eine der zentralen Funktionen“39 spielt eine Rolle. Die charakteristischen Vorteile des Internet bieten „Verfügbarkeit, Aktualität, Kapazität und die Verknüpfung von Informationen.“40 Eben dieser Gedanke kommt schon in der Formulierung der „digitalen Hausbesuche“41 vor. Menschen müssen nicht mehr vor die Tür treten und in die Innenstadt gehen, um mit politischen Entscheidungsträgern ins Gespräch zu kommen. Sie können sich am eigenen Laptop oder sogar auf dem Handy einen umfassenden Überblick über die Themen des jeweiligen individuellen Interesses erstellen. Die Zugangshürden sind gering für alle Bevölkerungsschichten, was dem demokratischen Gedanken entspricht. Sarcinelli konstatiert dementsprechend, dass das Internet zu einer „Belebung der Zivilgesellschaft“42 beiträgt.
In der - relativ jungen - Forschung zu diesem Thema jedoch überwiegen die nüchternen Annahmen. Weder das Internet selbst noch besonders das Web 2.0 ist alt genug, dass es zum Nutzen für und Einfluss auf die Demokratie langfristige, wissenschaftlich valide und unwiderlegbare Thesen geben könnte. Bei der Frage, ob die vermeintlich positiven spezifischen Voraussetzungen des Internet auch in der Realität für mehr Demokratie in der Gesellschaft sorgen, ist Zurückhaltung zumeist das erste Gebot. Denn ein Problem ist die Informationsflut, die mit dem Internet einhergeht und zu einer „Fragmentierung der Gesellschaft“ führen kann.43 Nur weil es viele Informationen abzurufen gibt, heißt das nicht, dass diese auch ankommen. Wer auf diese Informationen zugreift, bleibt immer noch jedem selbst überlassen.
Genauso verhält es sich beim Aspekt der Partizipation, „nur weil jetzt auch online diskutiert werden kann, werden sich nicht plötzlich alle Bürger an der Debatte beteiligen.“44 Tatsächlich ließ sich in der Empirie kein Anstieg des politischen Interesses bei denjenigen nachweisen, die sich ohnehin nicht als ausdrücklich als „politisch interessiert“ bezeichneten.45 Dass ein Nutzer etwas kann, bedeutet also nicht, dass er das dann auch tut, wie es sich zuversichtliche Verfasser normativer Theorien bei diesem Thema vorgestellt haben. Gleichwohl ließ sich eine Steigerung des politischen Interesses feststellen, diese aber hatte eine tiefergehende, statt breiter werdende Form. Politisch interessierte Internetnutzer nutzen die neuen Möglichkeiten, um sich noch stärker einzubringen, Desinteressierte bleiben desinteressiert.46
Grundsätzlich also liegt wohl die Theorie einer Mischung am nächsten, nämlich einer aus Mobilisierung und Abkehr. Mitglieder ressourcenstarker und höher gebildeter sozialer Gruppen der Bevölkerung nehmen stärker teil als Menschen aus dem bildungsfernen Milieu. Das lässt aber die Schlussfolgerung, dass es eben auch die Mitglieder aus diesen Gruppen gibt, die sich in dem Zwischenbereich zwischen „politisch interessiert“ und „politisch desinteressiert“ einordnen. Wahrscheinlich überwiegt auch hier die Grauzone gegenüber Schwarz und Weiß. Und bei genau solchen „Halbinteressierten“ bietet sich Politischen Akteuren mit dem Sozialen Netzwerk Facebook eine Möglichkeit sie abzuholen und für sich und ihre Themen zu begeistern.
2.3 Die spezifischen Merkmale von Facebook
Erik Möller sieht im Internet die Grundlage für „völlig neue demokratische Strukturen“47 geschaffen und das Sender-Empfänger-Prinzip der traditionellen Medienformen durch die Interaktionsmöglichkeiten ausgehebelt. Aber welches sind die Traditionen von Facebook? Warum ist das Soziale Netzwerk so beliebt, was sind die Nutzungsmotive? Wie sieht die kulturelle Praxis aus und - darauf aufbauend - welche Ansprüche müssen erfüllt werden, damit in der Praxis eine gelungene Kommunikation über Facebook gelingt? Um die spezifischen Merkmale des größten sozialen Netzwerkes im Internet geht es in den folgenden Teilkapiteln.
2.3.1 Geschichte und Traditionen
Seinen Ursprung hat das soziale Netzwerk Facebook in den USA.48 Es ist mittlerweile das weltweit größte Netzwerk und überragt damit andere Angebote wie Twitter. Zu ähnliche Angebote werden durch Facebook geradezu einverleibt und zur Bedeutungslosigkeit degradiert. Beispielhaft dafür stehen die Niedergänge der Communities Myspace49 oder StudiVZ.50
Der damalige Student der Havard-University, Mark Zuckerberg, entwickelte Facebook im Jahr 2004 als reines Studenten-Netzwerk. Zwei Jahre später öffnete es sich für das gesamte Publikum. Entsprechend der Tradition als Community für Studierende sind die Nutzer mit dem größten Anteil junge Menschen. Mittlerweile jedoch öffnet sich das Angebot immer weiter in Richtung der Gesamtbevölkerung. Was Bernadette Kneidinger in ihrem Standardwerk über das Netzwerk bereits 2010 konstatierte („So ist es die Gruppe der über 30-Jährigen, die mittlerweile die stärksten Wachstumsraten aufweisen“51 ), hat sich heute, drei Jahre später, noch verstärkt.
Mit der Popularisierung von Facebook gehen kontroverse Debatten rund um das Thema Datenschutz einher. Dies gilt insbesondere für den Diskurs im deutschsprachigen Raum, in dem der Datenschutz eine große Bedeutung hat und oft von politischer Tragweite ist. Die Diskussionen beziehen sich vor allem auf den Umgang von Facebook mit privaten Daten der Nutzer, die den Kern des Netzwerkes darstellen. Zwar ist die Struktur eines jeden Profils gleich, doch durch - zumeist - private Informationen und Mitteilungen erhält ein Profil erst Individualität. Facebook wurde als private Community gegründet, nicht als gewerbliche Plattform zur Darstellung für Unternehmen oder politische Akteure. Diese Tradition lässt sich in der kulturellen Praxis der Facebook-Nutzung deutlich wieder erkennen.
Darüber hinaus ist die Internetseite von jeher nicht nur ein Angebot der Selbstdarstellung, in dem Nutzer sich in ihrem Profil der Öffentlichkeit (oder einem bestimmten Freundeskreis) präsentieren können, sondern ein Mittel der aktiven Kommunikation, mit dem sich Studenten über den Campus und einzelne Universitäten hinaus austauschen konnten.
2.3.2 Funktionen
Die Grundfunktionen von Facebook sind die Präsentation der eigenen Personen und der Austausch. Jedes Mitglied besitzt eine eigene Profilseite, die es mit persönlichen Informationen, zum Beispiel dem Geburtsdatum, dem Beziehungsstatus oder der derzeitigen Arbeitsstelle füllen kann. Ein weiteres Merkmal des Angebotes ist sekundenschnelle Aktualität.
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit zu einer Äußerung über sein Wohlbefinden, seine Meinung zu einem bestimmten Sachverhalt oder irgendeinem anderen Thema. Dies geschieht mittels einer Statusmeldung, die mit dem Klick auf den „Teilen“-Button sofort in den Neuigkeiten der vernetzten Kontakte auftaucht. Welche Ansprüche an die Kommunikation sich beispielsweise von dieser Aktualität ableiten lassen, wird in Kapitel 2.3.4 behandelt. Eine weitere von Beginn an bestehende Grundfunktion ist das Vernetzen, so dass sich Mitglieder untereinander in Beziehung setzen können. Hiermit kann der Personenkreis eingeschränkt werden, der die Statusmeldungen eines Mitgliedes lesen kann. Umgekehrt kann ein Mitglied seinerseits in seinen Neuigkeiten nur die Mitteilungen der vernetzten Personen sehen. Bei Facebook können Statusmeldungen in Form von Texten, Links, Videos oder Bildern geteilt werden. Auf Fotos können Nutzer markiert werden, so dass das Bild auf dessen Profil zu sehen ist. Reaktionen auf Postings sind in Form von Klicks auf den „Gefällt mir“-Button („Like“) oder Kommentaren möglich. Seinen viralen Charakter erhält die Seite dadurch, dass in den Neuigkeiten, die gleichzeitig die Startseite nach dem Login sind, auch Meldungen über eben jene Reaktionen auftauchen. So kann es etwa eine Neuigkeit sein, dass ein vernetztes Mitglied gerade irgendwo etwas kommentiert hat.
Facebook hat sich der fortschreitenden technischen Entwicklung immer wieder angepasst und neue Funktionen daraus abgeleitet. So besteht seit 2011 ein Ticker in der rechten oberen Ecke des Bildschirms, der sofort darüber informiert, wenn ein vernetztes Mitglied eine Aktion auf einer Seite vollzieht, auf der man selbst eine Leseberechtigung hat. Hierdurch verstärkt sich der Aktualitätsaspekt noch einmal.
Ferner reagierte das Unternehmen vor drei Jahren auf die Entwicklung hin zum mobilen Internet mittels Smartphones. So können Mitglieder seit 2010 die Ortungsfunktion ihres Smartphones nutzen, um zu zeigen, an welchem Ort sie sich gerade befinden. Dazu können auch Fotos im Nachhinein mit der Orte-Funktion übereingebracht werden oder das Mitteilen eines Ortes kann seinerseits mit einem Bild unterstützt werden.
Mit der Einführung der Orte-Funktion schuf Facebook eine weitere Möglichkeit zur Identitätsstiftung. Denn der Tätigkeit, der man gerade nachgeht und der vernetzten Nutzerschaft über die Statusmeldung mitteilt, können sogar weitere Nutzer hinzugefügt werden. So können Mitglieder nicht nur auf Fotos, sondern auch in Statusmitteilungen markiert werden. Alle diese neuen Funktionen können sogar überein- und in einer Statusmitteilung untergebracht werden, sodass sich in dieser eine Vielzahl von Informationen mitteilen lässt, wie in folgendem Beispiel:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 152
2.3.3 Nutzungsmotive
Weitgehend lassen sich alle Aktionen auf Facebook auf die beiden bereits erwähnten Schlagworte zurückführen: Austausch und Selbstdarstellung. Eines von beiden, in den meisten Fällen sogar beide Komponenten, sind die Intentionen jeder Aktion. Diese generellen Motivationen zu betrachten sind wichtig, da sie für die direkten kommunikativen Handlungen in dem Netzwerk auf die Politiker übertragbar sind, wenngleich diese Motivkette irgendwann dort endet, wo die Akteure Wählerstimmen gewinnen und Nutzer für ihre Politik mobilisieren möchten. Gemäß der Fragestellung dieser Arbeit muss die Frage nach den Nutzungsmotiven aber auch weiter spezifiziert werden, um die Kommunikation politischer Akteure via Facebook verstehen und einordnen zu können. So sollen ebenso die Motive für die Nutzung eines Fanprofils, also die Gründe für das Liken einer Seite kurz dargestellt werden. Zusammen mit den Motivationen für die generelle Facebook-Nutzung ist das der Aspekt, den Politiker mit ihren offiziellen Seiten bedenken müssen oder sollten und auf dem die Potenziale für die Mobilisierung von Wählern und die engere Bindung an einen Akteur oder eine Partei fundiert.
Für Gerhards et al. besteht der Reiz von Web 2.0-Angeboten zunächst auf der Dimension der Gestaltungsmöglichkeiten.53 Dies bezieht sich zwar auf die geringen Zugangshürden, die es Nutzern ermöglichen, selbst als Kommunikator zu partizipieren, doch das Motiv lässt sich auf politische Inhalte durchaus adaptieren. Denn beim Dialog mit Entscheidungsträgern können Facebook-Nutzer zumindest normativ-theoretisch noch mehr Dinge mitgestalten als nur ihre Profilseite. Die zweite Dimension ist die Kommunikationsebene,54 die sich dadurch auszeichnet, dass Mitglieder auf Facebook gestalten und nicht nur betrachten möchten. Es lässt sich also eine klare Tendenz zum Mitreden und Sich-Gehör-verschaffen konstatieren.
Aus den Theorien, die sich mit der Nutzung von Plattformen des Webs 2.0 befasst haben, geht auf Basis „von Experteninterviews und Fokusgruppen“55 eine Nutzertypologie hervor, über die mittlerweile weitgehend Einigkeit besteht. Demnach gibt es acht spezifische Nutzercharaktere auf Social-Media-Seiten, nämlich Produzenten (Veröffentlicher), Selbstdarsteller, Spezifisch Interessierte (Betrachtende und Produzierende zu bestimmten Themen), Netzwerker (Kontakteknüpfer), Profilierte (auf die alle bisherigen Kategorien zutreffen), Kommunikatoren (Kontaktepfleger), Info- und Unterhaltungssucher.56 Alle Kategorien sind Spezifika der Kernmotive Kommunikation und Eigendarstellung. Aus den Typologien zeigt sich jedoch, dass dem Kommunikationsaspekt mehr Raum gewährt wird. Das könnte allerdings auch der Fall sein, weil die Typologien auf Grundlage von Befragungen gewählt worden sind, die immer subjektiv gefärbt sind, wodurch ein hinterer Rang des negativ konnotierten Begriffes „Selbstdarstellung“ erklärbar wäre. Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass die acht Kategorien sich überschneiden können und eine aktive Handlung auf Facebook sowohl ein Akt des Austausches als auch zugleich ein Akt der Eigendarstellung sein kann.
Eine weitere Studie belegt, dass der Anteil von aktiv und passiv partizipierenden Nutzern des Webs 2.0 in etwa gleich groß ist.57 Die beiden Lager stehen dabei nicht in Konkurrenz zueinander, sondern sind geradezu aufeinander angewiesen. Die aktiv partizipierenden Nutzer wollen gelesen und kommentiert werden. Die lediglich betrachtenden Nutzer brauchen ihrerseits Inhalte zum Betrachten. Das heißt, dass die passiv partizipierenden Nutzer beim Login auf Facebook implizit erwarten, dass die Produzenten und Selbstdarsteller etwas veröffentlicht haben.
Die spezifischen allgemeinen Nutzungsmotive der Facebookmitglieder sind keine auf alle Zeit manifestierten Schemata. Vielmehr betreiben die Nutzer ihr Identitäts-, Beziehungs- und Informationsmanagement58 situativ.
Im Sinne der Typologie sind für Politische Akteure insbesondere die Spezifisch Interessierten, Profilierte, Netzwerker, Informations- und Unterhaltungssucher und auch die Selbstdarsteller interessant, wie die Motive zeigen, die den Ausschlag zum Liken einer Seiten geben.
Da es sich bei politischen Profilen um sogenannte Fanseiten handelt, stellt sich die spezifische Frage nach den Nutzungsmotiven für eben jene Angebote. Das US-amerikanische Internetunternehmen Exacttarget hat für den dortigen Markt eine Studie zu diesen Motiven und den Gründen für ein Rückgängigmachen eines Likes durchführen lassen und kommt zu folgenden Ergebnissen.
Abb. 2 59
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Statistisches Bundesamt, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischeWochenBerichte/WochenBerichte_Bevoelkerung.pdf?_ _blob=publicationFile, S. 3, 25. Januar 2013.
2 Klingenburg, Peter/ Nebendahl, Jens (Hrsg.): Webolution. (Über-) Leben in der digitalen Welt. Göttingen 2010, S. 4.
3 Ebd.
4 Bildet eine Doppelspitze mit Claudia Roth.
5 Rhomberg, Markus: Politische Kommunikation. Eine Einführung für Politikwissenschaftler, Paderborn 2009, S. 13.
6 Jarren, Otfried/ Donges, Patrick: Politische Kommunikation in der Mediengesellschaft, 3. Auflage, Wiesbaden 2011, S. 119ff.
7 Ebd.
8 Sarcinelli, Ulrich: Politische Kommunikation in Deutschland. Medien und Politikvermittlung im demokratischen System, 3. Auflage, Wiebaden 2011, S. 194.
9 Vgl. Baumert, Gerhard: Meinungsbildung und öffentliche Meinung in der modernen Gesellschaft, in: FriedrichEbert-Stiftung: Die politische Urteilsbildung in der Demokratie, Hannover 1960, S. 13ff.
10 Balfanz, Detlev: Öffentlichkeitsarbeit öffentlicher Betriebe, Regensburg 1983, S. 29.
11 Nach: Becker, Peter: Kommunikation, Netzwerke, Öffentlichkeit. Überlegungen zu einer
Kommunikationsgeschichte der Verwaltung, in: Becker, Bernd: Öffentliche Verwaltung. Lehrbuch für Wissenschaft und Praxis, Percha 1989, S. 622.
12 Vgl. hierzu Kamps, Klaus: Politisches Kommunikationsmanagement. Grundlagen und Professionalisierung moderner Politikvermittlung, Wiesbaden 2007, S. 130.
13 Ebd., S. 139.
14 Sarcinelli: Politische Kommunikation, S. 19.
15 Vgl. Strohmeier, Gerd: Politik und Massenmedien, Baden-Baden 2004, S. 107.
16 Palazzo, Guido: Die Mitte der Demokratie. Über die Theorie deliberativer Demokratie von Jürgen Habermas, Baden-Baden 2002, S. 30.
17 Marschall, Stefan: Politik „online“ - Demokratische Öffentlichkeit dank Internet?, in:Publizistik. Vierteljahreshefte für Kommunikationsforschung, 42. Jahrgang, Heft 3/1997, Wiesbaden 1997, S. 311.
18 Vgl. Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit, Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuauflage 1990, unveränderter Nachdruck der Erstauflage von 1962, Frankfurt am Main 1990.
19 Gerhards, Jürgen/ Neidhardt, Friedhelm: Strukturen und Funktionen moderner Gesellschaft. Fragestellungen und Ansätze, Berlin 1990, S. 16. Abrufbar unter: http://www.polsoz.fu- berlin.de/soziologie/arbeitsbereiche/makrosoziologie/mitarbeiter/lehrstuhlinhaber/dateien/GerhardsNeidhard t-1990.pdf
20 Ebd.
21 Abgesehen von der Notwendigkeit eine kostenpflichtigen Internetanschlusses.
22 Brodocz, André/ Schaal, Gary S. (Hrsg.): Politische Theorien der Gegenwart II. Eine Einführung, 2. Erweiterte und aktualisierte Auflage, Opladen & Farmington Hills 2006, S. 99ff.
23 Gerhards/ Neidhardt: Strukturen und Funktionen moderner Gesellschaft, S. 12ff.
24 Miebach, Bernhard: Soziologische Handlungstheorie. Eine Einführung, 2. Auflage, Wiesbaden 2006.
25 Schmidt, Manfred G.: Demokratietheorien. Eine Einführung, 5. Auflage, Wiesbaden 2008.
26 Schnabel, Nicolas: Politische Mobilisierung in Sozialen Netzwerken im Web 2.0. Eine quantitative empirische Studie aus Nutzerperspektive, Hannover 2010, S. 11.
27 ARD/ZDF-Onlinestudie 1997 bis 2012, einsehbar unter: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/, 15.05.2013.
28 Strohmeier: Politik und Massenmedien. S. 146.
29 Strohmeier: Politik und Massenmedien, S. 144.
30 Ein Beispiel ist die Facebook-Party von Horst Seehofer im Mai 2012 in einer Münchner Nobediscothek, die selbst zwar kein großer Erfolg war, über die jedoch von diversen Fernsehprogrammen ausführlich berichtet wurde. Die Facebook-Seite Seehofers zählte in dieser Zeit eine sprunghafte Steigerung von Likes.
31 Schnabel, Nicolas: Politische Mobilisierung in Sozialen Netzwerken im Web 2.0. Eine quantitative empirische Studie aus Nutzerperspektive, Hannover 2010, S. 21.
32 Lingnau, Alina: Politische Kommunikation 2.0? Eine empirische Untersuchung zur Wahrnehmung, Nutzung und Bewertung politischer Profile in sozialen Netzwerken, Hannover 2010, S. 14.
33 ARD/ZDF-Onlinestudie: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/fileadmin/Online12/0708- 2012_Eimeren_Frees.pdf, 01.03.2013.
34 Der Bundeswahlleiter: http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/BTW_BUND_09/, 01.03.2013.
35 Shell-Jugendstudie 2010: http://s01.static-shell.com/content/dam/shell/static/deu/downloads/youth-study- 2010pressrelease140910.pdf. 01.03.2013.
36 Bohnen, Johannes/ Kallmorgen, Jan-Friedrich: Wie Web 2.0. die Politik verändert. Wahlen allein reichen nicht. Technologie formt eine neue Bürgergesellschaft, in: IP - Die Zeitschrift, Juli/August 2009, einzusehen unter: https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/article/getFullPDF/14914, S. 18, 01.03.2013.
37 Ebd.
38 Bohnen, Johannes/ Kallmorgen, Jan-Friedrich: Wie Web 2.0. die Politik verändert, S. 19.
39 Hoecker, Barbara: Mehr Demokratie via Internet? In: Aus Politik und Zeitgeschichte 30.9.2002, S. 37.
40 Ebd.
41 Schnabel: Politische Mobilisierung, S. 21.
42 Sarcinelli: Politische Kommunikation, S. 163.
43 Hoecker, Mehr Demokratie via Internet?, S. 38ff.
44 Welz, Hans-Georg: Politische Öffentlichkeit und Kommunikation im Internet, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 30.09.2009, S. 11.
45 Schnabel: Politische Mobilisierung, S. 22f.
46 Schmidt, Jan: Das neue Netz. Merkmale, Praktiken und Folgen des Web 2.0, Konstanz 2009, S. 145ff.
47 Nach Katzenbach, Christian: Weblogs und ihre Öffentlichkeiten. Zur Aushandlung von Relevanz im Internet, Berlin 2007, in: Möller, Erik: Die heimliche Revolution. Wie Weblogs, Wikis und freie Software die Welt verändern, Hannover 2005, S. 7.
48 In Deutschland ist es sogar fast ein Nachzügler, denn hierzulande war „StudiVZ“ das erste Social-Media- Angebot, das ein Millionenpublikum für sich begeisterte.
49 http://www.zeit.de/digital/internet/2011-01/myspace-entlassungen-deutschland, 13.03.2013.
50 http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/holtzbrinck-verlag-verkauft-studivz-ende-einer-fehlinvestition- 11886336.html, 13.03.2013.
51 Kneidinger, Bernadette: Facebook und Co. Eine soziologische Analyse von Interaktionsformen in Online Social Networks, Wiesbaden 2010, S. 59.
52 https://www.facebook.com/muellersoenksen, 13.03.2013.
53 Gerhards, Maria/ Klingler, Walter/ Trump, Thilo: Das Social Web aus Rezipientensicht: Motivation, Nutzung und Nutzertypen, in: Zerfaß, Ansgar/ Welker, Martin/ Schmidt, Jan (Hrsg.): Kommunikation, Partizipation und Wirkungen im Social Web. Grundlagen und Methoden: Von der Gesellschaft zum Individuum, Köln 2008, S. 130.
54 Ebd., S. 131.
55 Kneidinger: Facebook und Co., S. 52.
56 Gerhards et al.: Das Social Web aus Rezipientensicht, S. 146.
57 Ebd., S. 147.
58 Schmidt: Das neue Netz, S. 74ff.
59 Exacttarget, abrufbar unter http://blog.kennstdueinen.de/2011/03/twitter-facebook-warum-entfolgen-fans- follower-unternehmen/, 14.03.2013.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Facebook für die politische Kommunikation in Deutschland?
Facebook dient Politikern als eigenes Massenmedium, um Bürger direkt ohne die Filterfunktion klassischer Medien zu erreichen, das Image zu pflegen und politische Ziele zu vermitteln.
Was sind die Kriterien für eine erfolgreiche Politiker-Fanseite?
Wichtige Faktoren sind Authentizität, regelmäßige Aktualität, Interaktivität (Dialog mit Nutzern) und die Einhaltung der kulturellen Praxen der Online-Kommunikation.
Wie wird „Diskursivität“ auf Facebook-Seiten von Politikern gemessen?
Diskursivität bezieht sich auf die Bereitschaft und Qualität der Politiker, auf Kommentare einzugehen und eine echte Debatte mit den Bürgern zu führen.
Was bedeutet die „Gatekeeper-Funktion“ im Kontext von Social Media?
Klassische Medien fungieren als Gatekeeper (Torwächter), die entscheiden, welche Informationen die Öffentlichkeit erreichen. Facebook ermöglicht es Politikern, diese Instanz zu umgehen.
Warum ist Authentizität für Spitzenpolitiker auf Facebook so schwierig?
Die Herausforderung liegt darin, trotz professioneller Betreuung der Seiten durch Teams einen persönlichen und glaubwürdigen Eindruck zu vermitteln, der die „Aura der Distanz“ überbrückt.
- Citar trabajo
- Manuel Neumann (Autor), 2013, Macht zum Mitmachen?!, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264305