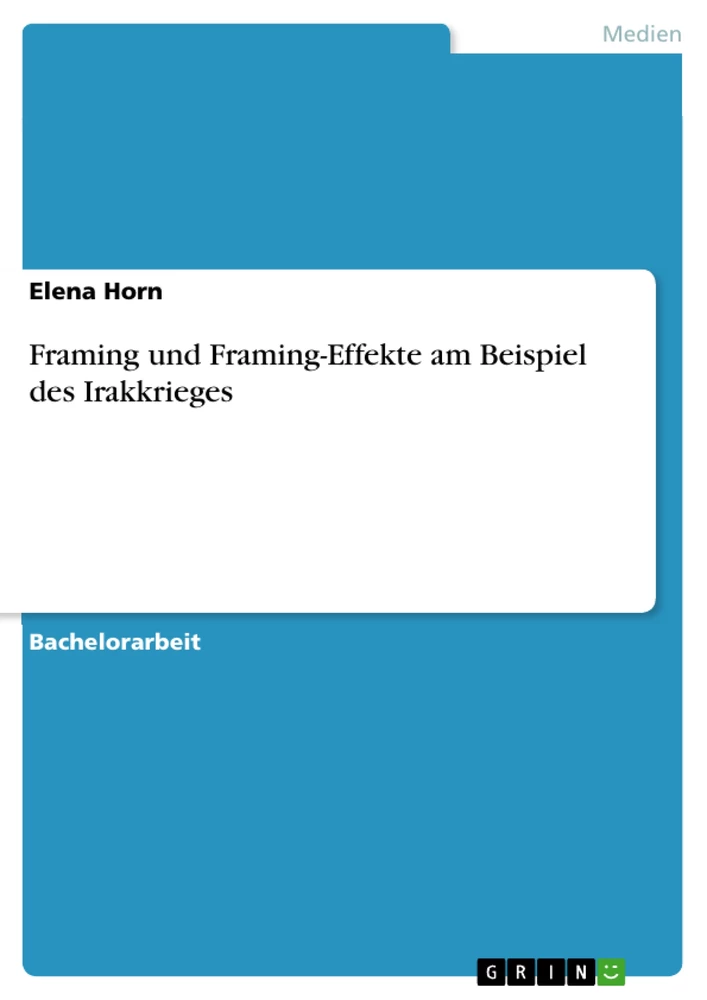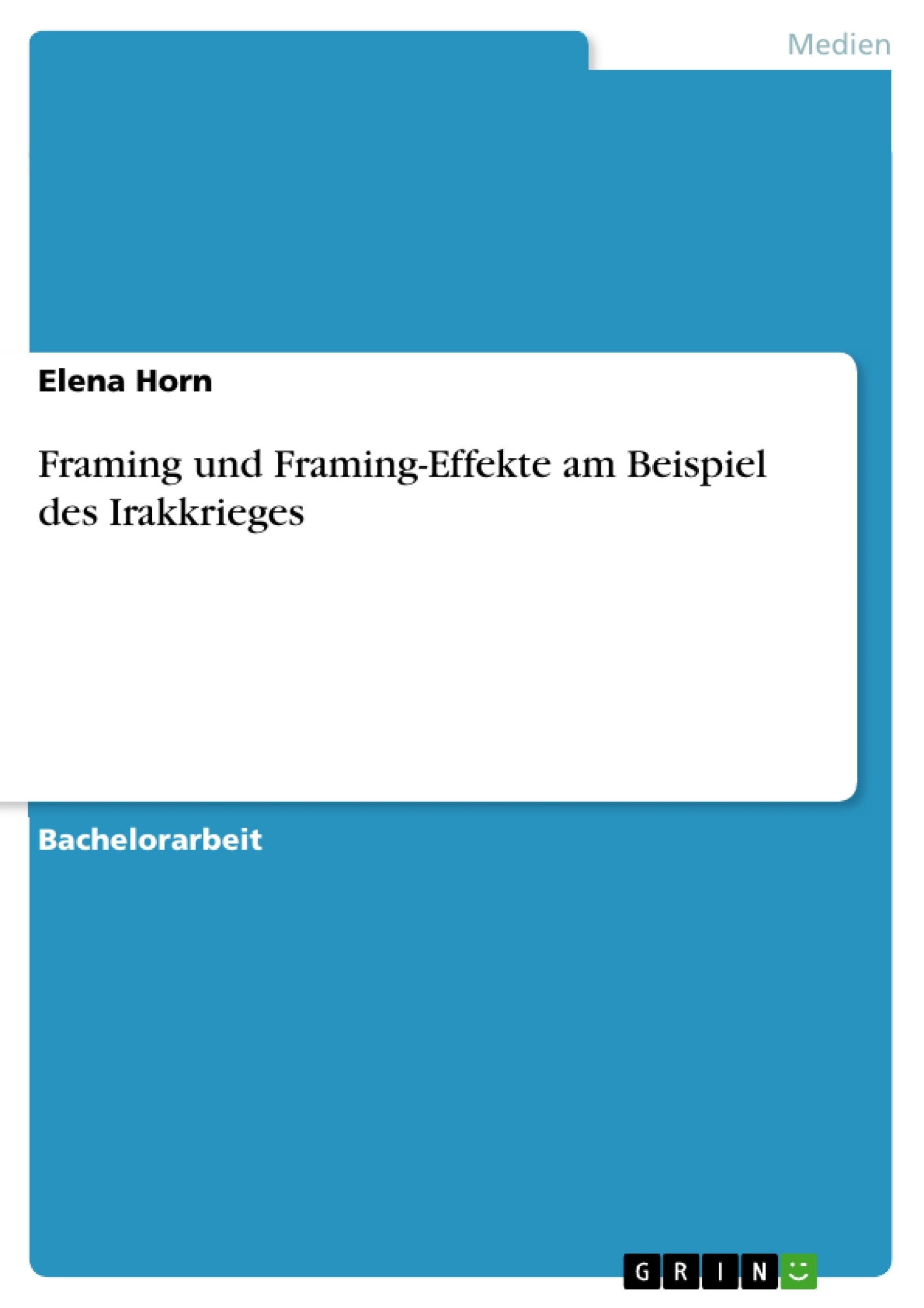„Modern warfare is fought not only with weapons, but also with words aiming to win the ‘hearts and minds’ of the people“ (Dimitrova & Strömbäck, 2008, S. 216).
Massenmediale Kommunikation ist jene Pforte, die in modernen Industriegesellschaften den Bürgern die Möglichkeit zur Einsicht und Partizipation an politischen Prozessen gewährt. Auf der anderen Seite ermöglicht sie den Kommunikationsfluss von Seiten der politischen Entscheidungsträger zum Volk. Tageszeitungen und Fernsehnachrichten bilden die entscheidenden Plattformen für die Informationsübermittlung. Doch eine massenmedial kommunizierte Information wird nicht unabhängig und zusammenhangslos übertragen, sondern von Medienproduzenten und Journalisten in Sinnzusammenhänge gesetzt, die in ihrer Struktur von zahlreichen Faktoren abhängen. Diese Einordnung einer Nachricht in ein Bedeutungsumfeld wird Framing genannt und führt bestimmte Effekte in der Informationselaborierung auf Seiten des Rezipienten mit sich. Im Rahmen dieser Arbeit soll vor allem der wirkungszentrierte Framing-Ansatz beleuchtet werden (Entman, 1993).
In Abgrenzung zum Medien-Priming und Agenda-Setting stellt sich vor allem die Frage, welchen Einfluss Frames auf unsere Urteile und Entscheidungen haben können. Anhand einschlägiger Studien wird formal-abstraktes sowie inhaltliches Framing definiert und ihre potentiellen Effekte auf den Rezipienten herausgearbeitet. Das Kapitel endet mit einer kurzen Zusammenfassung des Themas und wird im Anschluss am Beispiel der Kriegsberichterstattung bezüglich der US-amerikanischen Interventionen im Irak 2003 genauer betrachtet. Der 3. Golfkrieg bietet sich als Analysegegenstand besonders an, da Fotografen und Journalisten die amerikanischen Truppen im Einsatzgebiet begleiteten und Informationen durch das Internet noch weit schneller diffundierten als es noch im 2. Golfkrieg 1990/91 der Fall war (Schwalbe et al., 2008). Die Analyse des visuellen Framings des Irakkrieges konzentriert sich zunächst auf die Nachrichtenberichterstattung in den USA. Anhand einer Studie von Schwalbe et al. wird die Veränderung des Framings im Verlaufe des Krieges in Wochenintervallen untersucht und in fünf Szenarien der Kriegsberichterstattung aufgegliedert. Durch einen Vergleich zwischen den Framing-Strategien der USA und Schweden wird versucht, einen Überblick über jene Faktoren zu gewinnen, die den Einsatz bestimmter Frames und damit einhergehende Effekte auf Rezipientenseite bedingen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Informationsverarbeitung und Erinnerung
- Die Schema-Theorie
- Schablonen-Schemata
- Prototypen
- Scripts
- Kritik an der Schema-Theorie
- Mentale Wissensrepräsentationen
- Mentale Modelle in der Nachrichtenproduktion und –redaktion
- Wissensvernetzung – ein Überblick über verschiedene Konzepte
- Semantische Netzwerke
- Konnektionistische Netzwerke
- Die Schema-Theorie
- Framing
- Definition
- Framing in Abgrenzung von anderen Konzepten
- Die verschiedenen Ansätze des Framings
- Attribute-Agenda-Setting
- Medien-Priming
- Wie mediale Frames unsere Urteile beeinflussen können
- Etablierung und Veränderung von Vorstellungen
- Meinungsänderung durch Framing-Effekte
- Formal-abstraktes Framing
- Episodisches und thematisches Framing
- Strategisches und themenbezogenes Framing
- Inhaltliches Framing
- Zwischenfazit
- Framing in der Kriegsberichterstattung
- Perzeption der Golfkriege in der US-amerikanischen Gesellschaft
- Visuelles Framing des Irakkrieges in der amerikanischen Medienberichterstattung
- Die fünf Szenarien der Kriegsberichterstattung
- Kritik an der Studie
- Framing des Golfkrieges im internationalen Vergleich
- Framing des Golfkrieges in den USA und in Schweden
- Pluralität im Framing des Golfkriegs in Großbritannien
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht den Einfluss von Framing-Effekten auf die Rezeption des Irakkrieges. Die Arbeit beleuchtet die psychologischen Grundlagen der Informationsverarbeitung und erläutert das Framing-Konzept im Kontext von Medienberichterstattung. Ein zentrales Anliegen ist die Analyse, wie Framing-Strategien in der Kriegsberichterstattung die öffentliche Meinung beeinflussen können.
- Informationsverarbeitung und Erinnerung im Kontext von Schematheorien
- Das Konzept des Framings und seine Abgrenzung zu anderen Medien-Effekten
- Analyse von Framing-Strategien in der US-amerikanischen Berichterstattung zum Irakkrieg
- Internationaler Vergleich von Framing-Ansätzen in der Berichterstattung zum Irakkrieg
- Der Einfluss von Framing auf die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Framing und seine Bedeutung in der modernen Medienlandschaft ein. Sie skizziert den Forschungsansatz und die Struktur der Arbeit, wobei der Fokus auf dem wirkungszentrierten Framing-Ansatz liegt. Die Untersuchung des Irakkrieges als Fallbeispiel wird begründet.
Informationsverarbeitung und Erinnerung: Dieses Kapitel behandelt die wahrnehmungspsychologischen Grundlagen der Informationsverarbeitung und legt den Fokus auf die Relevanz von Schemata (Schablonen-Schemata, Prototypen, Scripts) für das Verständnis von Framing. Mentale Wissensrepräsentationen und verschiedene Modelle der Wissensvernetzung werden erläutert, um den Kontext für das spätere Framing-Konzept zu schaffen.
Framing: Dieses Kapitel definiert das Konzept des Framings und grenzt es von anderen Konzepten wie Medien-Priming und Agenda-Setting ab. Es werden verschiedene Ansätze des Framings vorgestellt und der Einfluss von Frames auf Urteile und Entscheidungen anhand einschlägiger Studien analysiert. Formal-abstraktes und inhaltliches Framing werden definiert und ihre potenziellen Effekte auf den Rezipienten herausgearbeitet.
Framing in der Kriegsberichterstattung: Dieses Kapitel analysiert das Framing des Irakkrieges in der US-amerikanischen Medienberichterstattung, unter anderem anhand einer Studie von Schwalbe et al. (2008). Die fünf Szenarien der Kriegsberichterstattung werden vorgestellt. Ein internationaler Vergleich, insbesondere mit Schweden und Großbritannien, zeigt Unterschiede in den Framing-Strategien und deren potenziellen Einfluss auf die öffentliche Meinung.
Schlüsselwörter
Framing, Framing-Effekte, Informationsverarbeitung, Erinnerung, Schematheorie, Mentale Modelle, Wissensvernetzung, Medienberichterstattung, Irakkrieg, Golfkrieg, US-amerikanische Medien, Öffentliche Meinung, Meinungsbildung, Kriegsberichterstattung, Internationaler Vergleich.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Framing im Irakkrieg
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Framing-Effekten auf die öffentliche Wahrnehmung des Irakkrieges. Sie analysiert, wie Framing-Strategien in der Medienberichterstattung die Meinungsbildung beeinflussen und welche psychologischen Grundlagen diesen Effekten zugrunde liegen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Informationsverarbeitung und Erinnerung im Kontext von Schematheorien, das Framing-Konzept und seine Abgrenzung zu anderen Medieneffekten (wie Agenda-Setting und Priming), eine detaillierte Analyse von Framing-Strategien in der US-amerikanischen Berichterstattung zum Irakkrieg, ein internationaler Vergleich von Framing-Ansätzen (USA, Schweden, Großbritannien) und schließlich der Einfluss von Framing auf die öffentliche Meinung und politische Entscheidungen.
Welche psychologischen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die psychologischen Grundlagen der Informationsverarbeitung und des Erinnerns, insbesondere im Zusammenhang mit Schematheorien (Schablonen-Schemata, Prototypen, Scripts). Mentale Wissensrepräsentationen und verschiedene Modelle der Wissensvernetzung werden erläutert, um das Verständnis von Framing zu vertiefen.
Wie wird das Framing-Konzept definiert und abgegrenzt?
Die Arbeit definiert das Framing-Konzept präzise und grenzt es von ähnlichen Konzepten wie Medien-Priming und Agenda-Setting ab. Verschiedene Ansätze des Framings werden vorgestellt, und der Einfluss von Frames auf Urteile und Entscheidungen wird anhand einschlägiger Studien analysiert. Die Unterscheidung zwischen formal-abstraktem und inhaltlichem Framing wird ebenfalls thematisiert.
Welche Fallstudien werden untersucht?
Die Arbeit analysiert vor allem die Berichterstattung zum Irakkrieg, insbesondere die US-amerikanische Medienberichterstattung. Eine Studie von Schwalbe et al. (2008) und die darin beschriebenen fünf Szenarien der Kriegsberichterstattung werden diskutiert. Ein internationaler Vergleich mit Schweden und Großbritannien zeigt Unterschiede im Framing und dessen Auswirkungen auf die öffentliche Meinung auf.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Framing, Framing-Effekte, Informationsverarbeitung, Erinnerung, Schematheorie, Mentale Modelle, Wissensvernetzung, Medienberichterstattung, Irakkrieg, Golfkrieg, US-amerikanische Medien, Öffentliche Meinung, Meinungsbildung, Kriegsberichterstattung, Internationaler Vergleich.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Informationsverarbeitung und Erinnerung, ein Kapitel zum Framing-Konzept, ein Kapitel zum Framing in der Kriegsberichterstattung (mit Fokus auf den Irakkrieg und internationalen Vergleichen) und ein Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die zentrale Zielsetzung der Arbeit ist die Untersuchung des Einflusses von Framing-Effekten auf die Rezeption des Irakkrieges. Sie möchte aufzeigen, wie Framing-Strategien in der Kriegsberichterstattung die öffentliche Meinung beeinflussen können.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit folgt einer klaren Struktur mit Einleitung, Hauptkapiteln zu den relevanten Theorien und Fallstudien, und einem Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und Kapitelzusammenfassungen erleichtern die Navigation.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Psychologie, sowie für alle, die sich für die Wirkungsweise von Medien, Meinungsbildung und die Rezeption von Konflikten interessieren.
- Arbeit zitieren
- Elena Horn (Autor:in), 2011, Framing und Framing-Effekte am Beispiel des Irakkrieges, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264608