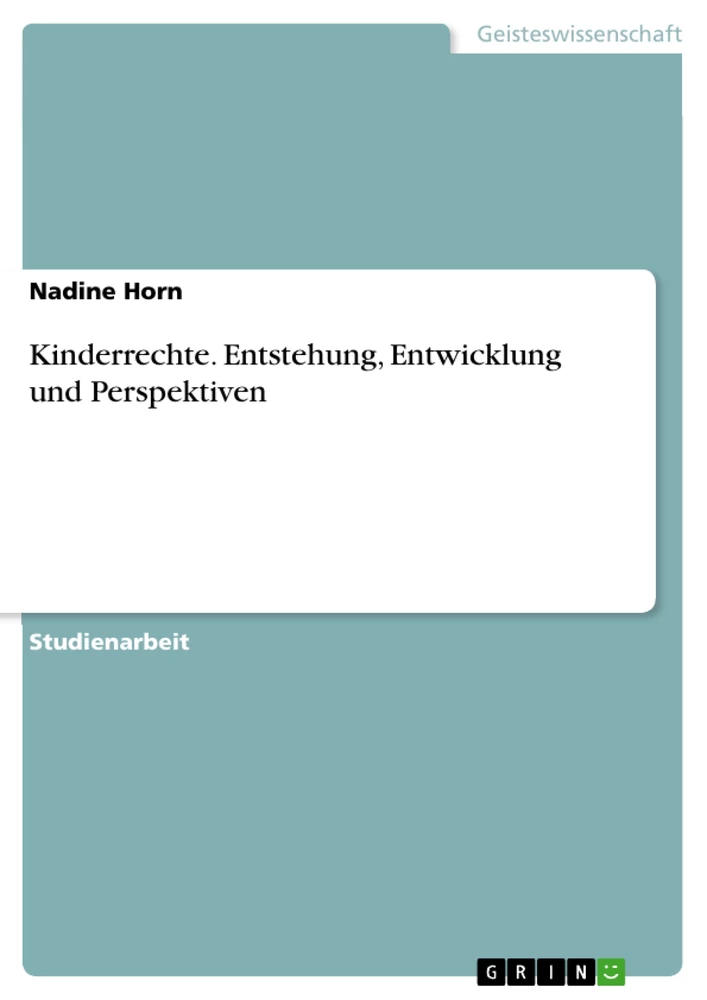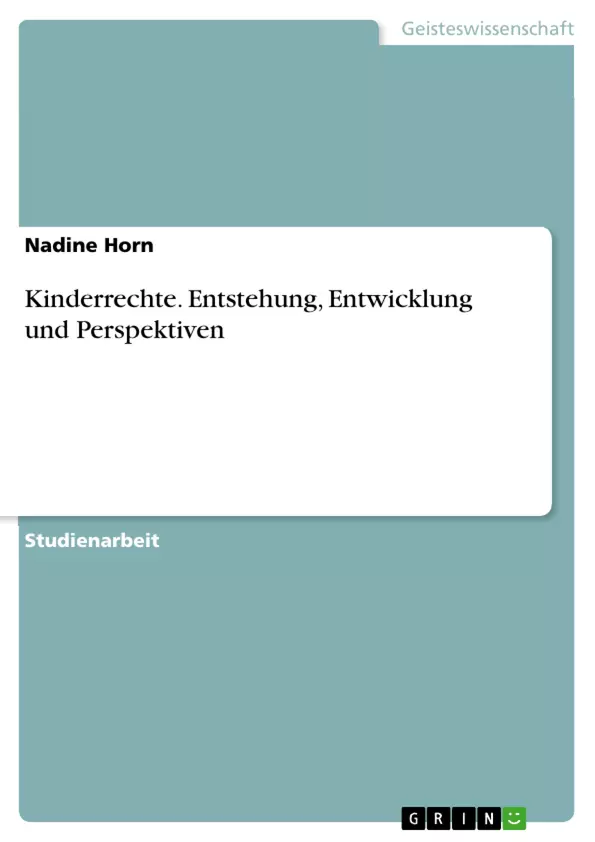Jedes Individuum gilt als Träger von Menschenrechten, welche für alle Menschen weltweit gleich sind. Erwachsene Menschen und Kinder sind ohne Frage gleichwertig, jedoch sind sie in Bezug ihrer Rechte ebenfalls gleichartig?
Da in den letzten Jahren die Verankerung spezieller Kinderrechte im Grundgesetz verstärkt in den Fokus politischer Grundsatzdiskussionen gerückt ist, thematisiere ich die Entstehung, Entwicklung und Perspektiven von Kinderrechten.
Ich gehe der Frage über den Ursprung, sowie der Ratifizierung und der Umsetzung von Kinderrechten nach. Des Weiteren möchte ich insbesondere klären, welche Rechte Kinder haben und worin die Notwendigkeit individueller Rechte für Kinder besteht.
Um den Beweggrund meiner Themenauswahl aufzugreifen, gehe ich abschließend auf die Frage zur Umsetzung einer Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz ein.
Der Schwerpunkt dieser Hausarbeit liegt darin, den Verlauf der Entwicklung, die Bedeutung der UN-Kinderrechtskonvention, sowie die Umsetzung von Kinderrechten darzustellen.
Die Grundlage meiner Ausarbeitung bildet ausschließlich wissenschaftliche Literatur.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition Kinder und Jugendliche
3. Zur Geschichte der Menschen- und Kinderrechte
3.1 Die Pioniere der Kinderrechte
3.1.1 Eglantyne Jebb und die Genfer Deklaration des Völkerbundes
von 1924
3.1.2 Janusz Korczak
4. Die UN-Kinderrechtskonvention
4.1 Inhalt und Struktur
5. Kinderrechte in der europäischen Union
6. Kinderrechte in Deutschland
6.1 Kinderrechte ins Grundgesetz?
7. Fazit
Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Wie sind Kinderrechte historisch entstanden?
Die Arbeit beleuchtet Pioniere wie Eglantyne Jebb, die die Genfer Deklaration von 1924 initiierte, sowie Janusz Korczak, der sich für die Würde des Kindes einsetzte.
Was ist die UN-Kinderrechtskonvention?
Es ist ein internationales Abkommen, das spezifische Rechte für Kinder weltweit festlegt und deren Schutz, Förderung und Beteiligung garantiert.
Sollen Kinderrechte in das deutsche Grundgesetz aufgenommen werden?
Die Arbeit diskutiert die aktuelle politische Debatte über die explizite Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz zur Stärkung der Rechtsstellung von Kindern.
Warum brauchen Kinder eigene Rechte zusätzlich zu den Menschenrechten?
Kinder haben aufgrund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit und Entwicklungsphase spezifische Bedürfnisse, die durch allgemeine Menschenrechte allein nicht ausreichend abgedeckt werden.
Welche Rolle spielt die Europäische Union bei Kinderrechten?
Die Arbeit gibt einen Überblick über die Stellung und den Schutz von Kinderrechten innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen der EU.
- Citation du texte
- Nadine Horn (Auteur), 2012, Kinderrechte. Entstehung, Entwicklung und Perspektiven, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264660