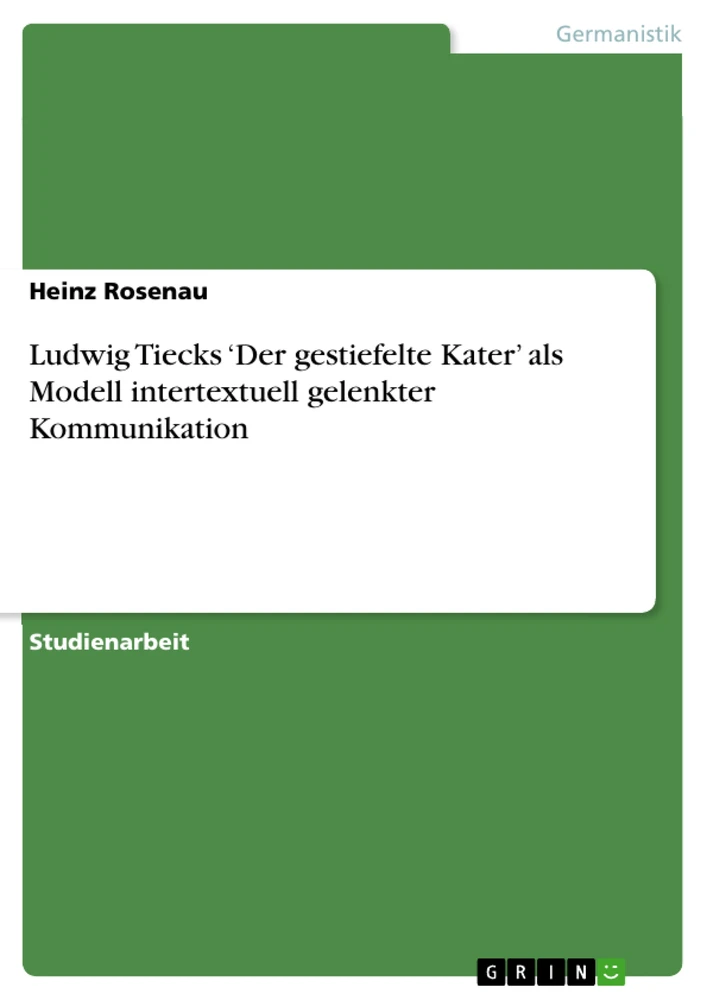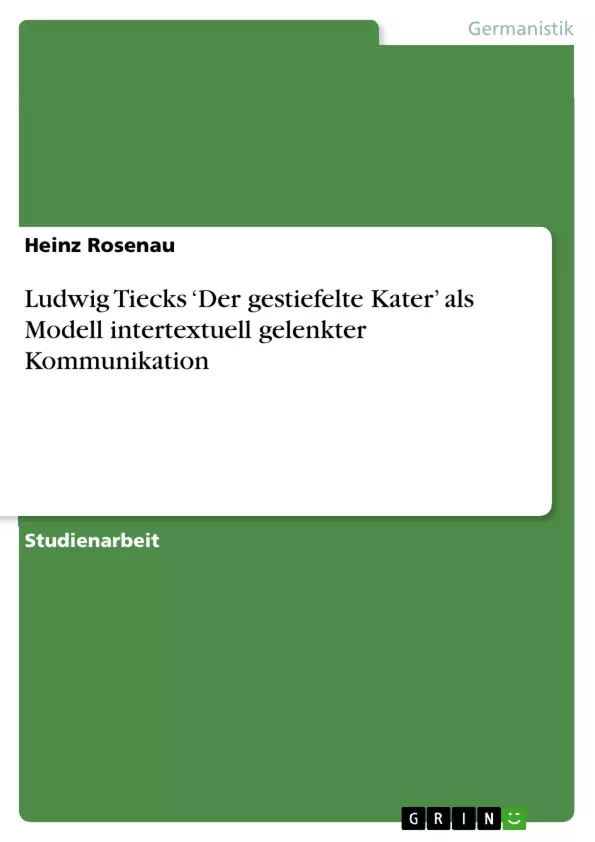Nicht nur die konkreten Bezüge auf Vertreter des vorromantischen Theaters (besonders Iffland und Böttiger) rücken Ludwig Tiecks Theaterstück Der gestiefelte Kater in den Blickpunkt intertextueller Forschung. Die durch die romantische Poetik erstrebte und im gestiefelten Kater realisierte Vereinigung von Epik und Dramatik, sowie besonders das Hauptthema des Stücks, das Scheitern der theatralischen Kommunikation machen Tiecks Lustspiel zum Gegenstand einer rezeptionsorientierten, intertextuellen Analyse. Als ein Hauptgrund für das Scheitern der theatralischen Kommunikation erscheinen die zahlreichen dem Text des fiktiven Theaterstücks immanenten, intertextuellen Referenzen, sowie die von den Zuschauern im Rezeptionsprozeß an das Stück herangeführten, intertextuell gelenkten Interpretationsversuche. Das fiktive Stück wird nicht, wie es der fiktive Autor am Ende fordert , für sich wahrgenommen, sondern löst bei seinen Zuschauern verschiedenartige intertextuelle Bezüge aus, die die Rezeption steuern und - im Sinne des fiktiven Autors - verfälschen. Die mehrfach von den fiktiven Zuschauern formulierten Motive der ‘Tollheit’ und ‘Verrücktheit’ , die das fiktive Stück hervorruft, scheinen das Resultat eben dieser mißlingenden Versuche einer intertextuell gelenkten Textinterpretation zu sein. Das fiktive Stück entspricht nicht den Erwartungen der theatralischen Gattungen, in deren Rahmen seine Zuschauer es zu verstehen versuchen, sämtliche gattungsgebundenen Handlungsvorhersagen und Wertungsversuche schlagen fehl: das fiktive Stück erscheint seinen Zuschauern als inkohärent.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Begriffs 'Intertextualität'
- Ein Kommunikationsmodell dramatischer Texte. Das Spiel im Spiel als sekundäres Kommunikationssystem
- Intertextualität auf der Ebene N1 (fN1)
- Intertextualität auf der Ebene N1 (fN3, fN4)
- Das systemtheoretische Kommunikationsmodell
- Objektinkohärenz
- Die Kollektivität der Produktion und Rezeption
- Rezipientenmodell und Produzentenmodell
- Die Dynamik des Produzentenmodells
- Die partielle Textverarbeitungsstrategie
- Intertextualität auf der Ebene N3
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, Ludwig Tiecks 'Der gestiefelte Kater' als Modell für intertextuell gelenkte Kommunikation zu analysieren. Der Fokus liegt dabei auf dem Scheitern der theatralischen Kommunikation im Stück und der Rolle, die intertextuelle Referenzen in diesem Prozess spielen.
- Die Verbindung von Epik und Dramatik in Tiecks romantischem Theater
- Das Scheitern der theatralischen Kommunikation im 'Gestiefelten Kater'
- Intertextuelle Referenzen als Ursache für das Scheitern der Kommunikation
- Die Rolle des Rezipienten bei der intertextuellen Interpretation des Stückes
- Das systemtheoretische Kommunikationsmodell als Analysewerkzeug für die Intertextualität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und führt in die Forschungsfrage ein, indem sie das Scheitern der theatralischen Kommunikation im 'Gestiefelten Kater' und die Bedeutung intertextueller Referenzen beleuchtet.
- Definition des Begriffs 'Intertextualität': Dieses Kapitel bietet eine umfassende Diskussion über den Begriff 'Intertextualität' und seine verschiedenen Facetten. Es werden verschiedene Modelle und Ansätze vorgestellt, die unterschiedliche Definitionen und Methoden zur Untersuchung von Intertextualität vertreten.
- Ein Kommunikationsmodell dramatischer Texte. Das Spiel im Spiel als sekundäres Kommunikationssystem: In diesem Kapitel wird ein Kommunikationsmodell für dramatische Texte entwickelt, das die Besonderheit des 'Theaters im Theater' berücksichtigt. Es werden die verschiedenen Ebenen der theatralischen Kommunikation analysiert und die Rolle der Intertextualität in diesem Prozess untersucht.
- Intertextualität auf der Ebene N1 (fN1): Dieses Kapitel analysiert die Intertextualität auf der Ebene des Spiels im Spiel. Es werden die intertextuellen Referenzen der Figuren des fiktiven Theaterstücks untersucht und ihre Bedeutung für das Scheitern der Kommunikation im Stück beleuchtet.
- Intertextualität auf der Ebene N1 (fN3, fN4): Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Intertextualität auf der Ebene der Produktion des fiktiven Theaterstücks. Es werden die Produktionsfunktionen des Spiels im Spiel untersucht und die Rolle der intertextuellen Referenzen in diesem Kontext analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Intertextualität, theatralische Kommunikation, Ludwig Tieck, 'Der gestiefelte Kater', Romantische Poetik, Systemtheorie, Rezeption, Textverarbeitung und Produktionsmodell.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Ludwig Tiecks 'Der gestiefelte Kater'?
Das Hauptthema ist das Scheitern der theatralischen Kommunikation, dargestellt durch ein "Spiel im Spiel", bei dem die Erwartungen des Publikums enttäuscht werden.
Welche Rolle spielt die Intertextualität in diesem Stück?
Intertextuelle Referenzen steuern die Wahrnehmung der Zuschauer. Da das fiktive Stück jedoch Gattungserwartungen bricht, führen diese Referenzen zu Fehlinterpretationen und dem Eindruck von Inkohärenz.
Was versteht man unter dem "Spiel im Spiel" bei Tieck?
Es ist ein sekundäres Kommunikationssystem, in dem fiktive Zuschauer eine Aufführung kommentieren, was die Grenzen zwischen Realität und Fiktion in der romantischen Poetik verwischt.
Warum empfinden die fiktiven Zuschauer das Stück als "toll" oder "verrückt"?
Dies ist das Resultat misslingender Versuche, das Gesehene in bekannte literarische Gattungen und Konventionen einzuordnen.
Wie verbindet Tieck Epik und Dramatik?
Tieck nutzt romantische Ironie und reflexive Elemente, um die dramatische Handlung durch erzählerische und kommentierende Ebenen zu unterbrechen und zu erweitern.
- Quote paper
- Heinz Rosenau (Author), 1998, Ludwig Tiecks ‘Der gestiefelte Kater’ als Modell intertextuell gelenkter Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264681