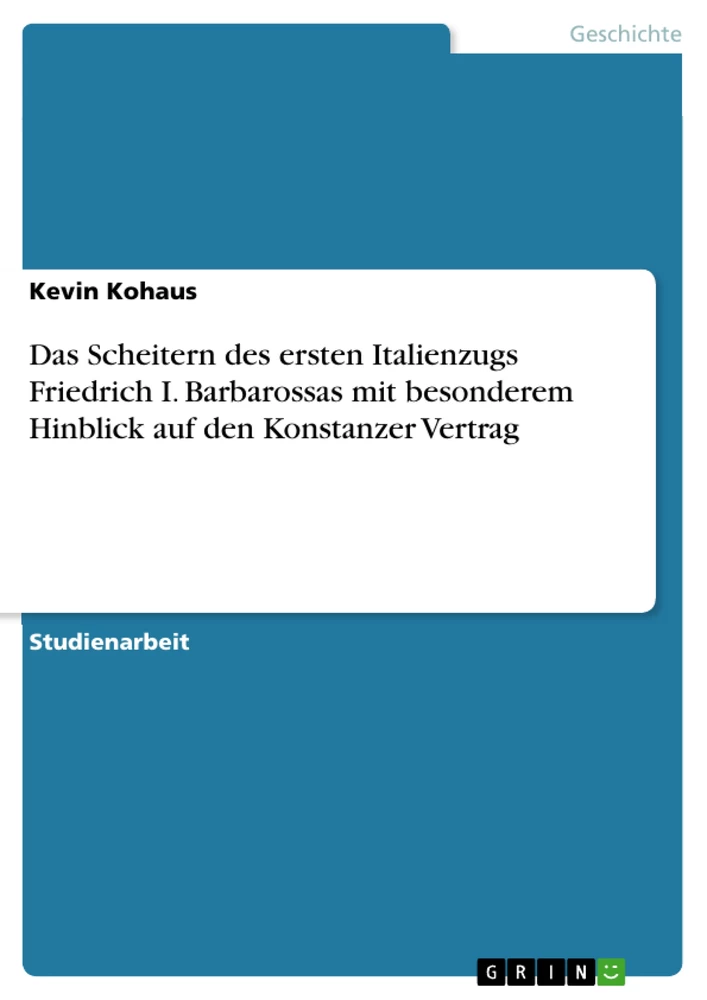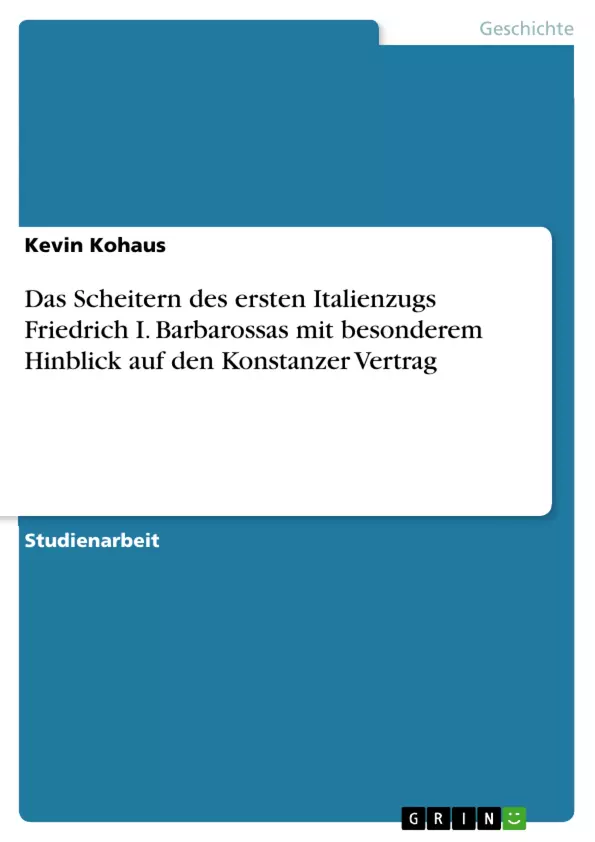In dieser Hausarbeit geht es um den letztlich gescheiterten 1. Italienzug Friedrich I. Barbarossas. Ein besonderer Fokus liegt hier auf dem zuvor abgeschlossenen Konstanzer Vertrag von 1153, durch welchen es zu Spannungen zwischen Papst und Kaiser kam. Das Potential und die realen Konsequenzen - sowohl positiv als auch negativ - werden hier für beide Parteien beleuchtet und es wird versucht, dem Vertrag eine Bedeutung für das Scheitern des Zuges zuzuschreiben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Quellenkritik
3. Der Konstanzer Vertrag
3.1. Historische Einordnung und Inhalt des Vertrags
3.2. Problematik des Konstanzer Vertrags
3.2.1. Originalfassung
3.2.2. Der Konstanzer Vertrag als Einschränkung des Handlungsspielraums Friedrichs?
3.2.3. Die Erneuerung des Konstanzer Vertrags: eine Korrektur der alten Fehler?.
3.3. Ursachen des Italienzuges und Bedeutung des Vertrags
3.4. Nutzung der Spielräume des Vertrags und Scheitern des Italienzuges
4. Geldforderung und Krönung - pracht- und ehrenvolle Darstellung, aber nüchterne Realität
5. Spannungen zwischen Papst und König/Kaiser
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was war der Konstanzer Vertrag von 1153?
Ein Abkommen zwischen Friedrich I. Barbarossa und Papst Eugen III., das gegenseitige Unterstützung gegen Feinde (wie die Römer oder Normannen) zusicherte.
Warum scheiterte der erste Italienzug Barbarossas?
Das Scheitern lag an logistischen Problemen, Spannungen mit dem Papsttum und dem Widerstand der oberitalienischen Städte, die ihre Autonomie verteidigten.
Welche Spannungen gab es zwischen Papst und Kaiser?
Die Auslegung des Konstanzer Vertrags führte zu Konflikten über den Handlungsspielraum des Kaisers und die Vorrangstellung in der christlichen Welt.
Welche Rolle spielte die Kaiserkrönung?
Die Krönung war zwar prachtvoll inszeniert, konnte aber die „nüchterne Realität“ der politischen Machtkämpfe und der mangelnden militärischen Kontrolle in Italien nicht verdecken.
Wurde der Konstanzer Vertrag später erneuert?
Die Arbeit untersucht, ob spätere Erneuerungen des Vertrags als Versuche gewertet werden können, die ursprünglichen Fehler und Unklarheiten zu korrigieren.
- Quote paper
- Kevin Kohaus (Author), 2012, Das Scheitern des ersten Italienzugs Friedrich I. Barbarossas mit besonderem Hinblick auf den Konstanzer Vertrag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264742