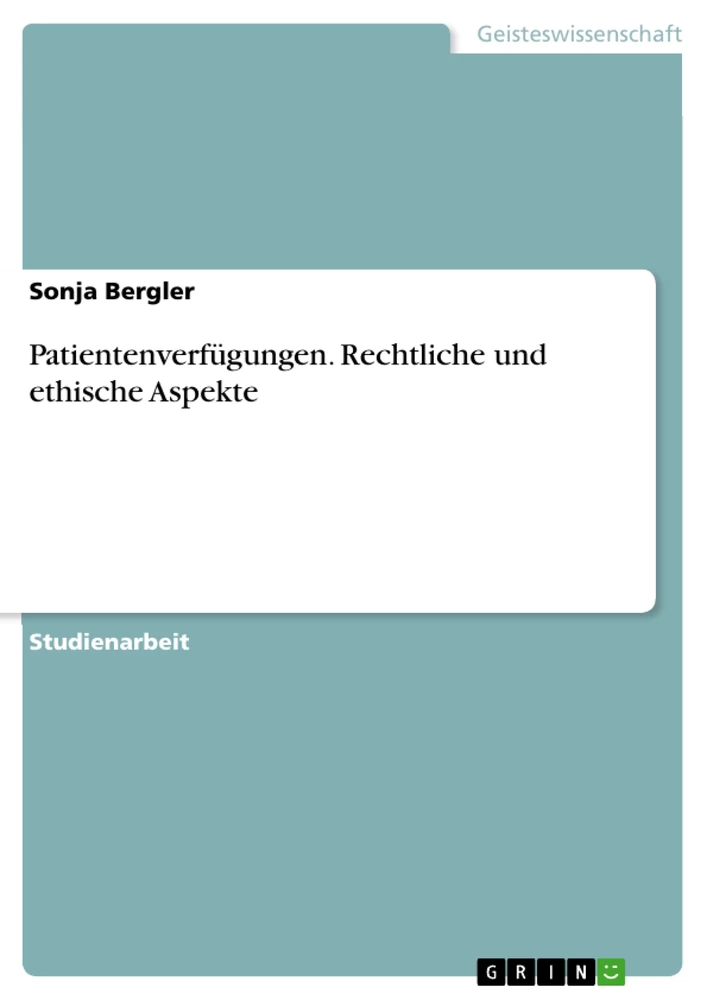Die moderne Medizin hat in den letzten fünf Jahrzehnten rapide medizinisch-technische Fortschritte gebracht, welche die Lebenserwartung und Lebensqualität vor allem älterer Menschen in den westlichen Ländern wesentlich steigerte. Jedoch hat diese Entwicklung auch ihre Kehrseite.
„Während diese Perspektive für viele Menschen Hoffnung und Chance bietet, haben andere Angst vor einer Leidens- und Sterbensverlängerung durch Apparatemedizin.“
Denn diese Apparatemedizin ermöglicht auch, den „Todeszeitpunkt um Jahre hinauszuschieben“ . Aber „die so gewonnene Lebenszeit wird nicht von jedem als Gewinn empfunden “. Denn die medizinischen Fortschritte ermöglichen nicht immer nur, dass Leid verringert wird, sondern können auch das „Siechtum um Jahre“ hinauszögern.
Durch die Entwicklung „An die Stelle des Problems der Scheintoten des 18. Jahrhunderts ist das des Schein-Lebendigen unseres Jahrhunderts getreten“ , kam in den siebziger Jahren die Diskussion darüber auf, ob Medizin immer alles darf was sie kann, sowie die Frage, ob die vorgenommenen medizinischen Maßnahmen überhaupt im Sinne des Patienten sind.
„Man wollte für einen natürlichen Tod und gegen Lebensverlängerung um jeden Preis vorsorgen.“
Diese Entwicklung bedingte die Angst vieler, von Krankheiten betroffen zu sein, durch welche die Meinungsbildung oder Äußerung eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr möglich ist. Denn die Menschen möchten über die sie betreffenden medizinischen Maßnahmen selbst mitbestimmen. Damit verbunden ist die Angst vor Entmündigung und Fremdbestimmung, welche nicht der eigenen Meinung, den Werten und Ansichten entspricht.
Um die Selbstbestimmung auch dann noch zu sichern, wenn man seinen Willen selbst nicht mehr bilden oder äußern kann, ist es wichtig, sich frühzeitig Gedanken über die persönlichen Werte und Einstellungen bezüglich lebensverlängernder Maßnahmen zu machen. In Deutschland hat jeder Mensch im Rahmen einer Patientenverfügung das „Recht für sich zu entscheiden, ob und welche medizinischen Maßnahmen für ihn ergriffen werden.“
Diese Patientenverfügung wird im Folgenden hinsichtlich ihrer rechtlichen und ethischen Aspekte betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeicnnis
- Patientenvertügung zum Selbstschutz des Patienten
- Aspekte der Patientenvertügung
- Definition der Patientenvertügung
- Allgemeines zur Patientenvertügung
- Ärztliche Beratung
- Adressaten
- Bestandteile
- Rechtliche Aspekte der Patientenvertügung
- Gültigkeit und Aktualisierung
- Reichweite
- Benandlung nach Indikation
- Rechtfertigungspflicnt
- Hierarchie der Willenstormem
- Bereuungsvertügung und Vorsorgevollmacnt
- Ethische Aspekte der Patientenvertügung
- Konfliktpotential
- Würde des Menschen
- Autonomie und Selbstbestimmung
- Ethik der Führsorge
- Kritik an unbeschränkter Reichweite
- Schluss/ Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit dem Thema der Patientenverfügung, einem rechtlichen und ethischen Instrument, das es Patienten ermöglicht, im Voraus Entscheidungen über medizinische Maßnahmen zu treffen, falls sie später nicht mehr in der Lage sind, ihren Willen zu äußern.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Patientenverfügung
- Ethische Aspekte der Patientenverfügung
- Konfliktpotential zwischen Patientenautonomie und Fürsorgeethik
- Kritik an der unbeschränkten Reichweite von Patientenverfügungen
- Die Bedeutung der Patientenverfügung für die Selbstbestimmung am Lebensende
Zusammenfassung der Kapitel
In Kapitel 2 wird die Notwendigkeit der Patientenverfügung im Kontext der medizinischen Fortschritte und der damit verbundenen Angst vor einer Leidens- und Sterbensverlängerung durch Apparatemedizin erläutert. Die zunehmende Bedeutung der Selbstbestimmung und die Angst vor Entmündigung und Fremdbestimmung werden als wichtige Beweggründe für die Erstellung einer Patientenverfügung dargestellt.
Kapitel 3 beleuchtet die rechtlichen und ethischen Aspekte der Patientenverfügung. Es wird die Definition der Patientenverfügung im Sinne des BGB erläutert und die Bedeutung der ärztlichen Beratung sowie die Adressaten der Verfügung dargestellt. Weiterhin werden die rechtlichen Voraussetzungen für die Gültigkeit und Aktualisierung einer Patientenverfügung sowie die Frage nach deren Reichweite und der Behandlung nach Indikation diskutiert. Schließlich werden die ethischen Prinzipien, die im Zusammenhang mit der Patientenverfügung eine Rolle spielen, wie die Würde des Menschen, die Autonomie und Selbstbestimmung sowie die Fürsorgeethik, erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Patientenverfügung, Selbstbestimmung, Autonomie, Fürsorgeethik, Rechtliche Rahmenbedingungen, Ethische Aspekte, Konfliktpotential, Lebensende, medizinische Maßnahmen, Einwilligung, Sterben in Würde, Apparatemedizin, Entmündigung, Fremdbestimmung, Indikationsstellung, Gültigkeit, Aktualisierung, Reichweite, Vorsorgevollmacht, Betreuungsvertügung, und das Spannungsverhältnis zwischen Patientenautonomie und Fürsorgeethik.
Häufig gestellte Fragen
Wozu dient eine Patientenverfügung?
Sie ermöglicht es Menschen, im Voraus über medizinische Maßnahmen zu entscheiden, falls sie später ihren Willen nicht mehr selbst bilden oder äußern können.
Wo liegt der ethische Konflikt bei Patientenverfügungen?
Es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen der Autonomie (Selbstbestimmung) des Patienten und der Fürsorgeethik der behandelnden Ärzte.
Welche rechtlichen Voraussetzungen gelten laut BGB?
Die Arbeit erläutert die Anforderungen an die Gültigkeit, Aktualisierung und Reichweite einer Verfügung sowie die Hierarchie der Willensformen.
Was ist der Unterschied zur Vorsorgevollmacht?
Während die Patientenverfügung konkrete medizinische Wünsche festlegt, benennt die Vorsorgevollmacht eine Person, die stellvertretend Entscheidungen treffen darf.
Warum wird die „unbeschränkte Reichweite“ kritisiert?
Kritiker hinterfragen, ob Patienten alle zukünftigen medizinischen Situationen und Fortschritte zum Zeitpunkt der Erstellung der Verfügung korrekt absehen können.
- Quote paper
- Sonja Bergler (Author), 2012, Patientenverfügungen. Rechtliche und ethische Aspekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264828