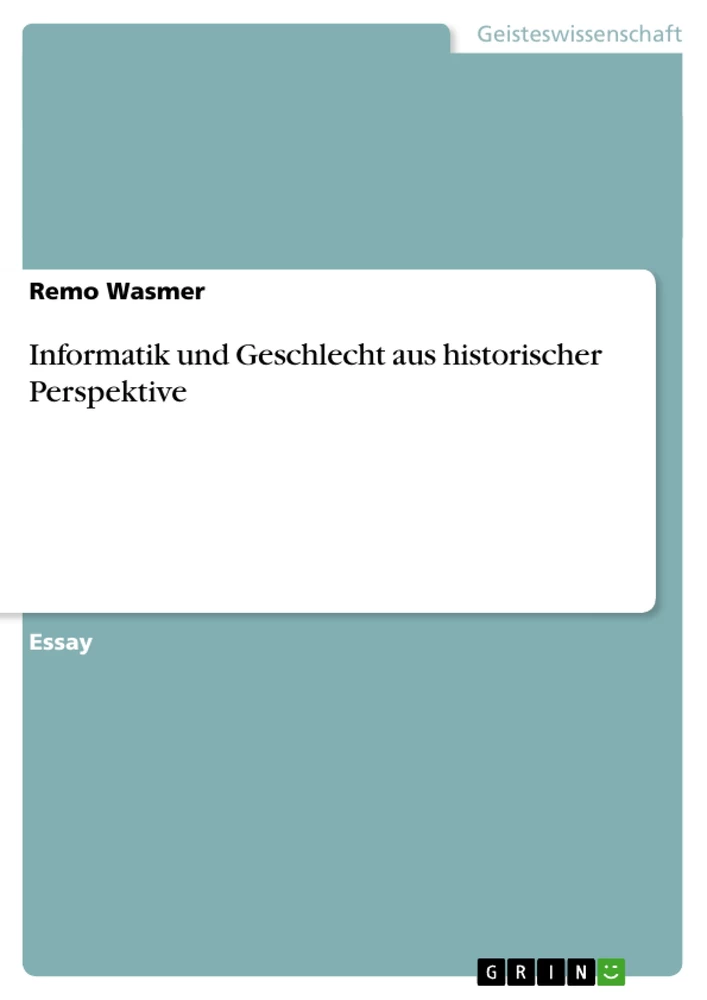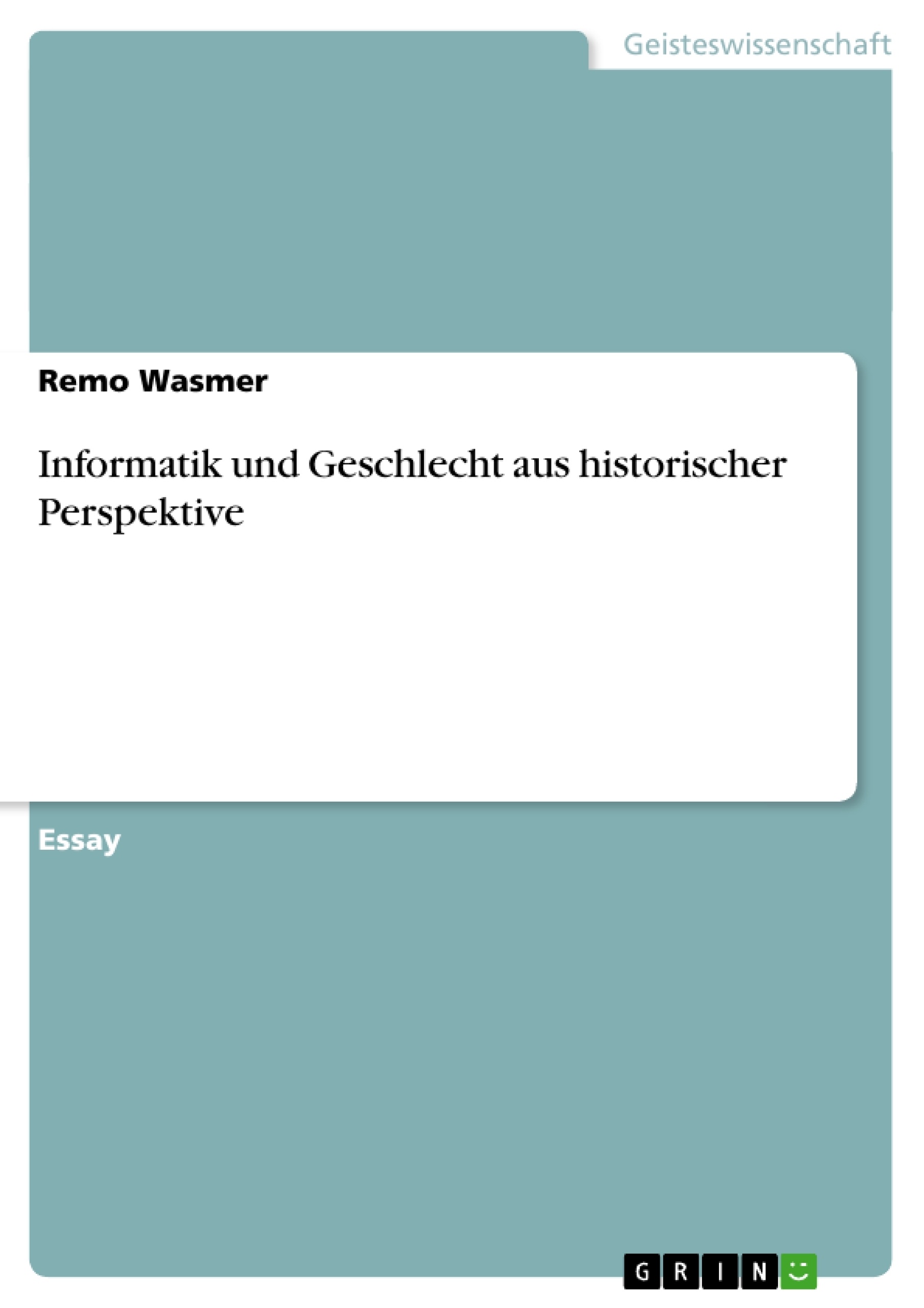Informatik wird gemeinhin als typische Männerdomäne wahrgenommen. Tatsächlich sind die Frauenanteile im IT-Bereich bei Lehrgängen und auf dem Arbeitsmarkt in westlichen Industrienationen ausserordentlich gering. Das war aber nicht immer so: vor vier Jahrzehnten waren hierzulande noch mehr als doppelt so oft Frauen in der Informatik beschäftigt. Aber auch in Werbungen für Produkte der elektronischen Datenverarbeitung waren Frauen auffallend präsenter als heute. Dieser Essay versucht zu ergründen, auf welche Weise und weshalb sich Genderverhältnisse in der Informatik historisch gewandelt haben.
Informatik wird gemeinhin als typische Männerdomäne wahrgenommen. Tatsächlich sind die Frauenanteile im IT-Bereich bei Lehrgängen und auf dem Arbeitsmarkt in westlichen Industrienationen ausserordentlich gering.1 Das war aber nicht immer so: vor vier Jahrzehnten waren hierzulande noch mehr als doppelt so oft Frauen in der Informatik beschäftigt.2 Aber auch in Werbungen für Produkte der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) waren Frauen auffallend präsenter als heute.
Dieser Essay versucht zu ergründen, auf welche Weise und weshalb sich Genderverhältnisse in der Informatik historisch gewandelt haben.
In einem ersten Teil werde ich die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der EDV- Branche seit den 1950er-Jahren bis zur Verbreitung der Mikrocomputer (Desktop-Rech- ner, Heimcomputer) in den 1970er-Jahren darlegen. In dieser Zeit existierte EDV vor al- lem im kommerziellen oder staatlichen und militärischen Umfeld. Die Informatik war in dieser Phase zwar von schnellen technischen Fortschritten geprägt, deren Fachkultur könnte sich demgegenüber aber dennoch nur begrenzt und langsam gewandelt haben, weil sich - in Bezug auf die EDV - das kommerzielle Umfeld, die Arbeitsabläufe und Einsatzgebiete nicht fundamental veränderten. Auch schon in der Vorläufer- und Pio- nierzeit des maschinellen Rechnens Ende des 19. Jh. und bis zur Mitte des 20. Jh. voll- brachten einige Frauen wegweisende Leistungen,3 die hier aber nicht weiter behandelt werden, weil grössere Diskontinuitäten zwischen der staatlich-wissenschaftlichen Ni- schendisziplin vor den 1950er-Jahren und der kommerzialisierten EDV bestanden.
Mit den Mikrocomputern ab den 1970er-Jahren erschloss der Informationstechnik- Markt auf breiter Front zunehmend auch den privaten Alltag. Er ist seither von einer enormen Dynamik und Heterogenisierung erfasst, die bis zur Gegenwart ungebremst fortläuft. Es kam zu einer schubartigen Professionalisierung des Arbeitsumfelds in der IT-Branche.
Im Zentrum meiner Betrachtung steht die Interpretation der stark eingebrochenen Frau- enanteile in der Informatik in den 1970er und 1980er-Jahren. Meine These lautet, dass dieser Prozess weniger auf einen Wandel in der inneren Fachkultur oder in der äusseren genderbezogenen Wahrnehmung der Informatik zurückzuführen war als auf das grund- legend veränderte Arbeitsumfeld seit den technischen Umwälzungen in dieser Zeit: Die Mehrzahl der Frauen im frühen EDV-Umfeld verrichtete nämlich vor allem - später in diesem Bereich gar nicht mehr erforderliche - Arbeiten, die sich auch als 'typische Frau - enberufe' deuten liessen (Assistenz arbeiten; „Sekretärin“). Daher brauchte das (wissen- schaftliche, wirtschaftliche) Umfeld die typischen geschlechterspezifischen Konnotatio- nen, die auch zu Segregationen im Berufsmarkt führen, gar nicht zu überdenken - und zwar, obwohl die Frauen in einer mathematisch-logischen Domäne tätig waren, was den ihnen üblicherweise zugeschriebenen Kompetenzen eigentlich widersprochen hätte.
Eine dritte bedeutende Phase in der Geschichte der Informationstechnologie ist vermut- lich mit der Verbreitung des Internets seit Mitte der 1990er-Jahre angebrochen. Die ge- nauen Einflüsse der jüngeren Entwicklungen in der Informationstechnologie auf die ge- sellschaftliche Alltagskultur sind aber immer noch sehr schwer zu erfassen. Diese jünge- ren und die gegenwärtigen Prozesse stehen wegen ihrer weitreichenden und komplexen gesellschaftlichen Relevanz (Stichworte digitale Kommunikation, Soziale Netzwerke, E-Government, Onlinehandel, Wikipedia, ...) nicht mehr im Fokus meiner Betrachtun- gen.
Genderverhältnisse in der Informatik bis in die 1970er-Jahre
Während des Zweiten WELTKRIEGS und erneut ab den 1950er-Jahren wurden zur De- ckung eines neuen, massiven Personalbedarfs in der Datenverarbeitung gezielt Frauen rekrutiert,4 die oft die grosse Mehrzahl des Personals an Rechenzentren stellten. Sie ver- richteten typischerweise Arbeiten mit Routinecharakter, wie das Stanzen und Überprü- fen von Lochkarten, Programmieren5 oder das Umstecken von Verbindungen.
Solche Stellen waren typischerweise schlecht bezahlt, wiesen eine hohe Personalfluk- tuation auf und boten nur wenige Aufstiegsmöglichkeiten.6 Die Arbeitsschritte waren oft möglichst spezifisch aufgegliedert, so dass der Bedarf nach Arbeitskräften auch durch Angelernte gedeckt werden konnte,7 was nötig war, weil spezifische Ausbildungswege für die Informatik in den 60er-Jahren erst im Aufbau begriffen waren8. Das beschriebene Arbeitsumfeld war damit auch kompatibel mit dem damals vorherrschenden Geschlech- terbild, das von Frauen keine Karriere erwartete.9 Solche Berufe, etwa jener der „Daten- typist in “, konnten in eine ähnliche narrative Tradition gereiht werden wie etwa „die Te- lefonist in “ oder „die Sekretär in “, mit dem Hintergrund der Feminisierung der Schreib- und Rechnerarbeit um 190010 .
Einige dieser Tätigkeiten dürften in der Realität logisch-mathematisch vergleichsweise anspruchsvoll gewesen sein. Es scheint aber, dass dieser Aspekt vom fachlichen und ge- sellschaftlichen Umfeld nicht explizit wahrgenommen wurde, weil er mit den damaligen Geschlechterbildern schlecht zu erklären war. Stattdessen wurden solche Stellen in der Öffentlichkeit als typisch und traditionell weiblich legitimiert, denn sie verlangten etwa „[...]lots of patience, persistence and a capacity for detail and those are traits that many girls have.“11 Mit solchen Auslegungen wurden etablierte Rollenbilder bestätigt (Frauen = geduldig, beharrlich und sorgfältig).
Auf den hierarchisch höheren Betriebsebenen, im Management, aber auch in der Sys- temadministration und in der Entwicklung der Computer selbst waren vor allem Männer beschäftigt. Diese Bereiche, die eine gezielte höhere berufliche Ausbildung erforderten, blieben für Frauen schwer zugänglich. Die gesellschaftlichen Erwartungen verlangten ein Engagement der Frauen für die Familie, weshalb viele von einer höheren Ausbil- dung und von einer Karriere absahen. Frauen waren in diesem als männlich wahrge- nommenen Feld mit Vorurteilen konfrontiert und die Manager zögerten, Personal einzu- gleichen Schema aufgebaut waren. Das Erstellen solchen Maschinencodes erforderte logisches Den - ken und gute Konzentrationsfähigkeit, war aber auch Übungssache.
[...]
1 In den meisten Ländern liegen die Frauenanteile in IT-Berufen zwischen 10 und 20%, mit gering stei- gender Tendenz in den letzten Jahren. Anteile von bedeutend über 20% und bis zu über 50% errei - chen fast ausschliesslich wenige Staaten Asiens und Afrikas. Schweiz 2001: 11.4%; GALPIN 2002.
2 SCHINZEL 2004. Widerspruchsfreie Trends in höherer zeitlicher Auflösung sind für die Zeit vor 1990 allerdings nur schwer auszumachen, weil breit abgestützte und differenzierte Daten über längere Zeiträume kaum vorhanden und verschiedene nationale Erhebungen nur begrenzt vergleichbar sind.
3 Vgl. etwa GÜRER 1995.
4 OECHTERING 2001a.
5 Die Implementierung von Aufgaben in Programmcode konnte je nach Kontext durchaus - wie heute - kreative, komplexe und singuläre Lösungswege erfordern. In der alltäglichen Geschäftspraxis war Programmierung aber oft auch eine Routinearbeit. Denn bei vielen frühen Rechnersystemen waren grössere Redundanzen unvermeidlich. Beispielsweise mussten nur leicht voneinander abweichende Arbeitsabläufe oft in eigenen, getrennten Programmen umgesetzt werden, die aber immer nach dem
6 HICKS 2010, S. 2.
7 OECHTERING 2001a.
8 OECHTERING 2001b.
9 GÜRER 1995, S. 53.
10 VOLKENING 2012, S. 208.
11 SELIGSOHN, I.J. (1967): Your Carreer in Computer Programming, zit. bei GÜRER 1995, S. 47.
Häufig gestellte Fragen
War Informatik schon immer eine Männerdomäne?
Nein, in den 1950er und 60er Jahren war der Frauenanteil in Rechenzentren deutlich höher als heute, oft stellten Frauen sogar die Mehrheit des Personals.
Warum sank der Frauenanteil in der Informatik ab den 1970er Jahren?
Dies lag primär an der Professionalisierung und dem Wandel des Arbeitsumfelds. Frühere "Frauenaufgaben" wie das Stanzen von Lochkarten fielen weg, während höhere Positionen männlich dominiert blieben.
Welche Tätigkeiten verrichteten Frauen in der frühen EDV?
Frauen arbeiteten oft als Datentypistinnen, programmierten im Sinne von Routine-Code-Erstellung oder bedienten Hardware wie Lochkartenmischer.
Wie wurden IT-Berufe für Frauen in der Öffentlichkeit legitimiert?
Sie wurden oft als Berufe dargestellt, die Geduld, Sorgfalt und Detailgenauigkeit erfordern – Eigenschaften, die man damals primär Frauen zuschrieb.
Welchen Einfluss hatten Mikrocomputer auf die Genderverhältnisse?
Mit der Verbreitung von Heimcomputern in den 1970ern und 80ern wandelte sich die Fachkultur und das Arbeitsumfeld massiv, was zu einer stärkeren Segregation führte.
- Citation du texte
- Remo Wasmer (Auteur), 2013, Informatik und Geschlecht aus historischer Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264917