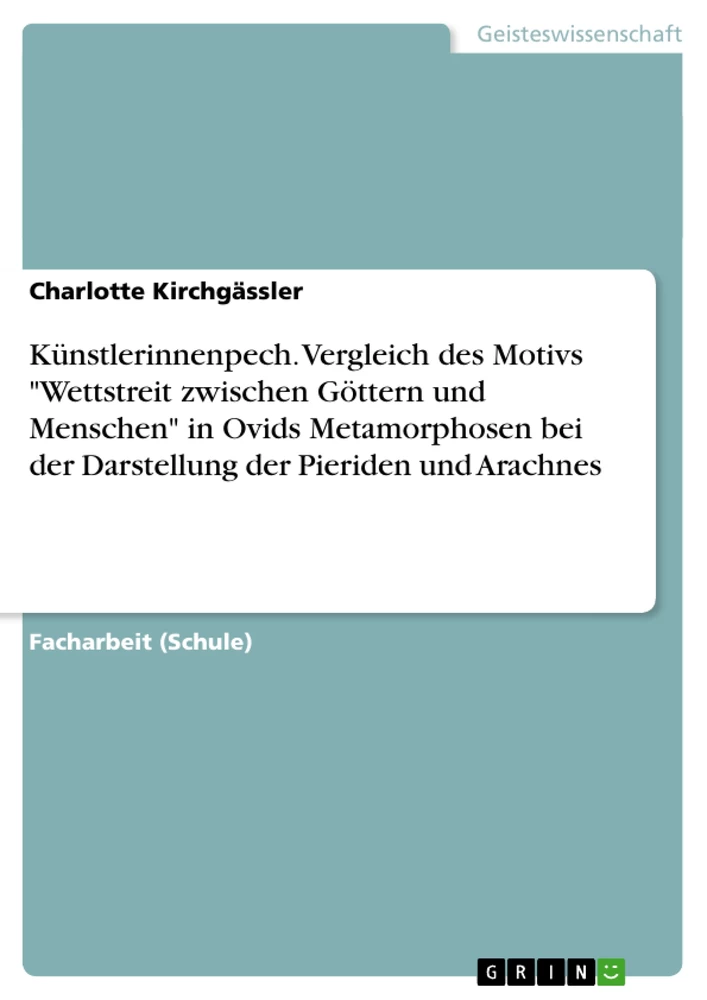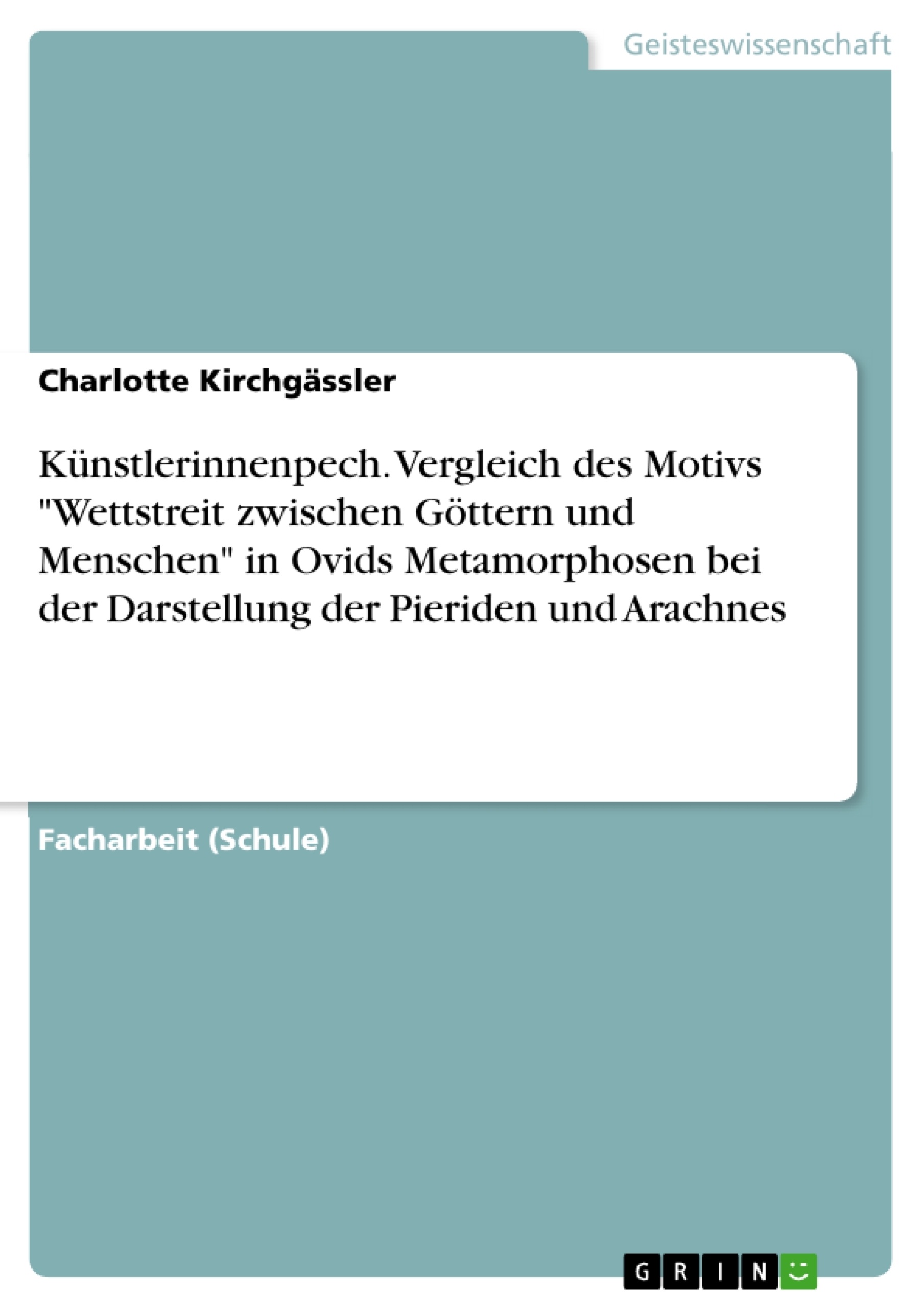Stärke und Macht, Genialität und Brillanz, Unfehlbarkeit und Unsterblichkeit, gar absolutes Wissen und absolute Freiheit – verborgen im Inneren eines jeden Menschen schlummert eine tief sitzende Begierde nach diesen Eigenschaften. Doch wo lässt sich das alles in seiner vollkommenen Entfaltung aufspüren?
Man wird schnell fündig: in sämtlichen Religionen der Menschheitsgeschichte werden und wurden transzendente, uns Irdischen übergeordnete Wesen verehrt, ausgestattet mit einem „Konzentrat“ all jener Charakteristika: Götter. Welches Wagnis muss ein seinen innersten Trieben folgender Sterblicher demzufolge eingehen, um seine ureigensten Traumziele greifbar werden zu lassen? – Ein Kräftemessen mit eben jenen „Idolen“, um dabei die eigene Ebenbürtigkeit, wenn nicht gar Überlegenheit zu beweisen.
Aus diesem Grund ist das Motiv „Wettstreit zwischen Göttern und Menschen“ im Verständigungsmittel der Menschen schlechthin, der gesprochenen und geschriebenen Sprache, durch alle Zeitalter hindurch weitertradiert. Dabei erschafft die die Epochen beeinflussende Literatur die verschiedensten Situationen: In der Bibel kostet Eva vom Baum der Erkenntnis, um die von der Schlange in Aussicht gestellte Gottgleichheit zu erlangen und so ihr Leben selbst in die Hand nehmen zu können.Die alten Babylonier streben ebenfalls nach einer solchen Ebenbürtigkeit, um mit ihrem „Turmbau zu Babel“ zu Ruhm zu gelangen. Auch Goethe thematisiert dieses Phänomen: Als sein Faust an die Grenzen der menschlichen Erkenntnis stößt, beschwört er den Erdgeist, um transzendentale Erleuchtung zu erfahren, ja den Status göttlicher Vollkommenheit zu erreichen. In derselben Situation empfindet er eine unglaubliche Nähe zu dem weltimmanenten, unbegreifbaren Wesen, bezeichnet sich gar als „Ebenbild Gottes“ (V. 516).
Doch was verbindet die diversen Versionen dieses Motivs, in denen wir auf nach Gottgleichheit und Vollkommenheit strebende Irdische treffen? Gerade in Fausts Selbsteinschätzung offenbart sich der vereinende Kernpunkt: ein gigantisches Selbstvertrauen, das zu Übermut, ja Hochmut verleitet. Es drängt sich in diesem Zusammenhang regel-recht das Sprichwort „Hochmut kommt vor dem Fall“ auf.
Denn wie soll ein „Homo sapiens“ etwas, das er mit seinem menschlichen Verstand nicht einmal begreifen kann, besiegen können? Bereits in der griechischen Ethik entwickelte sich für dieses Schicksalskonzept ein Begriff: Hybris. Diesem Urthema humaner Existenz setzt Ovid anhand beider Metamorphosen ein Denkmal.
Inhaltsverzeichnis
- Wettstreit zwischen Göttern und Menschen - ein triebgesteuertes Wagnis?
- Hybris
- Inhaltlicher Vergleich beider Stellen in Ovids Metamorphosen
- Herkunft und Begabung
- Die Herausforderung zum Wettkampf
- Auslöser und Ziel
- Die Aufforderung zum Wettstreit
- Die Reaktion der Götter auf die Herausforderung
- Fazit
- Der Wettstreit
- Der Wettkampfantritt
- Vergleich des Pieridenliedes mit Arachnes Teppich
- Vergleich der Teppiche (von Arachne und Minerva)
- Pieriden und Minerva im Vergleich
- Kollision unterschiedlicher Welten
- Wettstreit als Konfrontation verschiedener Gesellschaftsklassen
- Die Qualität der „Kunstwerke“
- Die Reaktionen
- Die Reaktion der Pieriden
- Die Reaktion der Minerva im Vergleich zu den Pieriden
- Die Reaktion der Arachne im Vergleich zu den Pieriden
- Die Verwandlung
- Die Auslöser der Verwandlung
- Die Ankündigung der Bestrafung
- Die Ausübung göttlicher Macht (aus heutiger Sicht)
- Parallelen im Verhalten der Musen zu Arachne
- Die Verwandlung der Pieriden im Vergleich zu Arachnes Verwandlung
- Bedeutung von Spinne und Elster gemäß moderner Symbolik
- Untersuchung der narrativen Ebene
- Die Position Ovids
- Die Rolle wörtlicher Rede
- Klarheit des Ausgangs
- Andeutungen auf den Ausgang bei den Pieriden
- Andeutungen auf den Ausgang bei Arachne
- Die Absicht Ovids
- Wiederholung sprachlicher Besonderheiten in beiden Mythen
- Parallelen im Satzbau und Wortwahl unter Beachtung der Hybris
- Die Bestrafung: das unheilvolle Schicksal
- Frevelhaftigkeit
- Die Vermessenheit der Herausforderung
- Nemesis: Verwandlung als Verdichtung des typischen Charakterzugs
- Ziel: „nur“ eigener Sieg oder zusätzlich Unterwerfung anderer?
- Ambivalente Formulierungen
- Absicht und Ergebnis der Hybris
- Götterverachtung
- Die Überlegenheit der Götter
- Lautmalereien
- Belege für Hybris durch Betrachtung von Sprache und Stilmitteln
- „Übergroßes Sicherheitsgefühl“ - „übermütiges Vertrauen auf die eigene Kraft“
- „Überschreitung der dem Menschen gesetzten Grenzen“ durch Provokation
- Gesamtfazit zur unterschiedlichen Bearbeitung der Hybris
- „Überschreitung der dem Menschen gesetzten Grenzen“
- „Verachtung und Lästerung der Götter“
- Individuelle Gründe für Hybris
- Der grundsätzliche Unterschied
- Nemesis
- Das Ergebnis der Wettkämpfe und der Hybris
- Hybris in der Antike - Hybris heute: Von der Unterwerfung der Götter zur Bezwingung der Natur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wettstreit zwischen Göttern und Menschen in Ovids Metamorphosen, insbesondere anhand der Mythen der Pieriden und Arachne. Ziel ist es, die unterschiedliche Darstellung der Hybris in beiden Erzählungen zu analysieren und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede herauszuarbeiten. Die Arbeit beleuchtet die narrative Ebene, sprachliche Besonderheiten und die Bedeutung der Hybris sowohl in der Antike als auch in der modernen Welt.
- Die Darstellung der Hybris in den Mythen der Pieriden und Arachne
- Analyse der narrativen Struktur und Ovids Positionierung
- Vergleich der sprachlichen Mittel und Stilfiguren
- Die Bedeutung von Wettstreit als Konfrontation unterschiedlicher Gesellschaftsklassen
- Die Aktualität des Hybris-Motivs in der Antike und Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Wettstreit zwischen Göttern und Menschen - ein triebgesteuertes Wagnis?: Der einleitende Abschnitt etabliert das zentrale Thema des Textes: den menschlichen Wunsch nach Göttlichkeit und die daraus resultierende Hybris, die in Wettkämpfen mit göttlichen Wesen zum Ausdruck kommt. Anhand von Beispielen aus der Bibel, der babylonischen Mythologie und Goethes Faust wird die universale und zeitlose Relevanz dieses Motivs unterstrichen. Die Arbeit wird auf Ovids Metamorphosen fokussieren und den Begriff Hybris definieren, um die verschiedenen Erzählungen zu analysieren.
Hybris: Dieses Kapitel liefert eine Definition des Begriffs Hybris aus antiker Sicht und legt die Grundlage für die anschließende Analyse der Mythen. Es dient als theoretischer Rahmen, um die Handlungen der Protagonisten in den folgenden Kapiteln zu interpretieren und zu verstehen.
Inhaltlicher Vergleich beider Stellen in Ovids Metamorphosen: Dieses Kapitel vergleicht die Mythen der Pieriden und Arachne im Detail. Es analysiert die jeweilige Herkunft und Begabung der Figuren, den Auslöser und Verlauf des Wettkampfes, die Reaktionen der Götter und der Protagonisten und schließlich die Verwandlungen als Folge der Hybris. Der Vergleich soll Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Darstellung der Hybris aufzeigen.
Untersuchung der narrativen Ebene: Dieser Abschnitt untersucht Ovids Rolle als Erzähler, die Funktion wörtlicher Rede und die Frage nach der Klarheit des Ausgangs der beiden Mythen. Analysiert werden Andeutungen auf den Ausgang, die bereits im Verlauf der Erzählung gegeben werden. Ziel ist es, Ovids Absicht und seinen Umgang mit der Erzählperspektive zu verstehen.
Wiederholung sprachlicher Besonderheiten in beiden Mythen: Hier werden Parallelen im Satzbau, der Wortwahl und dem Einsatz von Stilmitteln in Bezug auf die Hybris untersucht. Ambivalente Formulierungen und Lautmalereien werden analysiert, um die sprachliche Gestaltung der Hybris und ihrer Konsequenzen zu beleuchten.
Gesamtfazit zur unterschiedlichen Bearbeitung der Hybris: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der vorherigen Analysen zusammen und vergleicht die verschiedenen Aspekte der Hybris-Darstellung in beiden Mythen. Es werden die „Überschreitung der dem Menschen gesetzten Grenzen“, die „Verachtung und Lästerung der Götter“, individuelle Gründe für Hybris, der grundsätzliche Unterschied zwischen den beiden Erzählungen, sowie Nemesis und die Ergebnisse der Wettkämpfe diskutiert.
Schlüsselwörter
Hybris, Ovid, Metamorphosen, Pieriden, Arachne, Wettstreit, Götter, Menschen, Mythos, Narrative Ebene, Sprachliche Analyse, Stilmittel, Antike, Moderne, Selbstüberschätzung, Strafe, Verwandlung, Nemesis.
Häufig gestellte Fragen zu "Wettstreit zwischen Göttern und Menschen in Ovids Metamorphosen"
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert den Wettstreit zwischen Göttern und Menschen in Ovids Metamorphosen, insbesondere anhand der Mythen der Pieriden und Arachne. Der Fokus liegt auf der unterschiedlichen Darstellung von Hybris in beiden Erzählungen und der Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Welche Aspekte werden im Detail untersucht?
Die Analyse umfasst die narrative Ebene, sprachliche Besonderheiten (Satzbau, Wortwahl, Stilmittel wie Lautmalereien und ambivalente Formulierungen), die Bedeutung von Hybris in der Antike und ihre Aktualität in der modernen Welt. Es wird ein Vergleich der Herkunft und Begabung der Figuren, des Auslösers und Verlaufs der Wettkämpfe, der Reaktionen der Beteiligten und der daraus resultierenden Verwandlungen vorgenommen.
Wie wird Hybris definiert und behandelt?
Die Arbeit liefert eine Definition von Hybris aus antiker Sicht und verwendet diese als theoretischen Rahmen zur Interpretation der Handlungen der Protagonisten. Es werden verschiedene Facetten der Hybris beleuchtet, wie z.B. die "Überschreitung der dem Menschen gesetzten Grenzen", die "Verachtung und Lästerung der Götter" und die individuellen Gründe für Hybris.
Welche Mythen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht detailliert die Mythen der Pieriden und Arachne aus Ovids Metamorphosen. Der Vergleich umfasst den Wettkampfantritt, die Qualität der "Kunstwerke" (Lied der Pieriden vs. Teppich der Arachne), die Reaktionen der Götter (Minerva) und der Protagonisten, sowie die Bedeutung der Verwandlungen als Strafe.
Welche Rolle spielt Ovid als Erzähler?
Die Arbeit untersucht Ovids Positionierung als Erzähler, die Funktion wörtlicher Rede und die Frage nach der Klarheit des Ausgangs der Mythen. Es werden Andeutungen auf den Ausgang analysiert, um Ovids Absicht und seinen Umgang mit der Erzählperspektive zu verstehen.
Welche sprachlichen Besonderheiten werden analysiert?
Die Analyse umfasst Parallelen im Satzbau und der Wortwahl, den Einsatz von Stilmitteln im Zusammenhang mit der Hybris (z.B. Lautmalereien, ambivalente Formulierungen), um die sprachliche Gestaltung der Hybris und ihrer Konsequenzen zu beleuchten. Der Fokus liegt auf der Darstellung von "Übergroßem Sicherheitsgefühl", "übermütigem Vertrauen auf die eigene Kraft" und der "Überschreitung der dem Menschen gesetzten Grenzen".
Wie wird das Thema Hybris in der Antike und Moderne gegenübergestellt?
Die Arbeit untersucht die Aktualität des Hybris-Motivs und vergleicht die Unterwerfung der Götter in der Antike mit der Bezwingung der Natur in der Moderne. Der Vergleich soll die zeitlose Relevanz des Themas aufzeigen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse der Analysen zusammen und vergleicht die verschiedenen Aspekte der Hybris-Darstellung in beiden Mythen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet, die Bedeutung von Nemesis diskutiert und die Ergebnisse der Wettkämpfe im Kontext der Hybris interpretiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Hybris, Ovid, Metamorphosen, Pieriden, Arachne, Wettstreit, Götter, Menschen, Mythos, Narrative Ebene, Sprachliche Analyse, Stilmittel, Antike, Moderne, Selbstüberschätzung, Strafe, Verwandlung, Nemesis.
- Arbeit zitieren
- Charlotte Kirchgässler (Autor:in), 2012, Künstlerinnenpech. Vergleich des Motivs "Wettstreit zwischen Göttern und Menschen" in Ovids Metamorphosen bei der Darstellung der Pieriden und Arachnes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265031