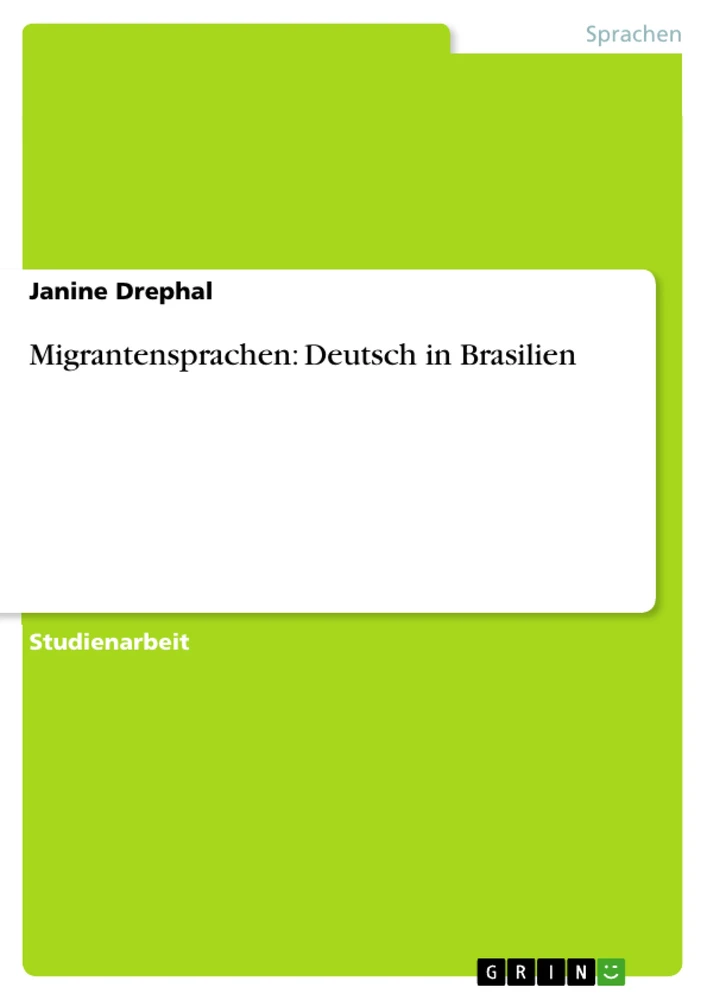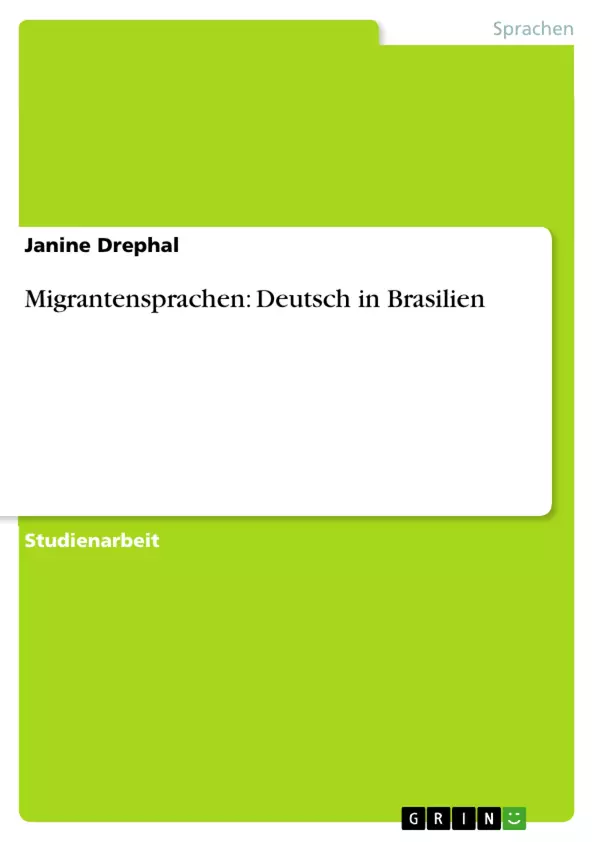Mit dieser Hausarbeit möchte ich zunächst die wesentlichen Faktoren darstellen, die zu den
Massenauswanderungen nach Brasilien im 19. Jahrhundert geführt haben. Denn nicht nur die
Entwicklung in Deutschland, sondern auch die wirtschaftliche Modernisierung in Brasilien
spielte eine entscheidende Rolle für die Auswanderungswellen. Die Arbeit soll einen
Überblick über die verschiedenen Aspekte der deutschen Auswanderung nach Brasilien, die
geschichtlichen Fakten, Faktoren, die zur Entstehung des Riograndenser Hunsrückisch führten
und Sprachkontaktphänomene,u.a. geben. Der geschichtliche Aspekt ist hierbei sehr wichtig
in Bezug auf den Sprachkontakt zwischen deutschen Einwanderern und portugiesischen
Bewohnern, denn wichtige Ereignisse im 20. Jahrhundert (u.a. die Weltkriege,
Industrialisierung) wirkten sich entscheidend auf den Sprachkontakt aus. Dies möchte ich
dann unter dem Aspekt der Soziolinguistik betrachten. Ich werde das in mehrere Abschnitte
unterteilen und auf die anfängliche Isolierung, danach auf das Verbot der deutschen Sprache
in Folge des Weltkriegs und die folgende Akkulturation eingehen. Hierzu habe ich mir die
Frage gestellt, ob das Verbot der deutschen Sprache wirklich so entscheidend war für den
deutsch-portugiesischen Sprachkontakt und ob die Einwanderer danach entscheidend beim
Lernen der portugiesischen Sprache gefördert wurden, oder ob es noch andere zu betrachtende
Aspekte gibt. Meine Erwartung diesbezüglich ist, dass zwar eine gewisse Änderung
eingetreten ist, die Nationalisierungsgesetze aber nicht alleine für die Entstehung von
Sprachmischung und Sprachkontakt verantwortlich sind. Ich denke, dass vor allem die neuen
Medien diesen Sprachkontakt entscheidend förderten.
Interessant ist es hierbei auch den Sprachgebrauch in der Öffentlichkeit und in der Familie
gegenüberstellend zu betrachten, was ich in Kapitel 4 näher erläutern möchte.
Des Weiteren möchte ich den deutsch-portugiesischen Sprachkontakt besonders am Beispiel
des Riograndenser Hunsrückisch darstellen, wobei ich mich unter anderem auf die Literatur
von ‚Cleo Vilson Altenhofen: Hunsrükisch in Rio Grande do Sul’ beziehe, da dieser den
Begriff „Riograndenser Hunsrückisch“ erstmals einführte. Der Sprachkontakt lässt sich sehr
gut an verschiedenen Sprachkontaktphänomenen aus den Bereichen Morphologie, Syntax und
Phonologie festlegen und durch sprachliche Beispiele verdeutlichen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext/ Migrantengeschichte
- Situation in Deutschland
- Situation in Brasilien
- Verlauf der Einwanderungen nach Brasilien im 19. Jahrhundert
- Sprachkontakt/Soziolinguistik
- Isolierung der deutschen Kolonien und ihre Folgen
- Verbot der deutschen Sprache und die Folgen
- Sprachliche Entwicklungen
- Sprachgebrauch und Sprachkompetenz der Deutschstämmigen
- Riograndenser Hunsrückisch
- Sprachkontaktphänomene und sprachliche Beispiele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Massenauswanderung von Deutschen nach Brasilien im 19. Jahrhundert, die Faktoren, die dazu führten, und die daraus resultierenden sprachlichen Entwicklungen, insbesondere die Entstehung des Riograndenser Hunsrückisch. Die Arbeit beleuchtet den historischen Kontext, die soziolinguistischen Aspekte des deutsch-portugiesischen Sprachkontakts und analysiert den Einfluss von Ereignissen wie dem Verbot der deutschen Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Sprachmischung und -entwicklung.
- Die Ursachen der deutschen Massenauswanderung nach Brasilien im 19. Jahrhundert.
- Die soziolinguistischen Auswirkungen der deutschen Einwanderung auf Brasilien.
- Die Entwicklung des Riograndenser Hunsrückisch als Beispiel für Sprachkontaktphänomene.
- Der Einfluss von politischen Ereignissen auf den Sprachkontakt.
- Der Vergleich des Sprachgebrauchs in der Öffentlichkeit und in der Familie.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die Ziele der Arbeit: die Darstellung der Hauptfaktoren der Massenauswanderung nach Brasilien im 19. Jahrhundert, unter Berücksichtigung der Situation in Deutschland und Brasilien, sowie einen Überblick über die deutsche Auswanderung nach Brasilien, die geschichtlichen Fakten und die Entstehung des Riograndenser Hunsrückisch. Es wird die Bedeutung des historischen Kontextes für den Sprachkontakt zwischen deutschen Einwanderern und portugiesischen Bewohnern hervorgehoben, insbesondere die Auswirkungen von Ereignissen wie den Weltkriegen und der Industrialisierung. Die Arbeit untersucht die Frage, ob das Verbot der deutschen Sprache entscheidend für den deutsch-portugiesischen Sprachkontakt war und ob die Einwanderer danach beim Erlernen des Portugiesischen gefördert wurden. Die Autorin stellt die Hypothese auf, dass die neuen Medien den Sprachkontakt entscheidend förderten und plant, den Sprachgebrauch in der Öffentlichkeit und in der Familie gegenüberzustellen.
Historischer Kontext / Migrantengeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Faktoren, die die Migration nach Brasilien im 19. Jahrhundert förderten. Es beschreibt den "Push- und Pull-Effekt": negative Bedingungen in Deutschland (sozioökonomischer Wandel, Bevölkerungswachstum, Missernten, Industrialisierung) und positive Bedingungen in Brasilien (Aufhebung des Kolonialstatus, Ende der Sklaverei, Bedarf an Arbeitskräften in der aufstrebenden Kaffee-Wirtschaft). Das Kapitel erwähnt das 180-jährige Jubiläum der deutschen Auswanderung nach Brasilien (2004) und skizziert den Verlauf der Einwanderungswellen, beginnend mit den ersten deutschen Einwanderern im 16. Jahrhundert bis hin zur Gründung von Kolonien wie Nova Friburgo und der daraus resultierenden Herausbildung einer eigenen deutschsprachigen Identität.
Sprachkontakt / Soziolinguistik: Dieses Kapitel behandelt den Sprachkontakt zwischen den deutschen Einwanderern und der portugiesischsprachigen Bevölkerung Brasiliens. Die anfängliche Isolation der deutschen Kolonien führte zu eingeschränkten Portugiesischkenntnissen. Der Abschnitt beleuchtet die Faktoren, die zur zunehmenden Bedeutung des Portugiesischen führten, wie das Deutschverbot nach dem Zweiten Weltkrieg und die Entwicklung neuer Medien. Es wird insbesondere auf die Entstehung und die Merkmale des Riograndenser Hunsrückisch eingegangen, als Beispiel für Sprachkontaktphänomene. Es wird die Hypothese aufgestellt, dass sich das Riograndenser Hunsrückisch nicht allein aus dem Kontakt mit dem Portugiesischen gebildet hat, was in der Schlussbetrachtung weiter erläutert werden soll. Das Kapitel beschreibt die sprachliche Entwicklung in Familie und Öffentlichkeit.
Schlüsselwörter
Massenauswanderung, Brasilien, Deutschland, 19. Jahrhundert, Sprachkontakt, Soziolinguistik, Riograndenser Hunsrückisch, Deutsch-Portugiesischer Sprachkontakt, Sprachmischung, Akkulturation, Kolonialisierung, Wirtschaftliche Faktoren, Soziale Faktoren, Sprachgebrauch, Sprachkompetenz.
Häufig gestellte Fragen: Deutschsprachige Migration nach Brasilien im 19. Jahrhundert und Entstehung des Riograndenser Hunsrückisch
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Massenauswanderung von Deutschen nach Brasilien im 19. Jahrhundert, die dazu führenden Faktoren und die daraus resultierenden sprachlichen Entwicklungen, insbesondere die Entstehung des Riograndenser Hunsrückisch. Sie beleuchtet den historischen Kontext, soziolinguistische Aspekte des deutsch-portugiesischen Sprachkontakts und analysiert den Einfluss von Ereignissen wie dem Verbot der deutschen Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ursachen der deutschen Massenauswanderung, die soziolinguistischen Auswirkungen der Einwanderung auf Brasilien, die Entwicklung des Riograndenser Hunsrückisch als Beispiel für Sprachkontaktphänomene, den Einfluss politischer Ereignisse auf den Sprachkontakt und einen Vergleich des Sprachgebrauchs in der Öffentlichkeit und in der Familie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum historischen Kontext und zur Migrantengeschichte und ein Kapitel zum Sprachkontakt und zur Soziolinguistik. Die Einleitung skizziert die Ziele der Arbeit und die Forschungsfragen. Das Kapitel zum historischen Kontext beleuchtet die wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Faktoren der Migration, den „Push- und Pull-Effekt“ und den Verlauf der Einwanderungswellen. Das Kapitel zum Sprachkontakt behandelt den deutsch-portugiesischen Sprachkontakt, die Isolation der deutschen Kolonien, das Deutschverbot nach dem Zweiten Weltkrieg, die Entwicklung neuer Medien und die Entstehung des Riograndenser Hunsrückisch.
Was ist das Riograndenser Hunsrückisch und wie ist es entstanden?
Das Riograndenser Hunsrückisch ist ein Beispiel für ein Sprachkontaktphänomen, das sich aus der Interaktion zwischen deutschen Einwanderern und der portugiesischsprachigen Bevölkerung Brasiliens entwickelt hat. Die Arbeit untersucht die Entstehung und die Merkmale dieser Sprache und stellt die Hypothese auf, dass sich das Riograndenser Hunsrückisch nicht allein aus dem Kontakt mit dem Portugiesischen gebildet hat.
Welche Rolle spielte das Verbot der deutschen Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg?
Das Verbot der deutschen Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg wird als ein entscheidender Faktor für die Entwicklung des deutsch-portugiesischen Sprachkontakts und die zunehmende Bedeutung des Portugiesischen betrachtet. Die Arbeit untersucht den Einfluss dieses Verbots auf die Sprachmischung und -entwicklung.
Wie wird der Sprachgebrauch in der Öffentlichkeit und in der Familie verglichen?
Die Arbeit plant einen Vergleich des Sprachgebrauchs in der Öffentlichkeit und in der Familie, um die sprachlichen Entwicklungen in verschiedenen Kontexten zu beleuchten. Die Rolle neuer Medien in diesem Kontext wird ebenfalls untersucht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Massenauswanderung, Brasilien, Deutschland, 19. Jahrhundert, Sprachkontakt, Soziolinguistik, Riograndenser Hunsrückisch, Deutsch-Portugiesischer Sprachkontakt, Sprachmischung, Akkulturation, Kolonialisierung, Wirtschaftliche Faktoren, Soziale Faktoren, Sprachgebrauch, Sprachkompetenz.
- Arbeit zitieren
- Janine Drephal (Autor:in), 2008, Migrantensprachen: Deutsch in Brasilien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265087